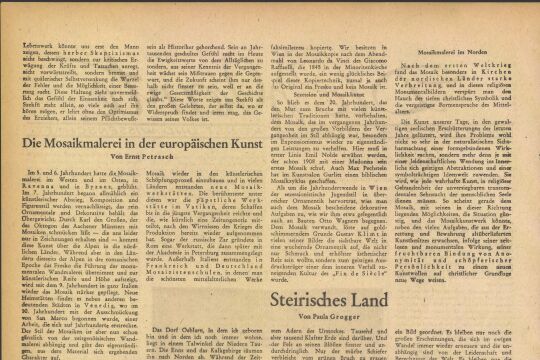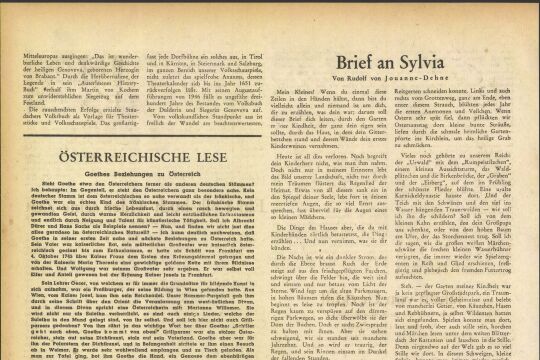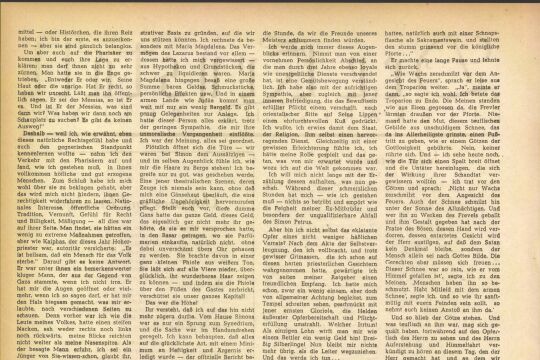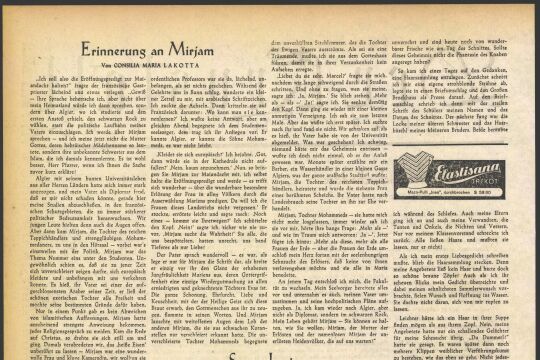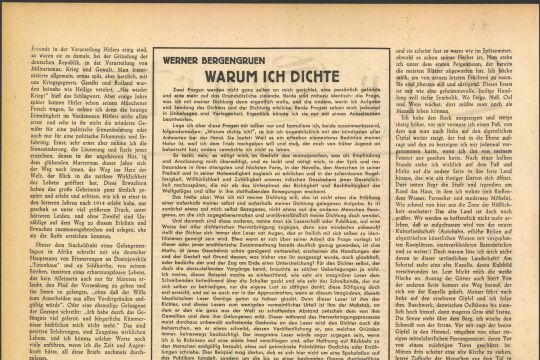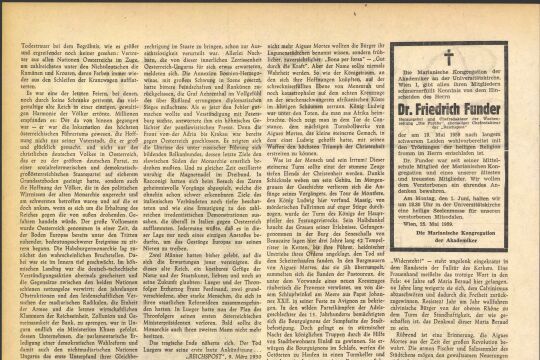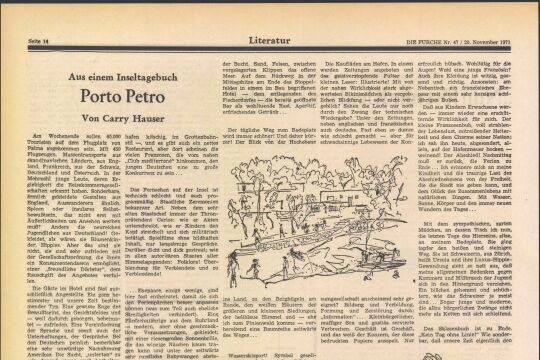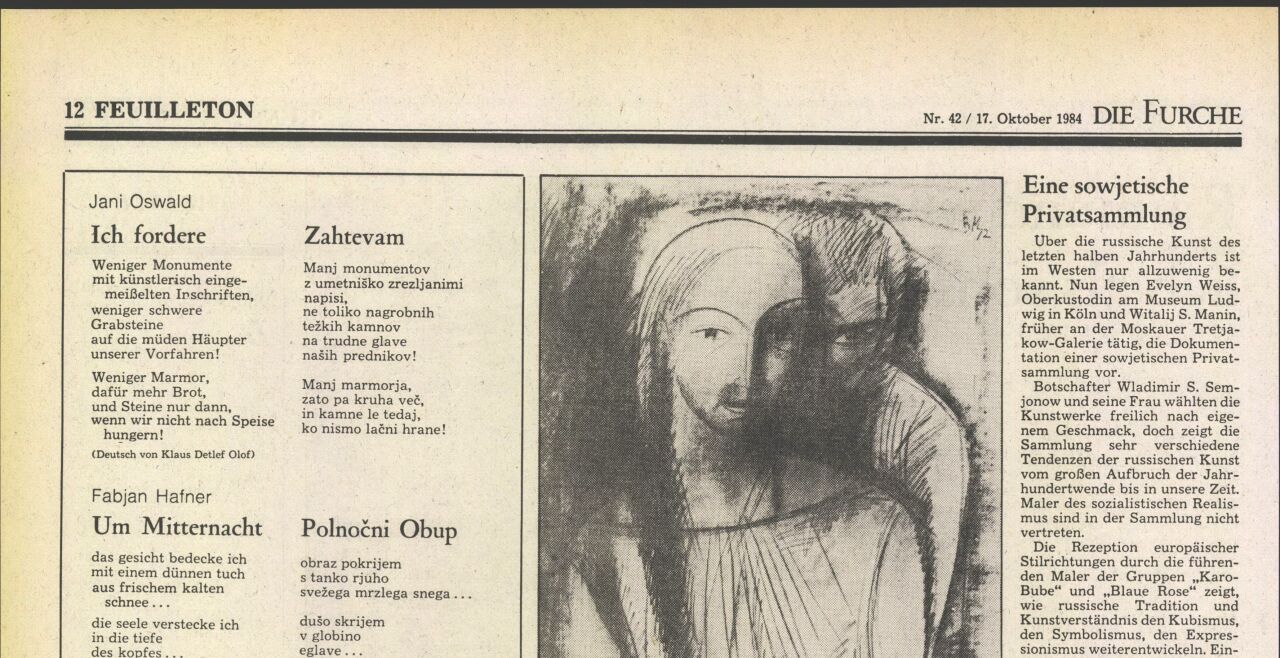
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Tag in Böhmen
Als mein Großvater um die Jahrhundertwende hier seinen ersten Posten als Landarzt antrat, hieß Horni Dvofiste noch Ober Haid und war eine rein oder überwiegend deutschsprachige Gemeinde. Vermutlich war er mit der Bahn gekommen, der Nachfahrin der legendären ersten europäischen Kontinentaleisenbahn, die Karls IV. Vision einer raschen und wirtschaftlichen Verbindung zwischen den Salzkammern Oberösterreichs und den böhmischen Landen hatte Wirklichkeit werden lassen.
Hinter dem Kerschbaumer Sattel fiel die Strecke. Von nun an entwässertes Gerinne zur Moldau hin, in ein Land, dessen Schauseite aus prächtigen Adelssitzen, riesigen Wäldern, herbstlichen Fasanjagden, weltberühmten Brauereien und opulentem Tafeln bestand. Hier, in Ober Haid, war die Krume dünn und das Klima rauh; die Gerste mag in jenem Jahr kaum kniehoch gestanden sein und die Ernteaussichten so schlecht wie im kalten Sommer 1984.
Damals mag mein Großvater die ersten Seiten des Schuldbuches vollgeschrieben haben, das bei seinem Tod Tausende unbezahlter Arzthonorare aufwies. Er aber brauchte sich wenigstens um die dringendsten existentiellen Bedürfnisse keine Sorgen zu machen, und dieses Privileg teilten nur noch jene mit ihm, die schon damals in großen Organisationen und Auffangbetrieben tätig waren: der fürstlich Schwarzenberg-sche Gutsverwalter und der Provisor der dem Rosenbergerstift Hoherifurth inkorporierten Pfarre.
Lehrer, Müller und Schmied hingegen standen in direktem Abhängigkeitsverhältnis von der Gemeinde: hatte der Bauer nichts zu ernten, so hatte der Schmied noch länger auf sein Geld zu warten, der Müller nichts zu mahlen, und die Brot- und Eierdeputate für den Lehrer fielen noch kärglicher aus. Meist hatte aber auch er eine kinderreiche Familie zu ernähren.
Der Grenzübertritt war ohne Formalitäten vor sich gegangen:
der einzige Ausweis, den der junge Dr. med. Johann Paul bei sich hatte, war das Diplom der Universität Graz. Weder Visum noch Umtauschpflicht hatten ihm das Gefühl gegeben, in ein fremdes Land zu reisen. Ein schwarzer Belag überzog Bahnsteig und Dächer, aber er rührte von der Kohle her und nicht von der hoffnungslosen Lethargie, die heute das Personal des Grenzbahnhofs befallen hat. Weder Wachtürme noch Stacheldraht schnitten in das Antlitz der Landschaft, die W. H. Auden selbst siebzig Jahre später als amiable bezeichnet.
Lieblich wirkt sie auch heute, an diesem Montag des Jahres 1984; die fernen Wälder sind in freundliches Blaugrün getaucht, ihre Schäden nicht sichtbar. Ein Aufklärungsflugzeug tuckert die Grenze entlang, ein uraltes Modell, das wie aus der Requisitenkammer der Stummfilmzeit entnommen zu sein scheint. Ein schmaler, grasiger und sichtlich mehr zuwachsender als ausgetretener Weg führt auf einen der modernen Wohnblöcke zu, mit denen das junge System seine Lebenskraft vor allem in Grenznähe zu demonstrieren versucht. Bunte Wäsche flattert im Wind, eine junge Frau läßt sich von ihrem Kind Kluppen und Höschen hinaufreichen, aber das Gebäude selbst steckt wie ein madiger Pilz im herbstelnden Boden: die bürgerlichen Tugenden Gediegenheit und Handwerksstolz sind mit der kommunistischen Machtübernahme restlos ausgestorben.
Die staubige Landstraße, die auf den weit entfernten Altort zuführt, ist von Eichen gesäumt. Dürr gewordene Stämme sind durch Ahorn und Linden ersetzt worden. Ein Protest gegen den als deutsch empfundenen Baum? Tatsächlich habe ich nirgends in Böhmen junge Eichen gepflanzt gesehen.
Vor mir flattern Kinder mit ihrer Betreuerin ortseinwärts; als ich in ihr Blickfeld trete, flüchten sie unter ihr Sommerkleid. Aber
Hemmung und Angst vor dem propagandistisch entfremdeten Nachbarn sind schwächer geworden: „Dobry den! Dobry den!" rufen sie gleich darauf mit ihren hellen Stimmen. Ich habe wie sie meinen sprachlichen Amphibiencharakter verloren und muß mein „Dobry den" erst heraufübersetzen — und doch: wieviel Fortschritt bedeutet selbst diese Floskel gegenüber dem früheren Schweigen!
Ein Blutbuchenhain umgibt Kirche und Friedhof von Ober Haid. Die Bäume, weniger reparaturanfällig und renovierungsbedürftig als menschliche Kunstwerke, vermitteln den Eindruck kleinbürgerlicher Heimatliebe. Ein Drama, von keinem Geschichtswerk erfaßt, hat an der Nordseite seinen Niederschlag hinterlassen:
Hier ruhet Franz Rehberger Lehrer in Ober Haid geb. 14. 11. 1837 gest. 6. 8. 1858 dessen Vater Josef Rehberger geb. 14. 3. 1804 gest. 10. 2. 1865 dessen Mutter Anna Rehberger geb. 23. 10. 1805 gest. 11. 1. 1895
Was geschah mit ihr? Verbrachte sie die letzten dreißig Jahre ihres Lebens als Almosenweib wie Bachs treue Gefährtin? Kümmerte sie im Schatten der Blutbuchen dem Tod entgegen, im Asyl des Betens, das die gute alte Zeit als einziges für die Einsamen, Alten, Erwerbsunfähigen, Pensionslosen übrig hatte?
Grell bescheint die Vormittagssonne die Priestergräber an der Südseite.
Im Pfarrhof, einem Relikt jener Zeit, als der Pfarrherr zugleich Wirtschafter war, bitte ich um den Schlüssel.
Ein Mann und eine Frau sitzen in der düster gewölbten, von einer massigen Mittelsäule getragenen Küche. Auf dem Tisch vor ihnen liegen einige Pilze: Rotkappen, das heutige Mittagessen. So habe ich alle tschechischen Geistlichen angetroffen: funktionslose Pensionäre, in den Gesichtern die Angst vor Demütigung und Deportation. Hier hat die Zeit nichts geheilt.
Die gehbehinderte Frau erhebt sich mühsam, geht mit mir zur Kirche. Feuchtigkeit, Moder und Kälte stecken in dem ungelüfteten, grauschleierigen Raum. In die Zwickel des Netzrippengewölbes des Presbyteriums sind in deutscher Sprache die Vaterunserbitten gemalt. Meine Begleiterin kann sie nicht mehr lesen, denn als ich sie auf das Gemüsebeet direkt vor den Priestergräbern hinweise, sagt sie achselzuckend „Moje ne! Moje ne!"
In der nahrhaften, aber durch die starke Reflexion staubdürren Friedhofserde kümmern Zucchini, Kren, Kapuzinerkresse, Salat und Schwarzwurzeln. Das kommunistische System ermöglicht einen solchen pietätlosen Akt; aber auch die Kommunisten begraben ihre Toten auf christlichen Friedhöfen. Und das ist nicht der einzige Widerspruch in diesem Umbruchsland: gerade die Denkmäler des Feudalismus, Kirchen und Schlösser, werden mit hohem Kostenaufwand bevorrangt renoviert.
Als ich aus dem verfallenden Relikt der Jahrhundertwende auf den moderngeschorenen Hauptplatz hinaustrete, fährt ein Jeep vor. Die Soldaten der Zoll- und Grenzwache, die sich eine Stunde zuvor belustigt um den seltenen Wandervogel gekümmert haben, springen heraus und eilen mit Körben und Bierfässern auf das Versorgungszentrum der genossenschaftlichen JEDNOTA zu. Registriert, aber unbehelligt bis zur nächsten Kontrolle in einer CSAD-Haltestelle unten an der Moldau setze ich meinen Weg fort.
Der Autor, wohnhaft im Weinviertel, ist Lyriker und Verfasser von Jugendbüchern.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!