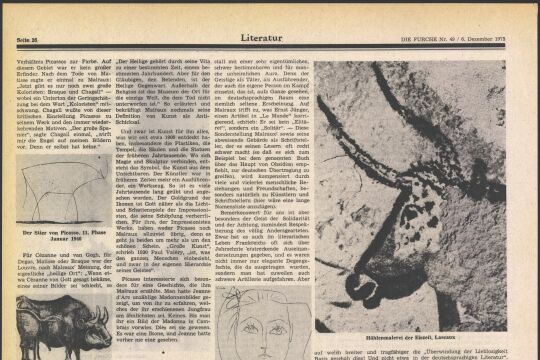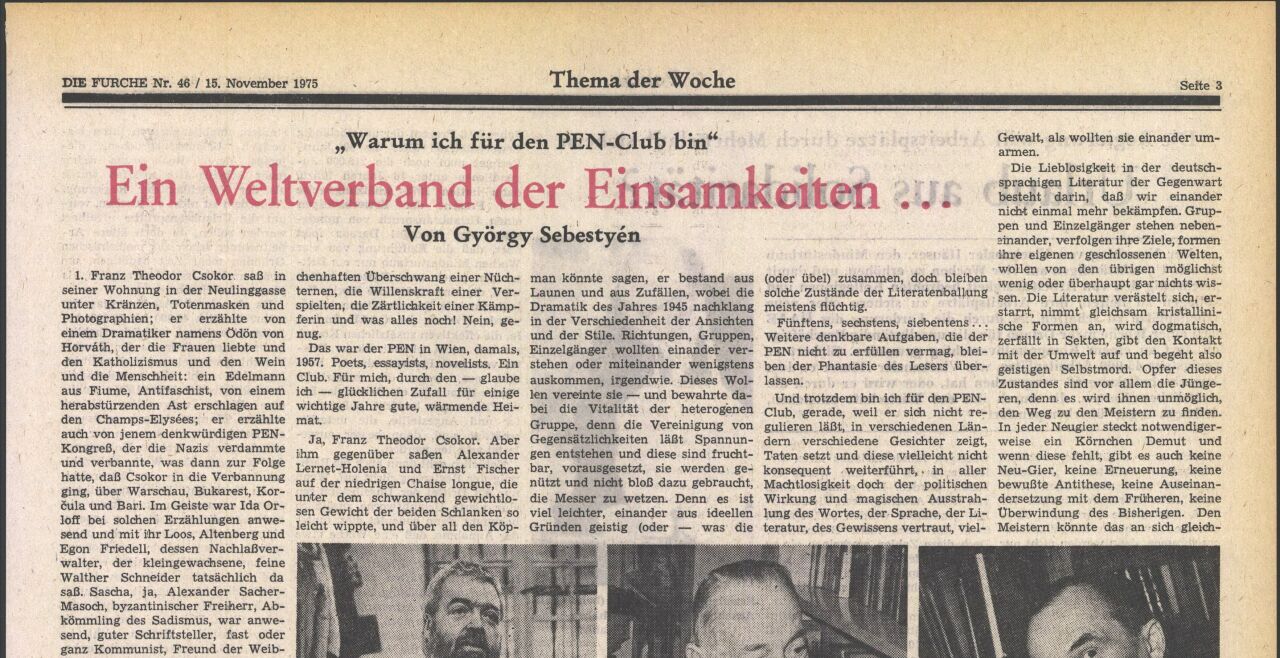
1. Franz Theodor Csokor saß in seiner Wohnung in der Neulinggasse unter Kränzen, Totenmasken und Photographien; er erzählte von einem Dramatiker namens ödön von Horväth, j der die Frauen liebte und den Katholizismus und den Wein und die Menschheit: ein Edelmann aus Fiume, Antifaschist, von einem herabstürzenden Ast erschlagen auf den Champs-Elysees; er erzählte auch von jenem denkwürdigen PEN-Kongreß, der die Nazis verdammte und verbannte, was dann zur Folge hatte, daß Csokor in die Verbannung ging, über Warschau, Bukarest, Kor-cula und Bari. Im Geiste war Ida Or-loff bei solchen Erzählungen anwesend und mit ihr Loos, Altenberg und Egon Friedeil, dessen Nachlaßverwalter, der kleingewachsene, feine Walther Schneider tatsächlich da saß. Sascha, ja, Alexander Sacher-Masoch, byzantinischer Freiherr, Abkömmling des Sadismus, war anwesend, guter Schriftsteller, fast oder ganz Kommunist, Freund der Weiblichkeit und der Schrullen, Hundefreund, Gourmet, einsam hoheitsvoll verwegener Trinker; aus Hietzing kam — wie unlängst erst zur Csokor-Feier — der Maler Carry Hauser, Expressionist, ein gründlicher Mensch, immer ein wenig besorgt, sehr verletzlich, sehr versöhnlich. Und auch eine Dame gab es, die die Geschäfte führte, E. H., dem Eingeweihten genügen die Initialen und dem Uneingeweihten könnte man das Wesen und die Erscheinung von E. H. in ein paar Zeilen ohnehin nicht begreiflich machen: den mädchenhaf ten Überschwang einer Nüchternen, die Willenskraft einer Verspielten, die Zärtlichkeit einer Kämpferin und was alles noch! Nein, genug.
Das war der PEN in Wien, damals, 1957. Poets, essayistsi, novelists. Ein Club. Für mich, durch den — glaube ich — glücklichen Zufall für einige wichtige Jahre gute, wärmende Heimat.
Ja, Franz Theodor Osokor. Aber ihm gegenüber saßen Alexander Lernet-Holenia und Ernst Fischer auf der niedrigen Chaise longue, die unter dem schwankend gewichtlosen Gewicht der beiden Schlanken so leicht wippte, und über all den Köpfen schwebte unsichtbar, jedoch spannungsgeladen spürbar wie eine Gewitterwolke, die unausgesprochene Frage: Mußten 1938 anständige Leute Österreich verlassen, um sich nicht zu beschmutzen, oder mußten sie bleiben, um auszuharren und das Mörderreich zu bekämpfen? Manchesmal kam noch Heimito dazu, mit zähnefletschender Höflichkeit, Heimito von Doderer, der große und nun endlich auch erfolgreiche Epiker, ein Mann der harten Konturen, der Cso-kors dithyrambischen, hymnischen Humanismus einigermaßen zu irritieren schien, und freilich saß auch Rudolf Henz am Tisch, voll der Kraft jener seltenen Personen, denen es gelingt, ohne Vereinfachung einfach zu sein.
Vergesse ich manche? Sicherlich. George Saiko, zum Beispiel, mit seinem Mongolenlächeln. Von Musil unwillkürlich geknechtet, Schelm, Schöngeist, empfindliche Seele und robuster Kerl in einer Person: er trank mäßig und erzählte Anekdoten. Und Qualtinger stahl Briefpapier, um die Meldungen über den Eskimodichter Kobuk an die Zeitungsredaktionen zu versenden, und manchmal kamen auch Gäste aus Deutschland oder aus anderen Ländern. Kokoschka verfertigte Zeichnung nach Zeichnung, um die technische Belegschaft des Burgtheaters freundlich zufriedenzustellen, Iyar Ivask aß nur Erdäpfelpüree und Eier, Günther Grass hatte mit Doderer gute Gespräche — ja, Grass mit Doderer! Wie Canetti mit Nabl, nicht im PEN, sondern in Graz. Eisenreich versuchte, Hans Flesch-Brunningen von den Vorzügen der deutschen Automobilfabrikation zu überzeugen und Robert Neumann wurde vom Bundespräsidenten Adolf Schärf empfangen und in die Geheimnisse der Leibstühle der Hofburg eingeweiht. (Nachwelt, schüttel nur den Kopf. Vorausgesetzt, du hast einen.)
2. So war der PEN in Wien und man könnte sagen, er bestand aus Launen und aus Zufällen, wobei die Dramatik des Jahres 1945 nachklang in der Verschiedenheit der Ansichten und der Stile. Richtungen, Gruppen, Einzelgänger wollten einander verstehen oder miteinander wenigstens auskommen, irgendwie. Dieses Wollen vereinte sie — und bewahrte dabei die Vitalität der heterogenen Gruppe, denn die Vereinigung von Gegensätzlichkeiten läßt Spannungen entstehen und diese sind fruchtbar, vorausgesetzt, sie werden genützt und nicht bloß dazu gebraucht, die Messer zu wetzen. Denn es ist viel leichter, einander aus ideellen Gründen geistig (oder — was die
Konsequenz ist — auch physisch) umzubringen, als aus dem bewußten Nebeneinander der Fremdheiten, ja, auch der Feindschaften, etwas Menschenmäßiges entstehen zu lassen. Gesellschaft ist ein Zustand des Kampfes, aber nicht allein des Kampfes. Der Kämpfer braucht das Gegenüber mehr als den Sieg. Doch darüber später.
3. Es ist nichts -leichter als über den PEN-Club zu schimpfen. Die Idee ist englisch. Also dürfen die Geister den Kontinentes zu Recht die kecke Frage stellen: Wozu brauchen denn ausgerechnet wir einen Club? Jene Kombination von Auslese und Toleranz, die in den englischen Clubs wirksam geworden ist, bleibt hierzulande ziemlich unbekannt.
Zweitens: Der PEN hat viele Gesichter. Der eine PEN-Club besteht aus Teetrinkem, der andere aus Kommunisten, der dritte aus sehr gebildeten, jedoch sterilen Schöngeistern, der vierte aus lauter Amateuren, der fünfte aus feinsinnigen Staatsbeamten, der sechste aus guten und wichtigen Schriftstellern, der siebente ausschließlich aus Prinzen — und alle diese Gruppen und Menschen sind bloß durch das Bekenntnis zur PEN-Oharta miteinander verbunden. Welch ein Durcheinander!
Drittens: Der PEN hat ja keine Macht. Er protestiert, er insistiert, er interveniert, aber strafen kann er ebenso wenig wie belohnen. Mitunter wird das sogenannte Weltgewissen wachgerüttelt, aber niemand weiß, wie dieses Weltgewissen zu definieren sei und was es dann, im wachen Zustand, zu bewirken vermag. Erfahrungen warnen uns vor pathetischen Illusionen.
Viertens: Der PEN kann nur in den seltensten Fällen etwas direkt bewirken. Und warum nicht? Weil er nichts anderes ist als ein Weltverband der Einsamkeiten. Ab und zu, da und dort finden sie sich wohl
(oder übel) zusammen, doch bleiben solche Zustände der Literatenballung meistens flüchtig.
Fünftens, sechstens, siebentens ... Weitere denkbare Aufgaben, die der PEN nicht zu erfüllen vermag, bleiben der Phantasie des Lesers überlassen.
Und trotzdem bin ich für den PEN-Club, gerade, weil er sich nicht regulieren läßt, in verschiedenen Ländern verschiedene Gesichter zeigt, Taten setzt und diese vielleicht nicht konsequent weiterführt,. in aller Machtlosigkeit doch der politischen Wirkung und magischen Ausstrahlung des Wortes, der Sprache, der Literatur, des Gewissens vertraut, vielleicht naiv, aber hartnäckig, denn es müßten sich doch für das menschliche Zusammenleben gewisse Normen finden lassen, revolutionäre oder religiöse, antagonistische oder harmonische — ja, diese kindliche Hypothese ist fürwahr grandios.
Der PEN ist eine Möglichkeit, man kann sie gut nützen oder überhaupt nicht, und man kann sie auch mißbrauchen. Diese Möglichkeit ist verhältnismäßig statisch, jedoch: man kann von den Adern nicht verlangen, daß sie nun ebenfalls zu strömen beginnen, nur um dadurch die eigene Vitalität zu beweisen.
Und ich bin für den PEN-Club auch, weil ich glaube, er könnte eines der Mittel sein zur Heilung eines bösen geistigen Übels. Nennen wir es: die Lieblosigkeit in der deutschsprachigen Literatur.
4. Nein, wir müssen einander gewiß nicht lieben. Wir können und sollen einander sogar bekämpfen. In diesem Recht und in gewisser Hinsicht auch in dieser Pflicht liegt unsere persönliche Freiheit. Man braucht zur Arbeit frische Luft. Den eigenen Standort sauberzuhalten ist geistige Hygiene. Als Catulle Mendes noch auf der Bahre lag, schrieb Andre Gide bereits den Satz, man möge dem Toten gleich auch seine Machwerke ins Grab nachschmeißen. Und Aragon lud seine Zeitgenossen zum Begräbnis von Anatole France in einem Artikel mit dem Titel „Habt ihr schon einen Toten geohrfeigt?“. Nein, Literatur ist nichts für zarte Gemüter.
Jedoch: die Kritik baut zwischen dem Angreifer und dem Ziel des Angriffes eine Brücke; die Leidenschaft der Attacke wird zum Stimulans, wird Vernichtung für den einen, wird aber Herausforderung für den anderen; die erbitterten Gegner müssen einander im Ringkampf doch berühren und manchmal umfangen sie einander mit einer derart atemlosen
Gewalt, als wollten sie einander umarmen.
Die Lieblosigkeit in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart besteht darin, daß wir einander nicht einmal mehr bekämpfen. Gruppen und Einzelgänger stehen nebeneinander, verfolgen ihre Ziele, formen ihre eigenen geschlossenen Welten, wollen von den übrigen möglichst wenig oder überhaupt gar nichts wissen. Die Literatur verästelt sich, erstarrt, nimmt gleichsam kristallinische Formen an, wird dogmatisch, zerfällt in Sekten, gibt den Kontakt mit der Umwelt auf und begeht also geistigen Selbstmord. Opfer dieses Zustandes sind vor allem die Jüngeren, denn es wird ihnen unmöglich, den Weg zu den Meistern zu finden. In jeder Neugier steckt notwendigerweise ein Körnchen Demut und wenn diese fehlt, gibt es auch keine Neu-Gier, keine Erneuerung, keine bewußte Antithese, keine Auseinandersetzung mit dem Früheren, keine Überwindung des Bisherigen. Den Meistern könnte das an sich gleichgültig sein, Wolf gang Koeppen kann ohne junge Anhängerschaft ebenso existieren wie Max Frisch, um nur zwei Namen zu nennen. Auch Flaubert hätte arbeiten können, ohne seine Erfahrungen an Maupapsant weiterzugeben, auch Tschechow wäre sich treu geblieben ohne die freundliche Zuneigung des jungen Maxim Gorki.
In der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart herrscht Frost. Erstarrt sind die Ideen. Voneinander völlig getrennt sind die Schreiber. Wir blicken in ein vereistes Aquarium.
Ist es nun aber ausgerechnet der PEN-Club, der imstande sein könnte, diesen Zustand, wenn auch nicht gleich, zu beseitigen, aber wenigstens zu mildern? Liegen denn die Ursachen der Krankheit nicht viel tiefer im Zustand der Gesellschaft? Kann man nur die Symptome heilen? Ja, ist es denn überhaupt richtig, von Korrektur, von Reform, von Hoffnung zu reden? Müßten wir nicht viel mehr die Zeichen der Krise klar hervortreten lassen, diese neue Eiszeit begrüßen, als Vorspiel für das Erscheinen der Apokalyptischen Reiter — denn was dem einen seine Apokalypse, das dem anderen seine Wiedergeburt?
Ich möchte all diesen Fragen bloß die nackte menschliche Existenz entgegensetzen, die Vitalität, die Freude und die Qual des Lebens, ja, diese ursprüngliche Kraft. Der Lebensinstinkt ist es, der uns verbietet, den lieblichen Frost eines neuen Biedermeiers als etwas Unabwendbares zu erdulden. Die gegenwärtige Lieblosigkeit wirkt nicht nur tödlich; sie macht das Existieren bis zu jedem Erfrierungstod zudem unerträglich. Im PEN findet, wer will, eine Chance, durch Freundschaften geschützt, geistig zu überleben. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.