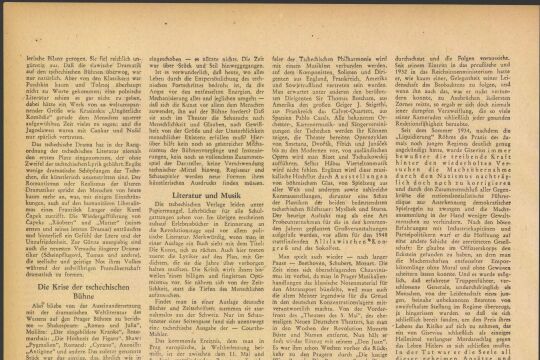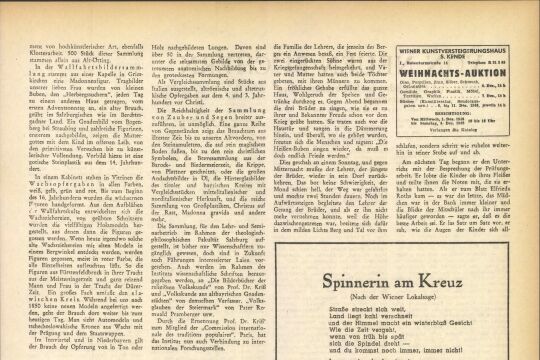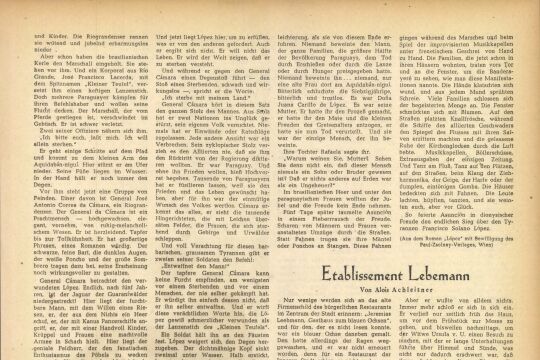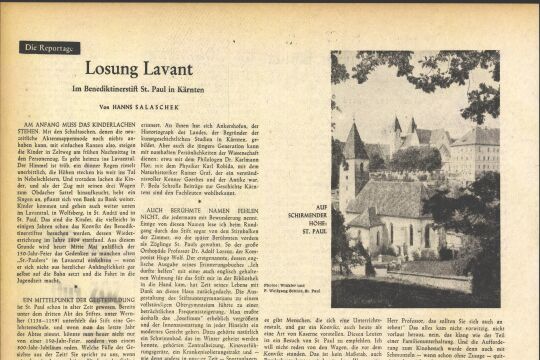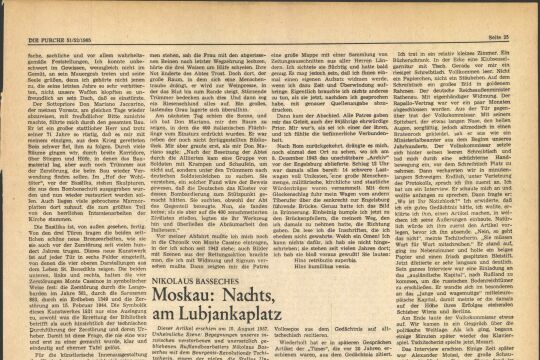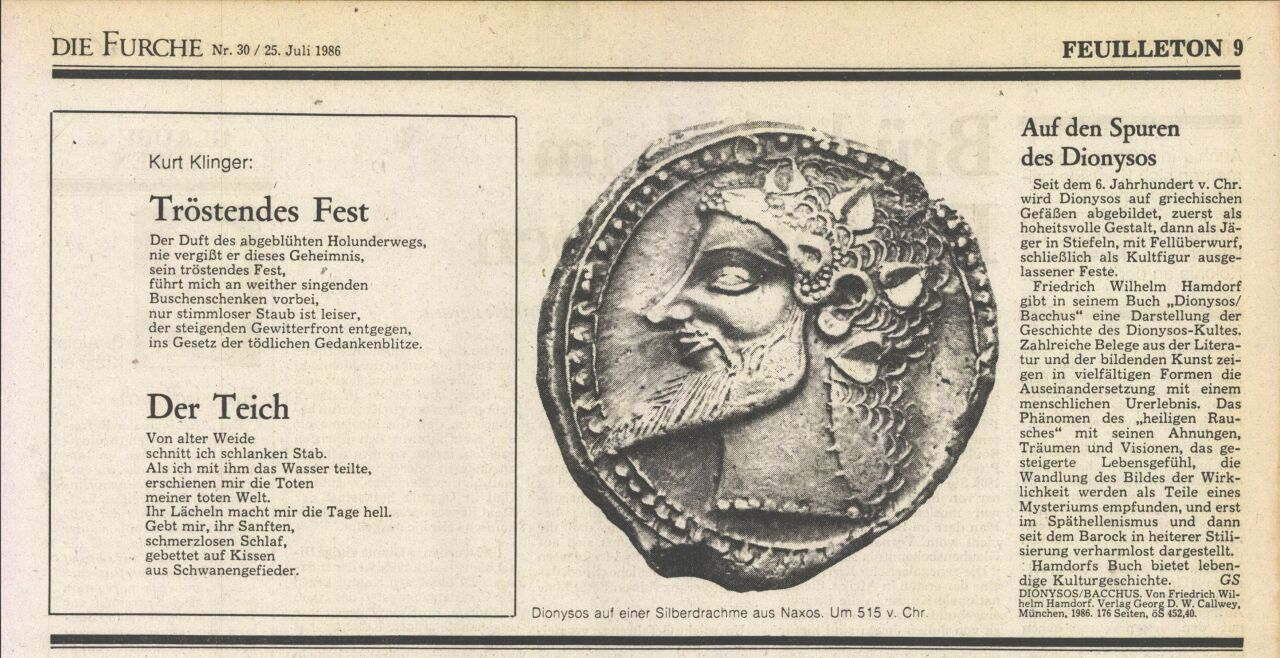
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine hübsche Karriere
Der Oberleutnant Doktor Lorenz Taferner stand im Mai 1945 mit ein paar ihm verbliebenen Männern in Böhmen und schlug sich nach dem Waffenstillstand nach Österreich durch, wo er zunächst bei Bauern untertauchte, sich dann den Amerikanern stellte. Nach kurzem Aufenthalt in einem Sammellager wurde er mit den wichtigen Papieren entlassen. Da man in den letzten Jahren viele Juristen verheizt, die wenigen Kriegsstudenten in großdeutschem Recht ausgebil-
det hatte und Taferner nie bei-der Nazi-Partei gewesen war, erhielt er sehr schnell eine Anstellung an einem Salzburger Gericht.
Seine Eltern wohnten in Wien, wohin er sich der Russen wegen vorerst nicht wagte, als aber die Verhältnisse zwischen den nun längst zerstrittenen Siegern normalisiert schienen und er seinen Interzonenausweis erhalten hatte, mietete er einen Platz in einem Lastwagen, weil man damals so am leichtesten über die Enns ins russische Gebiet reiste. Beim Anblick der ersten russischen Uniformen bekämpfte er ein deutlich spürbares Herzklopfen, kam jedoch glücklich in Wien an und fiel seinen Eltern in die Arme.
Sein Vater, seinerzeit von den Nazis außer Dienst gestellt, saß wieder im Amt und wollte ihm eine Karriere ermöglichen. Lorenz lehnte ab, traf jedoch auf diesem Urlaub in die Kindheit Livia Bert-tolini, Tochter eines mit dem Vater befreundeten Sektionschefs im Justizministerium, und heiratete sie bald darauf. Nach dem Staatsvertrag, als die Russen abgezogen waren, bewarb er sich um das Bezirksgericht Leynsam, wo er blieb, um aller sogenannten Entwicklung zu entgehen.
1948 wurde in Wels sein Sohn Max geboren. Es war noch die Zeit des Schwarzmarkts und der Schrotthändler. Mit dem Gehalt eines subalternen Richters konnte man damals nur mit Mühe überleben; man hauste auf Untermiete in zwei Zimmern, und der kleine Max mußte sich damit abfinden, was es gab oder nicht gab: wenig Milch, kein Weißbrot, eine einzige Sorte Wurst, alles nur auf Marken, von Spielzeug ganz zu schweigen. Was immer er in seinen ersten Jahren hörte, es handelte sich immer darum, daß alles zu teuer sei und man kein Geld dafür habe. 1952 kam seine Schwester Rosalinde zur Welt, das Interesse der Mutter wechselte vom Vierjährigen zur Neugeborenen, der Vater arbeitete neben seinem Staatsdienst als Lehrer in einer Juristenschule und war in den we-
nigen freien Stunden kaum ansprechbar.
Schon sehr früh lernte Max unter Schmerzen, daß er allein stand. Seinem Charakter entsprechend beklagte er sich nicht, sondern versuchte, ohne Hilfe mit der geänderten Lage fertig zu werden. Die Geburt der zweiten Schwester Regine 1955 kostete viel weniger Uberwindung. Längst hatte er sich abgekapselt, und der späte Bruder von 1960 war überhaupt kein Problem mehr, denn um diese Zeit stand er wesentlich größeren Schwierigkeiten gegenüber.
Leynsam hatte damals noch keine Hauptschule, geschweige denn ein Gymnasium, also schickten die Taferner den Sohn ins Konvikt von Kremsmünster, von wo er nur zu den Schulferien nach Hause entlassen wurde. Während solcher Ferien bemühte sich der Vater, Max Liebe zum Jagen und Fischen beizubringen, aber es nützte nichts, und der alte Tafer-
Die Hochkonjunktur ist lange vorbei. Auch für Literaten, die sich mit Politologenjargon trainiert und sensibilisiert haben, scheint sie nun abzuflauen.
Es ist schon richtig, daß diese Schriftstellerart zumeist dem asthenischen Typ angehörte, ein gruseliges Faktum, wenn man bedenkt, daß es sich der marxistischen Interpretationsmethode gänzlich entzieht. Aber etwas Fett haben in den letzten zwei Jahrzehnten auch diese Literaten zugesetzt, sind quer durch die Lande gefahren, um bei Debatten „die Worte abzuklopfen“, wie Michael Scharang erzählt: eine anstrengende Arbeit, welche berechtigt, über jede Sparte von Arbeitswelt zu schreiben.
Diese Arbeitswelt, mag es sich um Gußstahl oder ums Buttern handeln, gehorcht aber einer anderen Physik als jene der „Wort-Abklopfer“, weshalb wir nun ziemlich unvermittelt und erstaunt in die wirtschaftliche Regression geraten sind.
Alarmierend für Literaten! Denn bisher standen die ministeriell begründeten Spielwiesen als künstlerischer Kindergarten bis ins hohe Mannesalter bereitwillig offen. Deshalb haben „viele von uns einen massiven rechten Kulturkampf zum ersten Mal erlebt“.
Daß in einer solchen Wirtschaftsphase aus dem „Spiel mit der Literatur ein harter Job wird“, müßte von dem, der nach
ner mußte feststellen, daß die Brücke zwischen Vater und Sohn abgebrochen war. Das hatte freilich seine guten Gründe.
Knaben sind kleine Männer, und wenn man sie sich selbst überläßt, bauen sie eine Männerwelt auf, die sich in ihrer Struktur nur wenig von der eines Wolfsrudels unterscheidet. Es gab keine Mutter mehr, und die Patres konnten sie beim besten Willen nicht ersetzen, wollten das vielleicht nicht einmal. Wer in eine solche Gemeinschaft eintrat, der mußte sich erst einmal bewähren, und nicht etwa in Latein oder Mathematik, sondern im Raufen und im Kampfsport. Nie durfte er sich in ein Gespräch der Starken einmengen, und wenn er nicht in ehrfürchtiger Demut verharrte, setzte es Prügel. Nur ein Sieg im Ringen oder ein Erfolg auf dem Spielfeld half zur ersehnten nächsten Sprosse auf der gesellschaftlichen Leiter.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!