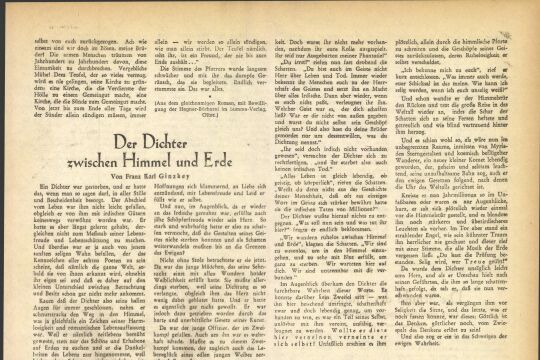Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine Nacht der Zweifel
Jan griff nach seiner Brille und I sah auf seine Arbeit nieder. Die I Auf Zeichnungen für seine Reden lagen ausgebreitet vor ihm.
Seite um Seite, eng beschrieben mit seiner klaren, festen Handschrift. Er hatte noch zu Hause ein Rohmodell für die Predigten in ihrer Gesamtheit angefertigt. Er hatte es überdacht und überarbei tet, doch die letzte Vollendung konnte erst dann geschehen, wenn er dort war, wo die Gedanken zu ausgesprochenen Worten werden sollten. Es würden noch viele Arbeitsstunden vergehen, bis er sie sagen würde, neu geformt und angereichert mit jener Atmosphäre, die ihm hier so fühlbar entgegenströmte.
Er ging und sah auf seine Arbeit nieder. Dann trat er an das geöffnete Fenster, legte die Hände auf das Brett und beugte sich hinaus. Es war eine milde Nacht, der Himmel war voller Sterne.
Er lauschte auf die Geräusche der Stadt, sie drangen gedämpft zu ihm herauf. Und er dachte an die Menschen, die diese Stadt bewohnten. Sie gaben ihr die Seele, sie erfüllten die dunkle Häusermasse mit Leben.
Und mit einem Male wünschte er, unter ihnen zu sein. Teilzunehmen an ihren Schicksalen, an ihren Wünschen und Gedanken. Auf ihre Worte zu hören und ihnen zu sagen, daß er einer von ihnen war, einer, der Wünsche und Sehnsucht kannte, Verzweiflung und Hoffnung. Glück und Leid...
„Ich versuche, euch alle gleich zu lieben“, murmelte er. Und dieser Satz sollte dann der Anfang seiner ersten Ansprache im Dom sein.
„Doch - ist das überhaupt möglich? Zwar habe ich, selbst sein Geschöpf, den Auftrag vom Vater, euch als seine Geschöpfe zu lieben; aber ihr seid Masse für mich! Ich möchte diesen Aurtrag erfüllen, aber ich bin mir bewußt: Die Behauptung, alle gleich zu lieben, wäre Gedankenlosigkeit und Unehrlichkeit mir selbst gegenüber.
Wie kann ich denn überhaupt Menschen lieben? Ich kann es nur, wenn ich zu mir selber ja sagen kann, wenn ich mich selbst liebe. Das setzt aber voraus, daß ich weiß, wer ich wirklich bin, daß ich mein Selbst kenne, mein Selbst ohne Masken, ohne Täuschungen.
So lade ich euch nun ein, mit mir diese Frage zu stellen — sie ist das Tor zur Selbstverwirklichung, das Tor zur Liebesfähigkeit — die Frage: Wer bin ich wirklich? Gibt es eine Basis für das Gebäude meines Selbst, eine feste, dauerhafte, unzerstörbare?
Diese Basis heißt für mich: Ich bin Geschöpf Gottes, geschaffen nach Gottes Ebenbild. Das Abbild seiner selbst — des absolut Guten. Daher bin ich von meinem Ursprung her gut, ich bin Person mit Würde und Freiheit. Allerdings — ich bin als Geschöpf von meinem Schöpfer abhängig, aus mir selbst wäre ich nichts, ich verdanke mich ganz Gott, er ist seiner selbst mächtig, er ist absolutes Personsein und vom Geschöpf unabhän gig. Gerade deswegen wird Gott keine Konkurrenz für den Menschen, die ihm keinen Raum zum Selbstsein lassen und ihn erdrük-ken würde. Gerade deswegen schenkt er ihm Freiheit, Freiheit der Gedanken und des Tuns, er möchte Beziehung zu freien Geschöpfen — Abbilder, in denen sich sein Gutsein spiegelt. Keine Tat eines Menschen, und sei sie noch so schlecht, kann diese Absicht Gottes, kann diese Gottebenbildlichkeit des Menschen einschränken oder widerlegen!
Wohl aber ist es für uns Menschen wichtig, Gott als unseren Ursprung anzuerkennen und uns ihm zuzuwenden, denn nur in der Beziehung zu ihm hält diese Basis für unser Selbst, von der ich gesprochen habe, wirklich und dauerhaft. Weil wir Ebenbilder Gottes sind, ist es uns möglich, voller Mut uns selbst zu begegnen, uns anzunehmen, uns zu lieben.
Laßt uns gemeinsam aber auch von jenen Empfindungen sprechen, die sooft dies verhindern, weil sie sich wie schwere dunkle Wolken über unsere Liebesfähig keit legen und sie zu ersticken drohen.“
Erst jetzt merkte er es, wie laut er gesprochen hatte. Zu ihnen, nach denen er sich nun sehnte! — Einmal hatte er sich von ihnen entfernt.
War allein gewesen, damals, als die Welt für ihn leer gewesen war.
Denn er hatte sich selbst verloren, er war für sich selbst zu einem Fremden geworden für so lange Zeit.
Am Beginn einer Nacht, deren Kälte alles in ihm vernichtet hatte. Für immer—wie es ihm damals schien.
Er trat vom Fenster zurück, fröstelnd nun, weil er plötzlich diese Kälte wieder fühlte. Die Arbeit war vergessen, er legte sich auf das Bett und verschränkte die Hände im Nacken.
Seine Augen schlössen sich. Er war nicht mehr er. Nicht mehr der Mann, dessen Herz eben noch erfüllt gewesen war vom Frieden. Von der Liebe, die er einmal verloren hatte und die er sich so bitter hart hatte zurückholen müssen. Neu erwerben auf dem weiten Weg, den er hatte gehen müssen, um hier zu sein.
Aus dem soeben im Linzer Veritas-Verlag erschienenen Roman „Dombrowski“ der ober-österreichischen Autorin.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!