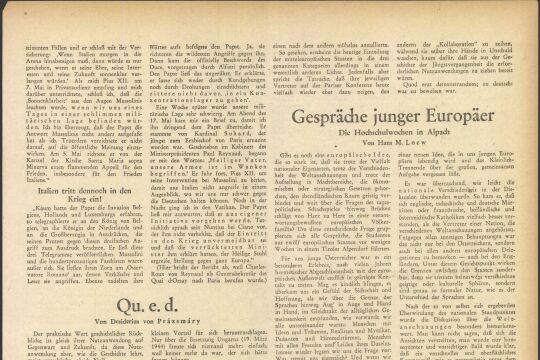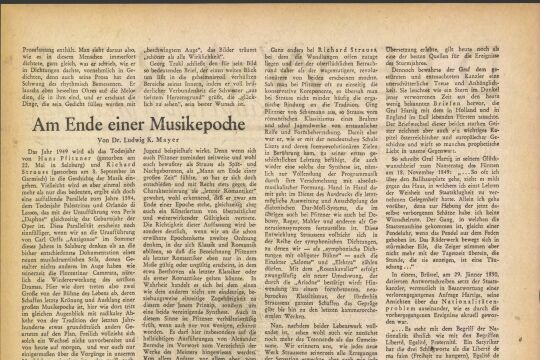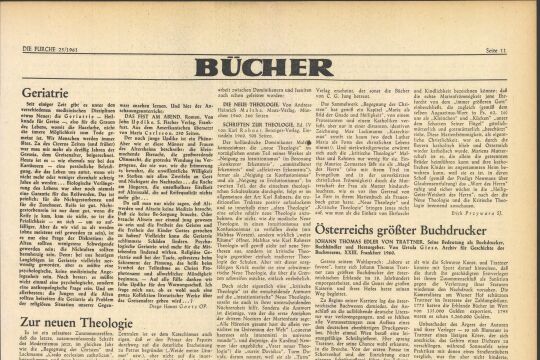Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine Universität lehrt: Integration
sich bereits in den Gründungsakten der Universität aus. Der Gedanke, diese zu schaffen, wurde zum erstenmal in aller Form 1872 durch Dr. Constantin Tomaszczuk ausgesprochen. Er unterbreitete einen diesbezüglichen Antrag im buchen-ländischen Landtag. Darin brachte er1 den Wunsch zum Ausdruck, die Universität möge eine deutsche Universität sein. Dabei gehörte der Antragsteller nicht der deutschen Sprachgruppe an. Tomaszczuks Vater war Ukrainer, seine Mutter Rumänin. Als patriotischer Rumäne war er zugleich Österreicher und ein Mann, der aus praktischen und nicht aus ideologischen Erwägungen heraus seinem Volke dienen wollte. Daher sein Vorschlag einer deutschen Universität mit der Begründung, daß die deutsche Kulturwelt seinem Volke ein europäisches Niveau sichern werde. Es war Tomaszczuk, der weiterhin als Mitglied des österreichischen Reichsrates Vorkämpfer für die Schaffung der Universität war, wobei er von Seiten Kaiser Franz Josephs tatkräftige Unterstützung erhielt. Es ist bezeichnend, daß Kaiser Franz Joseph bereits vor dem Antrag im Reichsrat vom 26. März 1894 durch Entschließung vom 7. März desselben Jahres seinen Unterrichtsminister angewiesen hatte, ein Projekt für die Schaffung einer Universität in Czer-nowitz vorzulegen.
Gerade weil an ihren Anfängen ein Mann wie Tomaszcuk wirkte, der aufrechter Rumäne, aber auch Österreicher, also in Wirklichkeit Europäer war, hat die Universität ihre Funktion im fernsten Osten der alten Monarchie voll und ganz erfüllen können.
Es liegt in der logischen Entwicklung des ökumenischen und nicht totalitären Gedankens der Universität Czernowitz, daß diese auch in der Politik die Idee der Integration vertrat. Integration, das hieß in den Tagen, da die Universität gegründet wurde, „die österreichische Idee“. Hier in der Bukowina wurde der Versuch unternommen, auf einem gemischt-nationalen Raum im Sinne der gemeinsamen geistigen Ausrichtung und einer in der Vielfalt trotzdem einigenden Kultur die Völker zu gegenseitiger Freundschaft und Verständnis zu führen. Österreich — das darf nicht vergessen werden, war eben jenes lebendige Bindeglied zwischen dem alten und dem neuen Europa, dessen Funktion erst jetzt und in wachsendem Ausmaß erkannt wird.
Österreich hat nämlich inmitten der tragischen Verirrungen des 19. Jahrhunderts den Mut aufgebracht, allein dem Zeitgeist Widerstand zu leisten. Man hat den Nationalismus als den Mythos des 19. Jahrhunderts bezeichnet, mit Recht. Man hätte allerdings hinzufügen müssen, daß dieser Mythos von Natur aus un-, ja anti-europäisch war. Er ist die Leugnung des europäischen Gedankens schlechthin, weil ihm das Element der Freiheit und Toleranz fehlt.
Der richtig verstandene Staatsbegriff zeigt sich in diesem Lichte als mit dem Zentralismus unvereinbar. Toleranz kann sich nur in einer dezentralisierten Gemeinschaft durchsetzen. Zentralismus oder Dezentralisation — das ist übrigens gerade heute eine jener politischen Fragen, deren Lösung die Zukunft unseres Kontinents entscheiden kann.
Die Dezentralisierung hat übrigens einen Vorteil, der nur selten als solcher erkannt wird: Je breiter die Rekrutierung möglicher Talente, desto größer die Hoffnung, solche zu entwickeln. Gibt es Erfolgschancen nur in der Zentrale, so liegen daneben weite Gebiete brach, deren Talente in Verlust geraten können. Diese Gefahr bestand in der Bukowina nicht. Das Land und seine Universität waren lebendiger Beweis für die Richtigkeit einer dezentralisierenden Politik. Das österreichische System, das auch als Modell für ein wahres Europa dienen sollte, war und ist richtig, sofern man die Arbeit nicht auf Augenblickserfolge ausrichten will, sondern langfristig, im Sinne des allgemeinen Interesses, in Angriff nimmt.
Kurzfristig gesehen, ist die Bilanz der Zeit zwischen 1875 und 1914 positiv zu werten. Obwohl bei Errichtung der Universität einige Persönlichkeiten sich skeptisch über ihre wissenschaftlichen Aussichten ausgesprochen hatten, kann man sagen, daß die drei Fakultäten von Czernowitz überdurchschnittliche Leistungen erbracht haben.
Bezüglich der theologischen Fakultät wurde bereits auf deren Bedeutung innerhalb der Orthodoxie hingewiesen. 1878 beschloß die griechisch-orientalische Bukarester Synode, Theologen zur Ausbildung nach Czernowitz zu schicken; bald darauf unternahm das Serbische Patriarchat ähnliche Schritte.
Von der juridischen Fakultät wiederum seien nur die Namen einiger Professoren erwähnt, die einen großen Ruf genossen haben. Bezeichnenderweise waren die meisten von ihnen Deutsch-Böhmen. Das trifft auf Friedrich Kleinwächter, Professor für politische Ökonomie, zu. Auch der spätere österreichische Finanzminister und international, bekannte Nationalökonom, Joseph Schumpeter, begann seine Karriere in Czernowitz, ebenso der Prager Privatrechtler Robert von Mayr-Harting.
Im Bereich der philosophischen Fakultät schließlich haben sich mehrere Professoren nicht nur auf dem Gebiete der deutschen, sondern auch auf jenen der ukrainischen Philologie hervorgetan. Im weiten deutschen Sprachraum ist der in Czernowicz habilitierte Historiker Raimund Friedrich Kaindl bekanntgeworden, während für die ukrainische Sprache die Leistungen der Professoren Emil Kalusniacki, Ignaz Onynskiewicz und Stefan Smal-Stocki historische Bedeutung haben.
Vielleicht das schönste Zeichen des Erfolges, jenseits der politischen und geistigen Entwicklung der Bukowina, war die Loyalität, die von den Studenten der Universität entgegengebracht wurde und wird. Die Tatsache, daß viele Studentenverbindungen den Zusammenbruch überlebt haben, ist ein Beweis für diese Verbundenheit. Das ist nicht nur in Österreich und Deutschland so, sondern auch an fernen Orten, wie Tel Aviv in Israel, oder New York in den Vereinigten Staaten. Mit geringen Mitteln, unter schwierigsten Umständen ist etwas geleistet worden, auf das alle, die die Ehre hatten, an diesem Werke teilzunehmen, stolz sein können. Die Universität hat den Traum ihres Gründers, Dr. Constantin Tomaszczuk, verwirklicht.
Stellt man die Frage nach Erfolg oder Mißerfolg unter langfristigem Aspekt, so muß man den Zusammenbruch nach verhältnismäßig wenigen Jahren im Auge behalten. Die Universität, wie sie einstmals war, besteht nicht mehr, denn das, was die Sowjetunion in Czernowitz errichtet hat, verdient nicht mehr den Namen einer Universität. Wir müssen aber jenseits der zeitbedingten Rückschläge die große überzeitliche Leistung im Auge behalten. Und in dieser Hinsicht hat Czernowitz vieles erreicht, dessen Wert erst in den kommenden Jahrhunderten voll erkannt werden wird.
In einem gemischt-nationalen Raum wurde bewiesen, wie gut die Nationen im Geiste einer gemeinsamen Kultur friedlich -zusammenarbeiten können. Es ist möglich, verschiedene Völker und Glaubensgemeinschaften zu integrieren, ohne ihre Eigenheit anzutasten. Das ist die Aufgabe, die uns heute erst recht wieder gestellt ist. Wir haben nicht mehr die Ausrede, das sei zuviel verlangt, denn jene, die vor uns in Czernowitz für Österreich und damit manchmal vielleicht unbewußt bereits für Europa gearbeitet haben, beweisen, was alles bei gutem Willen und Verständnis möglich ist. Und noch etwas hat uns Czernowitz gezeigt. Es war in einer damals zusammenbrechenden Welt der lebendige Beweis dafür, daß keine gute Handlung umsonst getan, keine große Idee jemals umsonst gedacht wurde. Man muß die Dinge immer wieder in der großen historischen Perspektive betrachten. Man muß erkennen, daß jeder von uns berufen ist, am Werk des Schöpfers teilzunehmen. Es ist nicht unsere Aufgabe, prometheisch den neuen Menschen zu erschaffen oder die Natur unserer Zeitgenossen zu verändern. Es kann nur unsere Pflicht sein, dieser unserer Welt, wie sie uns gegeben ist, etwas mehr Freiheit, etwas mehr Frieden und etwas mehr Verständigungsbereitschaft zu schenken. Gibt es viele genug, die diesem Ideal dienen, dann ist ihnen auch Erfolg beschieden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!