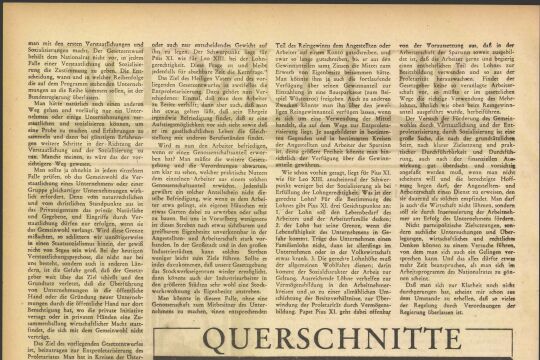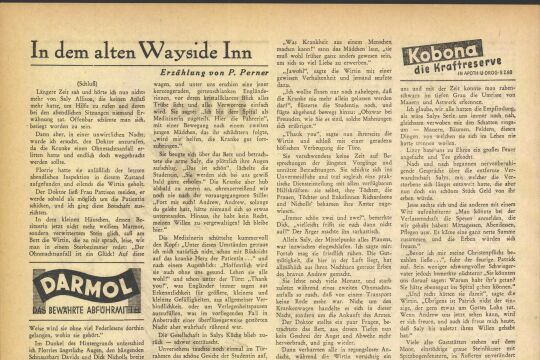Jeden Morgen zwischen vier und fünf sei das alte Männlein die schmale Stiege des Wertheimerhauses htnaufgekraxelt und habe sich, die Pawla’tschen entlang, zur Tempelpforte vorgetastet; an dem hölzernen Gitter, das die Frauenabteilung vom Hauptraum abtrennt, hängt noch immer seine Jarmulka. Leute mit schlechtem Schlaf konnten ihn dann hören, wie er seine Gebete sprach — stundenlang mitunter. Ja, es mochte Vorkommen, daß der eine und andere Nachbar davon aufwachte und sich beschwerte, so wenig er sonst gegen diesen Moritz Gabriel vorzubringen hatte. Die rührende Erscheinung, stets in schlichtes grobes Bauemgewand gehüllt, war jedermann im Umkreis wohl vertraut; wer ihn zu sich einlud, wußte: er rührte nur koschere Speisen an, und sein Laden, die kleine Schnittwarenhandlung an der Esterhäzystraße, blieb regelmäßig am Sabbat geschlossen.
Mit Gabriels Tod im Jahre 1971 sank das kleine Be’thaus in der Unterbergstraße zu Eisenstadt wieder in jenen musealen Schlaf zurück, der es — mit viel Glück — schon über die bösen Jahre der NS-Ära hinweggerettet hatte. Die drei, vier übrigen Familien seines Glaubens, die sich nach dem Krieg in der Nähe wiederangesiedelt haben, lassen sich kaum je im alten Gettoviertel blicken — dann noch eher gelegentliche Besucher aus den USA oder aus Israel und hie und da ein Judaist, der vielleicht über die berühmten „Sieben Gemeinden” arbeitet, so wie, damals, um 1930, sich Franz Werfel hier an Ort und Stelle in die Geheimnisse einer der sonderbarsten mosaischen Siedlungen Mitteleuropas vertiefte, schwerlich ahnend, daß all dies frischerworbene Wissen über die „Ürisrigen” schon wenige Jahre später in einen seiner erschütterndsten, wenngleich unvollendet gebliebenen Romane einfließen würde: „Cella oder Die Überwinder”, Totenklage auf ein — binnen zwanzig Jahren nun schon zum zweitenmal — untergehendes Österreich.
Cella, die heranwachsende Tochter des kleinen jüdischen Provinzanwalts Dr. Hans Bodenheim aus der burgenländischen Landesmetropole Eisenstadt, ein aufsteigender Stern am Himmel der Konzertpianistik — das wäre das eigentliche Thema des Romans gewesen. Doch schon bald und über weite Strecken verlor Franz Werfel es aus den Augen — zugunsten der ungleich drängenderen, ungleich dramatischeren Schilderung des politisch-geistigen Chaos im Österreich des „Anschluß”-Jahres 1938.
Am Ende des Romans — gleichwie zu dessen Anfang — stehen die Vorbereitungen zu einem Konzert, das nie zustandekommt. An welchen Umständen der Autor Cellas Auftreten in der Carnegie Hall zu New York scheitern lassen wollte, wissen wir nicht. Wohl aber wissen wir, woran ihr Debüt bei der musikalischen Festakademie scheitert, die Prinz Ernst im Haydn-Saal des Esterhazy-Schlosses angesetzt hat: Hitlers Einmarsch kommt dazwischen …
Armes Land! Selbst die nackten Akazien trauerten, und die gänsebe- schnatterten Dorftümpel waren voll Kot und Schlamm.
Meine „Cella”-Tour führt von Parndorf durchs Seevorland an die Grenze hinter Mörbisch — durch Winden zunächst, wo man vor Jahren im Pfarrhof zusammenkam, um sich über Werfels Schwarzweißzeich- nung der Figuren zu alterieren (eine Verfilmung der „Geschichte vom wiederhergestellten Kreuz” war damals gerade in der Television zu sehen gewesen); durch Donnersikirchen, wo mir ein Student seinen Stolz schildert, den er empfunden habe, als er bei der Schullektüre des Werfel- Textes auf den Namen seiner Hei- matgemeinde gestoßen sei; durch St. Margarethen, wo längst nichts mehr an die verlassene Zigeuner-
Siedlung erinnert -mit ihren „Krejcar, Krejcar!” bettelnden Kindern; zuletzt durch Rust, die Stadt des „orientalischen Barocks”, von deren Anhöhen noch immer „in gestaltlosem Grau” der „Schilfsee von Neusiedl” zu verschwimmen scheint. Hinter Mörbisch kommen dann die ersten ungarischen Wachtürme ins Bild, am Grenzbalken (zur Linken die letzten Weingärten vorm Schilfgürtel) warnt eine Tafel: „Verbotener Weg, da teilweise auf ungarischem Gebiet”, und wenige Meter hinter den rotweißroten Grenzpflöcken, keiner weiteren Erklärung bedürftig, der Stacheldrahtverhau. Der österreichische Grenzer, der hier seinen Unterstand hat, ist gerade auf Patroudllengang unterwegs: Ich kann ihn nicht fragen, wieviele Schüsse inzwischen jenen anderen gefolgt sein mögen, die Franz Werfel an ebendieser Stelle — März 1938 — die Braunhemden auf den Rabbi Fürst abfeuern ließ, jenen heroischen Dr. Aladar Fürst, der den mit ihm gemeinsam verjagten Glau- bensbrüdern das Leben rettete, indem er das seine hingab.
In meinem Traum bin ich seit langer Zeit den hundertjährigen Platanen, Ulmen, Eichen und Linden des Schloßparks wieder begegnet. Sie schienen inzwischen zu übernatürlicher Breite und Höhe gewachsen zu sein. Ihre Kronen erbauten Räume, feierlich wie Kathedralen. In Moosgamaschen bis zum Knie, in herbstbunten Überwürfen und Ehrenmänteln standen sie steif wie großmächtige Wojwoden, die hohen Besuch erwarten.
Eisenstadt. Landeshauptstadt. Wo anfangen? Werfel hat hier topographisch aus dem Vollen geschöpft. Und beinahe auf jede Verfremdung verzichtet: Stadtluft macht; frei—rauch literarisch. Die Haydnkirche ist die Haydnkirche, der Hauptplatz ist der Hauptplatz, das Schloß ist das Schloß. Selbst die „Weiße Rose”, in deren langgestrecktem Theatersaal, „über und über behängt mit rotweißroten Fähnchen, Bändern, Girlanden, Lampions”, er die unfrohen Gesichter der „ungeschickt gekleideten Pfahlbürger”, die so sehr den Wein brauchten, um ihren Alltagsmißmut abzulegen, ihr Ballfest feiern ließ, hat zwar mittlerweile einen anderen Namen angenommen, aber für die ältere Generation ist es nach wie vor „Die Rose” geblieben. Und der Schloßpark ist der Schloßpark.
Ist er es wirklich? Ich finde ihn verwildert, vernachlässigt, ungepflegt. Der Rasen gehörte öfter geschnitten, den Bäumen fehlt die hegende Hand, der Leopoldinenweiher ist zugeschüt’tet, Wasserfall und Felsschlucht eine Ruine, die Orangerie verwahrlost, das Tempelchen eine einzige Schmierfläche mit Hinterlassenschaften wie „Gammler sucht Gammlerin zwecks Gammeins!” Mir fällt der Traum vom Schloßpark ein, den Werfel seine Hauptfigur, den Eisenstädter Advokaten Dr. Bodenheim, träumen läßt, und in dem diesem der „dicke grüne Feuerbrand” wie eine Mahnung erscheint, wie „ein Vorwurf, eine Rüge, als hätte ich ihm gegenüber etwas versäumt”. Fürwahr, ein Wahrtraum …
Ich versuche dennoch gerecht zu sein: Es ist Winter — kaum die Jahreszeit, die Schönheit eines Parks zu beurteilen. Aber spielt nicht auch das Schloßparkkapitel von „Cella” mitten im Winter? In der Kanzlei des fürstlichen Esterhäzyschen Rechtsbeistands, die ich in einem der Trakte der dem Schloß gegenüberliegenden „Ubikation” finde (dort, wo einst die Stallungen, die Reitschule, die Wagenburg und die Hauptwache untergebracht waren) und in der die ungarische Sprache gleichen Rang ein- nimmt wie die deutsche, finde ich meine Befürchtungen aufs schlimmste bestätigt: Der Fürst habe den unersetzlichen Naturpark, einst weit über die Landesgrenzen hinaus gepriesen, ohne jede Gegenleistung der öffentlichen Erholung gewidmet und müsse nun mitansehen, wie er zweckentfremdet werde und ge- geschände’t. Fußballstadion, Weinkost — wie sei da an neue Pflanzungen zu denken! Und was werde das nächste sein — Moto-Cross vielleicht?
Umso dankbarer ist man im Umkreis der Schloßherrschaft für die Anerkennung, die die humane Gesinnung des Hauses Esterhazy bis in die jüngste Zeit herauf von jüdischer Seite erfährt. Tatsächlich waren es ja die Esterhazys, unter deren Schutz das Judenviertel von Eisenstadt Jahrhunderte hindurch eine so ruhige Entwicklung nahm: Bis 1938 war der heutige Ortsteil Unterberg eine selbständige politische Gemeinde. Die fünf, sechs Gassen zwischen dem Westflügel des Schlosses und dem Spital der Barmherzigen Brüder sind noch immer, wiewohl längst nicht mehr jüdisch bevölkert, ein faszinierend interessanter Bezirk. Durch einen frühbiedermeierlichen Torbogen betrete ich, was einmal das Getto gewesen ist. Vor mir die Residenz des milllonehschweren Weinhändlers, Kunstsammlers und Zionisten Sandor Wolf, der in der Gestalt eines Barons Jacques Emanuel Weil in Werfels Roman wiederkehrt: Seine berühmte Altertumssammlung, auf die seinerzeit sogar der Baedeker hinwies, blieb nur zu einem bescheidenen Teil dem Burgenland erhalten; das meiste ging nach dem Krieg ins Ausland. Wolf selber konnte den Nationalsozialisten via Ungarn entkommen, er starb 1946 in Haifa. Außerhalb Eisenstadts, an einem Berghang oberhalb der Ubungs- schule der Pädagogischen Akademie, hat seine Familie auf eigenem Grund ein Urnenmausoleum anlegen lassen; den Namen Sändor wird man dort allerdings vergeblich suchen. Dafür finde ich in einer Matrikel der israelitischen Kulturgemeinde aus dem 19. Jahrhundert einen Notar namens Isaak Weil: Werfel hat bei der Namensgebung die sonderbarsten Anleihen vorgenommen.
Hinter dem Wolf-Palais das gleichfalls stattliche Wertheimer-Haus, dessen Privattempel dem geplanten Jüdischen Kulturinstitut eingegliedert werden wird — ein weiterer Beitrag zur Geschichte vom wiederhergestellten Davidstern, die derzeit mit viel Fleiß im Burgenland geschrieben wird. Hier residierte vorzeiten der kaiserliche Oberhöf- und Kriegsfaktor Samson Wertheimer, eine der Finanzgrößen aus den Tagen der Türkenkriege, Landesrabbiner von Ungarn, Böhmen und Mähren. Schräg vis-ä-vis stand bis nach dem Krieg die Synagoge. Die SA- Leute hatten in der Reichskristall-
nacht wohl ihr Inneres demoliert, nicht aber, wie. eine Gedenktafel in dem an dieser Stelle errichteten Gewerkschaftshaus heute kühn behauptet, angezündet. Eine redliche Geschichtsschreibung verlangt es, fest- zuhalten, daß es erst die Wiener Israelitische Kultusgemeinde war, die nach 1945 als Rechtsnachfolger den intakten Bau veräußert hat. Der neue Besitzer ließ ihn dann abtragen und einen Neubau hinstellen.
Ich biege ums Eck in die Wertheimergasse ein; an ihrem Ende — dort, wo schon bald die ersten Weingärten beginnen — liegt der alte jüdische Friedhof. Die Lichter des Krankenhauses tauchen die halbverwitterten hebräischen Grabtafeln in geheimnisvolles Halbdunkel — eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges. Wer ihre Schriftzüge zu lesen verstünde, fände hier Stoff für ein ganzes Buch. Der alte Schulrat Klampfer hat es geschrieben. Ich suche den passionierten Heimatforscher in seinem kleinen Eisenstädter Haus auf, um mich von ihm in die „Cella”-Materie einweihen zu lassen, so wie einst Werfel sich im Hause Wolf Zugang zur Geschichte des burgenländischen Judentums verschafft hat. Josef Klampfer ist an solchen Besuch gewähnt; vor einigen Jahren, erzählt er, habe er einen Zeitungsmann aus Tel Aviv durchs ehemalige Getto geführt. Am Resultat, einem großauf- gemachten Artikel in der deutschsprachigen Zeitung „Jedioth Chadas- hot”, hatte er allerdings einiges auszusetzen. „Ein Gang durch Eisenstadt gleicht dem Besuch eines Friedhofs” — konnte er das auf seiner Heimatstadt sitzen lassen? Und . so fertigte er, Punkt für Punkt, für sein Privatarchiv eine Berichtigung an. „In Eisenstadt”, lese ich nun dort, „pulsiert ein reges Geschäftsleben.”
Im Schloßcafe, dort, wo sich früher einmal der Eingang zum Getto befand und wo man, gleich dahinter, noch heute dem Fremden jene eiserne Kette aus dem vorigen Jahrhundert zeigt, mit der der Schames zum Sabbat die Fahrbahn absperrte, treffe ich mich mit dem jungen Deutschprofessor M. Ich will von ihm erfahren, wie man am Ort der Handlung zur „Cella” steht. Nun, man kennt - das Kapitel vofn wiederhergestellten Kreuz (das Werfel bekanntlich aus dem Gesamtmanuskript herausgelöst, überarbeitet und 1942 in Los Angeles als Privatdruck der Pacific Press herausgebracht hat), man hat es — zusammen mit anderen „Bur- genlandtex’ten” aus prominenter Feder — mit staatlicher Förderung in einer Anthologie über „Das Grenzland in der Literatur” unter die Leute gebracht, und man liest es an den höheren Schulen. „Aber die Frage der historischen Wahrheit — die klammern wir dabei aus. Wir beschränken uns kn Unterricht darauf, die allgemeine Menschlichkeit des Textes für uns anzuwenden.”
Mir gefällt, Wie M. sich zu keinerlei modischen Enthusiasmus animieren läßt. Er genießt den Vorteil, einer Generation anzugehören, die sich beim Stichwort Judentum Unbefangenheit leisten kann. Für ihn gibt es nicht nur attraktivere Werfel- Texte: „Die vierzig Tage des Musa Dagh”, den „Abituriententag” und „Die Hoteltreppe”, sondern auch attraktivere Autoren. Ich ersuche ihn, von seinem persönlichen Urteil abzusehen: Wie denn sonst die Leute hier über „Cella” dächten? „Ich glaube, die Gedichte”, erwidert er nach einigem Zögern, „die Gedichte sind ihnen lieber.” Gedichte wie etwa das vom Neusiedler See:
Der geschmolzenen Flut unbeweglicher Spiegel
Wird von dem flachen, dem tropischen Tiegel
Wie eine Luftgebilde umfaßt.
Weit lagert am Fuß der bühligen Treppe
Im schleppenden Tag die wäßrige Steppe
Als Österreichs seltsamer Gast.
(Dies ist das — stark gekürzte — Werfel-Kapitel aus Dietmar Griesers neuem literarischem Reiseführer „Schauplätze österreichischer Dichtung”, der im Herbst bei Langen- Müller herauskommt).