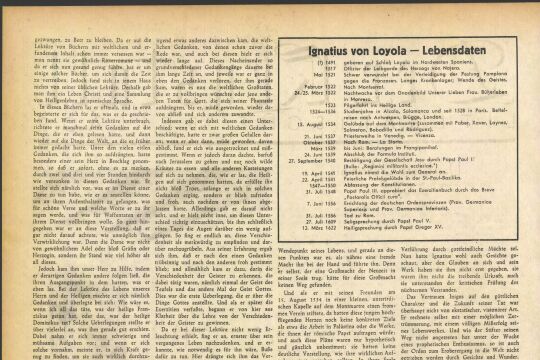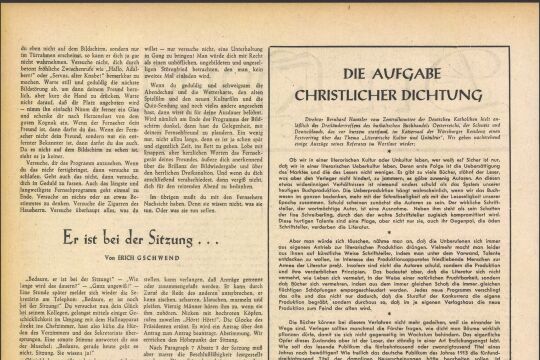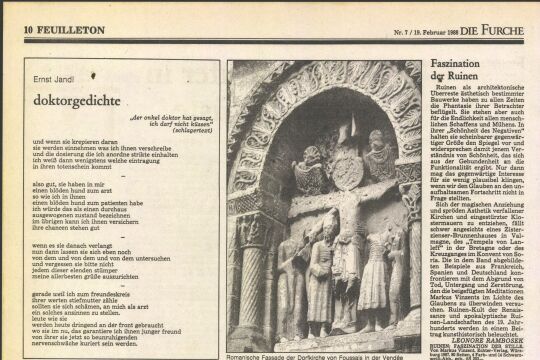Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erinnerte Urschrift
In der modernen Literatur, besonders aber in der modernen Lyrik, scheinen Text und Deutung, Gedicht und Gedichtinterpretation untrennbar miteinander verbunden zu sein. Oft genug erweist sieh aber auch — wie etwa im Falle des Formalismus oder der Texttheorie — das literarische Programm als das eigentlich Neue, Schöpferische; der literarische Text hingegen als eine mehr oder minder geglückte Variation ästhetischer Ideologie. Versucht man, moderne Lyrik an solcher Übereinstimmung von Theorie und Praxis zu erkennen, dann freilich ist Christine Bustas Lyrik nicht modern. Sie hat keine oder zumindest keine starre ästhetische Theorie, ihr ist Zugehörigkeit zu einer literarischen Schule kaum nachzuweisen, für sie ist das Entstehen eines Gedichtes
kein Vorgang, der sich — abgewandelt — stets wiederholt, sondern eine Erfahrungsform von Wirklichkeit — und wie jede Erfahrimg leicht zu verletzen.
Denn wohlgemerkt: es geht hier nicht um das Verknüpfen von Ursache und Wirkung, nicht um ein Verhältnis also, das einfach berechenbar, voraussagbar ist, als vielmehr um die Ausweitung von Empfänglichkeit, um eine Art methodisch entwickelter Bereitschaft und Empfindlichkeit für das Wunderbare oder für die Gnade. In einer Briefstelle heißt es darüber: „Wo ich mit der härtesten Wirklichkeit ringe, und um sie, ist es eine Wirklichkeit, die Gnade und Wunder nicht ausschließt, sondern sie mitenthält, wie die Bildtafeln des Isenheimer Altares Martyrium, Grauen und Teufelsspuk mit Engelkonzert und innigster Mutterfreude vereinigen zur großen Weltschau...“
*
Dieses Streben nach Universalität, in die selbstverständlich auch der Bereich der Natur einbezogen ist, hat das Werk der Dichterin scheinbar in Gegensatz zu jenen literarischen Praktiken unserer Zeit gebracht, für die Dichtung sich zu politischem Engagement verengt. Gerade so eine Reduzierung wird aber der Lyrik Christine Bustas nicht gerecht. Und das aus zwei
Gründen: Erstens durchziehen diese Lyrik doch deutlich soziale und politische Themen und sie zielt zweitens — und auch das kann nicht gut geleugnet werden — auf Veränderung des Bewußtseins ab — auf eine Veränderung freilich, die nicht durch starre Dogmen und Vorschriften reglementiert wird oder die an der Kandare eines parteipolitischen Wunschdenkens einherläuft. Diese Veränderung setzt — den Jahresringen ähnlich, an denen auch die Umwelteinflüsse ablesbar sind — an der bisherigen Erfahrung an. Sie sondert nicht aus; im Gegenteil: sie bezieht mit ein, umschließt das Denken langer Jahre, erweist sich deswegen auch als nicht zu eng, wächst also mit. Ein Mitwachsen, das ich selbst erfahren habe. Als „Der Regenbaum“ in erster
Auflage erschienen war, geisterte in den Hirnen von uns Jungen und Jüngsten der Literatur noch Brechts Verdikt, nach Aschwitz über Bäume überhaupt zu sprechen. Wir erkannten zwar Christine Bustas hohe handwerkliche und poetische Meisterschaft an (beneideten sie wohl auch, ohne uns dies aber einzugestehen), ließen vielleicht noch ihre Bildsprache, ihre Metaphorik gelten (die jedoch rauschte uns schon zu romantisch im Ohr), lehnten aber jedenfalls ihre Thematik als unzeitgemäß ab. Inzwischen haben manche von uns dazugelernt. Vor allem haben wir begreifen gelernt, daß sich mit der Dialektik so gut wie alles ableiten und rechtfertigen läßt, wenn nötig, sogar ein neues Auschwitz. Denn wo allein gesellschaftliche Bedingungen anerkannt werden, pervertiert der Mensch alsbald zu einem Objekt der Manipulation.
- *
Und dann ist inzwischen auch die Natur wieder rehabilitiert worden. Freilich, das Gespräch über Bäume bleibt einstweilen noch aus der deutschen Literatur verbannt. Aber immerhin, Natur gilt uns heute nicht mehr als etwas, das im Prozeß der Kulturentwicklung einfach ausgelöscht, weitgehend denaturiert werden soll, sondern wir erkennen in ihr unsere komplementäre Daseins-
weise, ohne die Kultur einfach gar nicht möglich wäre. Vielleicht erkennen wir das heute erst, weil wir näher denn je an die Grenzen der Lebensfähigkeit gekommen sind. Christine Busta hat das ganz ohne Zweifel vor uns erkannt und in ihren Gedichten gestaltet. Sie war schon damals — das verstehen wir jetzt allmählich — eine Grenzgängerin. Und wir beginnen nun erst aufzuholen.
Ihr Natursinn ist demnach auch nicht — wie wir Jungen damals glaubten — in romantischer Verklärung oder einfacher Spiegelung befangen: er ist vielmehr durchaus ein gebrochener; Zuflucht zu einer heilen Welt sucht sie nicht. Das soll jedoch nicht etwa heißen, daß die Dichterin nicht da oder dort versucht hätte, eine solche heile Welt in der Sprache zu beschwören. Wo sie dies jedoch getan hat, ist das weder geschehen, um peinigenden Realitäten zu entfliehen, noch um sich der Verantwortung zu entziehen, die dem Schriftsteller von der Gesellschaft heute abverlangt wird. Christine Bustas Verantwortungsgefühl ist jedoch weitaus radikaler, als daß es sich mit gesellschaftlichen Hausmitteln begnügen würde: es geht bis zu den Wurzeln zurück, verfolgt die Risse und Sprünge unserer geschichtlichen Existenz und spürt
deren Tektonik nach. Ihre Reise in die Vergangenheit, die für das Werk dieser Dichterin so charakteristisch ist, wird jedoch nicht zum Selbstzweck und daher als Vergnügungsreise unternommen: stets fördert sie dabei etwas zutage, das den magischen Ursprung, diesen Ur-Sprung ihres oder ganz allgemein des Daseins und des Denkens bloßlegt.
Dabei bleiben ihre Metaphern stets im Bild oder besser gesagt, sie münden- ins Symbol. In jenen Bereich des Ausdrucks, in dem die Spaltung in rationale und irrationale Teilwelten ganz einfach nicht mehr besteht. Bewußte und unbewußte, der Innen- wie der Außenwelt entnommene Elemente werden in diesen Gedichten zu natürlicher Einheit zusammengesehen und setzen Bewußtsein in Bewegung: ein schlagartig einsetzendes Er-innern, ein Erkennen oder Wiedererkennen, frei von jedem begrifflichen Zwang und daher umgreifend, ergreifend. Denn nur „der Obskurant sucht mit Licht nach Finsternis“ (Mynona). — Oft bestehen Christine Bustas Gedichte daher bloß aus kargen Chiffren oder Kürzeln, sie lassen jedoch ahnen, wie die Urschrift des ganzen Tertes gelautet haben mag und wieviel uns selbst noch zu tun übrigbleibt, diesen Text wiederherzustellen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!