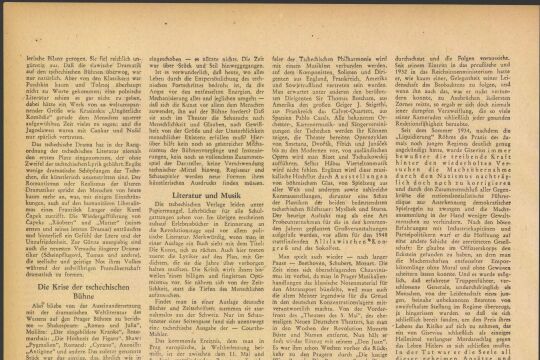Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ernst Fischer und das Endgültige
Ich hatte ihn zuvor niemals aus der Nähe gesehen und niemals auf so kurze Distanz seine Stimme dermaßen gehört, daß ich die Intonation einer jeden Silbe ausnehmen konnte. Bis zu jenem Tag vor nunmehr fast 20 Jahren, an dem ich zum erstenmal das Kulturbudget der Bundesregierung vor dem Nationalrat zu vertreten hatte. Das Hohe Haus war fast leer, jenes „leere Haus“, als das ich es zuletzt einmal am Schluß einer endlosen „Kulturdebatte“ apostrophiert habe. Nur die kommunistische Fraktion hielt ihre Bank auf der äußersten Linken besetzt; die anderen Fraktionen hatten unter Hinterlassung kleiner Spähtrupps den Saal verlassen. Am Wort war der Kommunist Ernst Fischer. Vor sich hatte er eine Einheitsfront, die von den mit versteinerten Gesichtern dasitzenden Genossen seiner Fraktion bis zu den übrigen zeitunglesenden, schwatzenden, herumstehenden und herumgehenden Volksvertretern reichte. Das Wort hatte der Abgeordnete, aber der sprach, war ein Mensch, der in einer grenzenlosen Einsamkeit und Verlassenheit die ungeheure Kraft seiner Sprache gebrauchte. Eine Kraft, wie sie damals und seither kaum ein zweiter im Hohen Haus besessen hat. Hier war sie: die Kraft der Rede, die etwas ganz anderes ist als das literarische, namentlich das theatralische Wort unter den Gesetzen des fixierten Textes und der Regie.
Junge Intellektuelle von heute werden vielleicht die jetzt posthum erschienenen Erinnerungen Ernst Fischers an die Jahre 1945 bis 1955 als die Sentimentalitäten des alten Mannes abtun. Mögen sie es tun. Sie täten es mit der gleichen Naivität, mit der ein Friedensleutnant vom Kampf redet, den er nicht kennt. Freilich ist es für Ernst Fischer eine Fatalität, daß er mit diesem Buch in der Fortsetzung seiner Erinnerungen in eine Ära gerät, deren geistiges Klima er selbst zuletzt nicht mehr ertragen konnte. Was der Autor, gestorben am 13. Juli 1972, nicht mehr beschreiben kann, das ist seine enorme Position in der Neuen Linken der sechziger Jahre, als deren Prophet er starb, wie Moses in der Wüste.
Jener Ernst Fischer, der 1945 im Gepäckstroß der Roten Armee nach Österreich heimkehrte, um das zu erfüllen, was jetzt als „Illusion' übergetitelt ist, schreibt an seinem letzten Lebenstag auf eines der letzten Blätter seiner unvollendet gebliebenen Erinnerungen: „Ich gebe zu: Es ist ein Glück für dieses Land (Österreich), daß es nicht kommunistisch wurde, die Tschechoslowakei und Ungarn beneiden uns.“ Der Gegner, der in einer Stunde wie dieser das vorliegende Buch kommentiert, müßte sich schämen, würde er wie Hitler seinen Freunden zurufen: Und ihr habt doch gesiegt. Vielmehr verhält er an der Stelle, wo der „von Natur aus skeptische Intellektuelle“ Ernst Fischer von der Faszination des „Endgültigen“ schreibt. Indem Ernst Fischer diese Endgültigkeit in einer Immanenz suchte, geriet er mit seiner Konsequenz in das Niemandsland zwischen der modernen provisorischen Daseinshaltung zufolge eines Progressismus ad in-finitum, und jenem Rückfall in parareligiöse Vorstellungen, wie sie Max Horkheimer vor seinem Tode hatte.
Ernst Fischer blieb bis zuletzt der veritable Typ des Revolutionärs: Der von früher amtierenden Eliten Exilierte, um den aber noch eine Aura zufolge des im Liberalismus bestandenen Bündnisses von Bildung und Besitz ist; für den die Existenz in jener amorphen Schicht unausstehlich war, in dem das Appeasement zwischen abgesunkenen aristokratischen und bürgerlichen Eliten und Revolutionären stattfand, deren Elan erstarb, als Wohlstand und Sicherheit „für alle“ greifbar wurden.
In diesem Jahr 1973 lebt kein Mitglied der Provisorischen Staatsregierung von 1945 mehr, das willens oder imstande wäre, so wie Ernst Fischer die Erlebnisgeschichte der Resistance der ersten Nachkriegsgeneration im Rückblick nach einem Vierteljahrhundert zu verfassen. Fachwissenschaftler, vor allem aber sozialistische Wächter der Zeitgeschichte, werden manchen Akzent, den der Autor setzt, vehement verneinen. Die Freunde Julius Raabs sind dem Autor zu Dank verpflichtet, daß er aus der legendären „Figl-Fischerei“, aus einem sozialistischen Wahlslogan, die geschichtliche Wahrheit heraushob: Die historische Konfrontation Ernst Fischers mit dem letzten großen konservativen Politiker in Österreich, Julius Raab. Die Schilderung der Interna der KPÖ, die letzthin zum Ausschluß Ernst Fischers aus dieser Partei führten, sind keine Nova und, im Vergleich zu anderen Parteien, keine Einzigartigkeiten. Was hervor-stichf, ist der Abgang Ernst Fischers von dieser Bühne des Parteigeschehens, für dessen Schilderung er nicht mehr das Wort hat: Seine ungeheure und weithin hörbare Anklage gegen den „Panzerkommunismus'', der 1968 noch einmal in der CSSR siegte. Dieser Abgang unterscheidet sich doch in einigen Graden von der Haltung eines bürgerlichen Wechselwählers, der, malkontent wie er ist, einmal seiner Partei einen „Denkzettel“ geben will oder vom Exodus eines Taufscheinchristen, der den Taufschein in der Dokumentenmappe behält und ohne Aufsehen seine künftige Registrierung als „konfessionslos“ anzeigt. Indem Ernst Fischer ging, schlug er keine Türen hinter sich zu, er riß andere auf. Nicht jene, die ihn noch einmal in die Salons seiner ehemaligen Standesgenossen führten, sondern andere, hinter denen sich eine endlose Einschlicht ausbreitete, deren Qual er in keiner Zeile offen zugesteht, die aber der innere Gehalt des Buches ist.
Politikermemoiren sind fragwürdig geworden. Im Zeitalter der Datenspeicherung und der Dokumentation kämpfen Hirn und Herz des politischen Erzählers gegen den Wust einer in Papier versteinerten Vergangenheit an, der Fakten zu Akten macht. Schade, daß Ernst Fischer im bürgerlichen Lager auf keinen Gegner gestoßen ist, der damals oder heute sein Schicksal zwischen Idee und Wirklichkeit beschreibt. Der Autor hat in glücklicheren Tagen zuweilen Besseres über Kultur und Kulturpolitik geschrieben. Merkwürdig bleibt der Nachhall der Abschiedsworte, die er am 22. Dezember 1945 bei seinem Scheiden vom Minoritenplatz an seine Mitarbeiter richtete: Ein Aufruf zur Solidarität für Österreich, wie sie nachher oft rar geworden ist im Lande.
P. S.: Die Rückseite des Buchumschlags zeigt ein Photo Ernst Fischers. Das Bild ist Dokument jener Tenue, deretwegen das Österreichische jenen Ruf bekam, der heute bilanzierbares Wirtschaftsgut in der Fremdenverkehrsindustrie ist. Die rechte Hand weit ausholend in ;iner ungemein noblen Geste, die linke seltsam gekrümmt, der Kopf tief schattiert; alles ein Monument jenes Österreich, in dem solche fypen noch gediehen.
„DAS ENDE EINER ILLUSION — ERINNERUNGEN 1945—1955.“ Von Ernst Fischer. 400 Seiten, Lei-%en, S 140.—. Verlag Fritz Molden, Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!