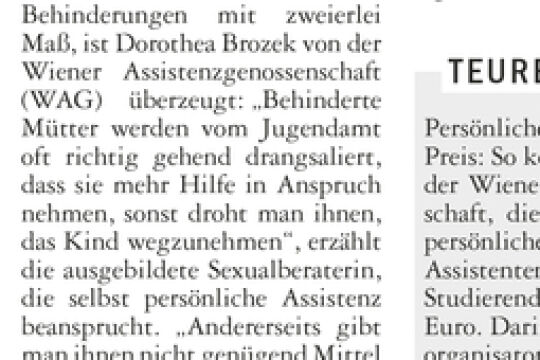Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Es geht ums Kindeswohl
Adoptivkinder, Pflegekinder: Noch immer sind sie mit gesellschaftlichem Makel behaftet. Eine Einstellungsänderung könnte viele Ungeborene das Leben erleben lassen.
Adoptivkinder, Pflegekinder: Noch immer sind sie mit gesellschaftlichem Makel behaftet. Eine Einstellungsänderung könnte viele Ungeborene das Leben erleben lassen.
Adoption und die Uberantwor-tung des Kindes an Pflegefamilien sind — als zwei mögliche Alternativen zur Abtreibung — wieder ins Gespräch gekommen.
Aber: Wer gibt schon sein eigenes Fleisch und Blut fremden Leuten? Das können, so ein gängiges Vorurteil, doch nur Mütter mit zweifelhaftem Ruf und Lebenswandel sein, die im Grunde die Bezeichnung Mutter gar nicht verdienen.
Dazu eine Bemerkung vorneweg: Die „Annahme an Kindesstatt" (wie das österreichische Adoptivrecht leicht diskriminierend definiert) oder auch die Ubergabe eines Kindes in Pflege birgt sicher jede Menge Probleme in sich. Aber beide stellen zumindest einen humanen Ausweg dar, der mithelfen kann, die hohen Abtreibungsraten zu senken.
Die Nachfrage nach Adoptivkindern ist jedenfalls höher, als tatsächlich Kinder zur Adoption freigegeben werden. In Wien müssen die rund 300 bei der Adoptionsstelle des Jugendamtes vorgemerkten potentiellen Adoptiveltern mindestens drei Jahre warten.
Paare, die zumeist aus biologischen Gründen ihren Wunsch nach einem Kind unerfüllt wissen, dürfen sich erst nach Uberwindung vieler bürokratischer Barrieren und gesellschaftlicher Vorurteile über ein „eigenes" Kind freuen.
Während gerade aus der Bundesrepublik Deutschland immer wieder Meldungen über einen schwunghaften Handel mit Ba-bies — vor allem aus der Dritten Welt — nach Österreich dringen, geht es hierzulande doch recht streng nach Vorschrift und ausschließlich über die Jugendämter.
In Österreich melden sich jene Mütter, die sich aus zumeist sozialen Gründen zur Freigabe ihres Kindes entschließen, in den zuständigen Adoptionsstellen der Jugendämter.
Die leibliche Mutter darf zwar noch den Vornamen des Kindes bestimmen (auch das Religionsbekenntnis) und hat bis zur gerichtlichen Bewilligung der Adoption (dauert sechs bis zwölf Monate) außerdem das Recht, das Kind zurückzuverlangen. Die Mutter erfährt aber bei der bei uns üblichen sogenannten Inkognito-Adoption weder Familiennamen noch Wohnsitz der neuen Eltern.
Welche psychischen Probleme für die leiblichen Mütter daraus oft erwachsen, kann nur erahnt werden. Deshalb favorisieren viele - kaum aber Adoptiveltern selbst — als Alternative zur Inkognito-Adoption die sogenannte offene Adoption. Dabei kann die leibliche Mutter weiterhin Kontakt zu ihrem Kind halten. Aber auch diese Form der Adoption ist — in erster Linie für die betroffenen Kinder — mit psychischen Belastungen verbunden.
Und im Zentrum aller Bemühungen muß das Kind stehen — reiht die Leiterin der Adoptionsstelle der Stadt Wien, Marianne Hennrich, alle anderen Bedürfnisse hinternach.
An das geltende Adoptionsrecht hat Hennrich vor allem einen Wunsch: daß endlich auch in Österreich die Volladoption im Gesetz verankert werde (wie etwa in der Bundesrepublik). Volladoption bedeutet: Das Adoptivkind gilt nicht nur mit den Adoptiveltern als verwandt, sondern auch mit den Großeltern und ist darüber hinaus voll erbberechtigt. Und für Adoptivmütter soll Karenzschutz wie für leibliche Mütter gelten.
Meist für eine Art Vorstufe zu einer späteren Adoption hält man in der Öffentlichkeit die Aufnahme eines nichtleiblichen Kindes in einer Pflegefamilie.
Während bei einer Adoption die neuen Eltern allein für das Kind zu sorgen haben, dürfen Pflegeeltern mit rund 2500 Schilling je Pflegekind und Monat als Unterstützung vom Jugendamt rechnen. Aber Geschäft wird daraus in keinem Fall. Viel eher schon haben Pflegeeltern — zieht man die Zuwendung und die Opfer, die sie erbringen, in Betracht - rechtlich gesehen eine untergeordnete Stellung für das weitere Schicksal des Kindes.
Der Verein Initiative Pflegefamilien fordert daher die volle Parteistellung der Pflegeeltern in gerichtlichen Verfahren, das Recht auf Vertretung des Pflegekindes für die Dauer der Pflege, aber auch Einspruchsrecht gegenüber Rückforderungen der leiblichen Eltern, wenn ihrer zumeist intimeren Kenntnis der Verhältnisse der rückfordernden Eltern nach das Wohl des Kindes nicht gewährleistet ist.
Uberhaupt, so Elisabeth Lutter von der Initiative Pflegefamilien, soll ein Anwalt des Kindes gesetzlich verankert werden. Zwar ist das Kind derzeit voller Rechtsträger im Vermögensbereich, über sein weiteres Leben, entweder bei den leiblichen Eltern oder in der Pflegefamilie, darf es nicht mitbestimmen.
Ein Ombudsmann, der die Rechte des Kindes in dieser Hinsicht vertritt, könnte auch verhindern, daß den meist überlasteten Beamten der Jugendämter nicht vorhandene, aber für das Wohl des Kindes notwendige Familienverhältnisse vorgegaukelt werden.
Für diejenigen Mütter, die sich nur vorübergehend außerstande sehen, ordentlich für ihr Kind zu sorgen, bietet sich kurzfristig, bis zur Sanierung der eigenen Verhältnisse, die Pflegefamilie jedenfalls als die menschlichste Lösung an.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!