
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Europa in nuce
Am 6. Mai 1976, als in ganz Mitteleuropa die Erde bebte, hat das kleine Friaul nicht nur Menschenleben eingebüßt, sondern auch eine Menge seiner Kunstschätze und Kulturgüter - Schätze und Güter, die, wie ein italienischer Korrespondent damals sagte, niemand in Italien gekannt zu haben schien. Und, wie wir hinzufügen müssen, niemand in Europa. Man war da doch immer nur eilig durchgefahren, hinunter nach Rom, nach Venedig zumindest, zum Strand von Caorle, und auch nach Triest, nach Rijeka, nach Split, oder umgekehrt über die Alpen gen Norden. Verweilt sind immer nur wenige dort, so der österreichische Kunstschriftsteller und Kritiker Kristian Sotriffer, der knapp vor dem Untergang jene Landschaft mit ihren Menschen und Bauten noch einmal in Bildern und Worten festgehalten hat, nach ähnlichen Büchern über Istrien und über Slowenien.
Diese Trilogie beschreibt einen Raum in der Form eines Dreiecks, markiert von den Eckpunkten Tol- mezzo links oben, Märburg (Maribor) rechts oben, Pula unten, mit dem darin eingeschlossenen kleineren Dreieck Udine, Laibach (Ljubljana), Triest. Und das ist jener in Europa einzigartige Raum, in dem die drei großen Rassen und Kulturen - die romanische, die slawische, die germanische - einander überlappen, ineinander verzahnt sind, miteinander verschmelzen; zwar zerschnitten von Grenzen der Staaten und Länder, Regionen, Provinzen, aber doch eins und einig just durch seine Vielfalt: europäisches Schicksal in nuce.
Wohl gab es historisch Gemeinsames zwischen Friaul und Istrien und Slowenien, bis zur Einheit im staats- und völkerrechtlichen Sinne im Anfang unseres Jahrtausends. Was die drei Landschaften aber dergestalt einigt, daß sie sich merkbar von ihren Nachbarn abheben, ist der ständige Wechsel von He rrschaft und Einfluß in diesöii Rätüfi, mit der daraus resultierenden Mischkultur.
Uber illyrisch-keltischem Untergrund hat Rom seine Weltordnung etabliert, woran Namen wie Cilli (Celje - Claudia Celeia) und Steine wie der Augustus-Tempel zu Pula erinnern. Von Aquileia aus begann schon früh das Christentum zu strahlen, wie anderseits Byzanz hereinwirkte. Zeitweise haben die Langobarden geherrscht, später dann haben die Türken gehaust. Selir stark hat Venedig, kaum weniger stark hat Habsburg geprägt. Rijeka hat Tersatica geheißen, im Wandel der Zeiten dann Vitopolis, Fanum Sancti Viti ad Flumen, St. Veit am Pflaumb, Reka und Fiume.
Die Grafschaft Mitterburg (in Istrien) hat innerhalb von knapp vier Jahrhunderten einundzwanzig Mal ihren Herrn gewechselt. Venzone war nacheinander der Rechtsprechung der Herzöge von Kärnten, der Grafen von Görz, der Patriarchen von Aquileia, der Herzöge von Österreich und dann wieder der Patriarchen unterworfen … Im Laibacher Bürgertum des 17. Jahrhunderts traf man auch Preußen, Franzosen, Ungarn, Dänen; das zeitweise entvölkerte Istrien wurde auch mit Albanern, Griechen und Zyprioten besiedelt, und vor gut hundert Jahren zählte ein Forscher auf der Halbinsel, die kaum größer ist als Vorarlberg, „dreizehn ethnographische Nuancen”.
Und sie alle, alle, alle, die da gekommen und gegangen sind, haben ihre Spuren hinterlassen in der Sprache, im Brauchtum, in der Religion, in der Kunst, in der Architektur, in der Landwirtschaft, in der Industrie, und in den Menschen selber, bis in die Physiognomien. Die Friulaner sind keine Italiener im üblichen Sinn; die Slowenen unterscheiden sich deutlich von allen anderen Südslawen, ja von den Slawen überhaupt; und was in Istrien wohnt, scheint überall und nirgends hinzugehören, außer eben nach Istrien - wie auch das Furlanische nicht ein italienischer Dialekt, sondern eine eigene Sprache ist; wie das Slowenische wenig mit dem Serbokratischen, eher noch etwas mit dem Alttschechischen gemein hat; und wie in Istrien gleich mehrere Idiome einander verfärben.
Die ungemein zahlreichen Lehnwörter in sämtlichen im Friaul, in Slowenien und in Istrien gesprochenen Sprachen lassen tiefe Herkünfte und intensive Querverbindungen ahnen; bezeugen den Austausch.
Austauschbarkeit ist überhaupt ein Charakteristikum jener Misch- und Pufferzone zwischen den Kulturen: wenn etwa in Ljubljana wie in Porde- none einzelne Stadtteile an eine norditalienische, andere an eine süddeutsche Stadt erinnern. Die kleine drei- schiffige Basilika Sta. Maria delle Grazie von Grado könnte ebensogut im slowenischen Piran oder im istrischen Rovinj stehen. Steinerne Mäuerchen begrenzen die Felder, unabhängig davon, welchen Paß der säende und erntende Landmann daheim in der Lade hat Und zumindest die urtümlichen Speisen und Getränke tragen hüben und drüben die gleiche Bezeichnung.
Austausch weit über die Zeiten und Räume hinaus bekundet vor allem die Architektur: Die Kanzel der heutigen Pfarrkirche von Grado weist, nach Sotriffer, „ein Kompilat von Stilformen auf, die vom 4. bis zum 13. Jahrhundert reichen - von spätrömischen Spolien bis zu den gotisch-maurischen Formen des Baldachins. Vermutlich handelt es sich um ein zu einem bestimmten Zeitpunkt um 1200 aus verschiedenen Bauteilen zusammenge- setzes Werk.” Und gar von einem „internationalen Stil” spricht die Kunstr geschichte im Hinblick auf den „Tem- pietto Langobardo” in Cividale, da antike, orientalische und byzantinische Motive darin verarbeitet sind, vielleicht sogar von nichtlangobardischen Künstlern.
Bei aller Internationalität - oder besser noch: Supranationalität-des in Rede stehenden Raumes haben aber just dort sich zahlreiche Inseln spezifischer Tradition erhalten. Da waren, im Südosten Sloweniens, fast 600 Jahre lang die Gottscheer, mit einem Deutsch, das sich aus mehreren Mundarten gebildet hatte. Da gibt es heute noch, in der Einöde halbwegs zwischen Triest und Rijeka, die Tschitschen, zur Zeit der Türkenkriege eingewanderte Rumänen, die sich walachisch mit „Ciccia” (Vetter) anred en.
Angeblich Russen, in Wahrheit vermutlich slawische Einwanderer aus der Langobardenzeit, waren die Ahnen derer, die im nordfriulanischen Resiatal einen archaischen slawischen Dialekt sprechen, das Resische, das weder mit dem Slowenischen noch, trotz mancher Vermischung, mit dem Furlanischen direkt verwandt ist. Gleichfalls im Norden Friauls gibt es einen Ort wo der Schinken nicht luftgetrocknet, sondern geräuchert wird, wie in Tirol, von wo aus Zahre (heute Sauris) vor 700 Jahren gegründet worden ist. Und im südistrischen Beile etwa hat sich ein völlig eigener romanischer Dialket bis heute noch nicht verloren. Auf die „Bedeutung (solch) kleinster Zellen für das Entstehen weiterer, von spezifischen Merkmalen und Besonderheiten getragener Umräume mit ihren eigenen Gerüchen, Formen, Zusammenschlüssen und Beziehungen untereinander” weist Sotriffer ausdrücklich hin.
Dies Bewahren im Wandel hat zweifellos tiefe Gründe. Macht war dort nämlich nie konzentriert, mit Ausnahme höchstens der kirchlichen, religiösen in Aquileia, dessen Patriarch der ranghöchste Priester nach dem Papste war. So haben die kleinen und winzigen Volksgruppen mehr ans Verteidigen als ans Erobern gedacht, sich, viel mehr als im Herrschen, im Dulden geübt, was auch spürbar ist in der Frömmigkeit wie in der Gastfreundschaft: in der Bescheidung ins eigene Schicksal wie in der Aufnahmsbereitschaft für Fremdes.
Und eben deswegen sind dort, wie kaum sonstwo, die menschlichen Dimensionen erhalten geblieben, zum Beispiel im „Bauen parallel zur Natur”, wofür die drei Bücher vielfältig zeugen: mit der barocken Kirche von Sladka gora im slowenischen Hügelland, „klassischer Ausdruck einer in die Landschaft eingebundenen Architektur”; mit der kuschelig in den bewaldeten Talhang gebetteten winzigen Ortschaft bei Attimis in Friaul, ein im Geiste der urbs nach außen geschlossener, innen offener Mikrokosmos; mit istrischen Orten wie Buje und Mo- tovun, die auf den Bergkegeln sitzen wie weibliche Brustknospen.
Menschliche Dimension bleibt auch im Kopieren: Wenn Udine oder Köper den Markusplatz nachbilden, tun sie das doch nur in Relation zu der eigenen Stadt. Gewiß kann der hier von uns aus überblickte Raum auch mit Großem, mit sozusagen Sensationellem aufwarten: vom römischen Amphitheater zu Pula über die Adelsberger Grotten bis zu dem inwendig völlig bemalten Wehrkirchlein von Hra- stovlje und den Mosaiken im Dom von Aquileia; viel intensiver jedoch wirkt die ganze Gegend dort durch ihre Fülle vergleichsweise kleinerer Zeugnisse aller Epochen: Durch die fortwährende Begegnung mit diesen Zeugnissen „wird Geschichte nahezu physisch erfahrbar”, wenn etwa die heute noch in Handarbeit hergestellten Gefäße von Filovci verblüffend jenen ähneln, die von den Illyrern gefertigt und bei Prekomuije massenweise gefunden worden sind; oder wenn wir in der architektonischen Urform der istrischen Feldunterstände, der „Casi- te”, das Modell sogar noch des Camping-Zeltes erkennen.
Also erweist sich dieser „kulturell fündige Mischbereich” zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd als ein - wie Ippolito Nievo im Hinblick allerdings nur auf Friaul formuliert hat - „kleines Kompendium der Erde” und jedenfalls, um mit Kristian Sotriffer zu schließen, als eine „Heimat für Menschen mit Sehnsucht”; für Menschen, die im technisch-zivilisatorischen Fortschrittsgedränge den Sinn für die „Poesie des Einfachen” noch nicht verloren haben; für Menschen endlich, die das bis zur völligen Abstraktion zerschwätzte Europa noch einmal, ehe es untergeht, sinnlich-geistig erfahren wollen.
Kristian Sotriffer: Istrien und der Karst. 158 Seiten, 10 Farb- und 84 Schwarzweißbilder, öS 248,-. - Slowenien. 164 Seiten, 12 Farb- und 92
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



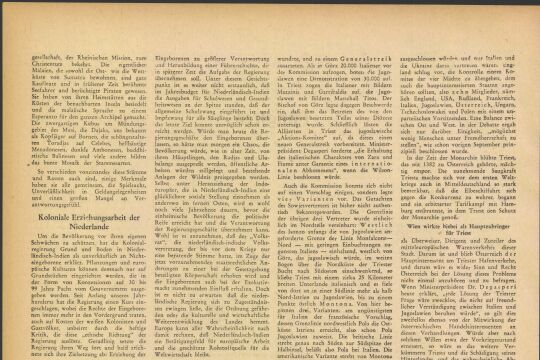




















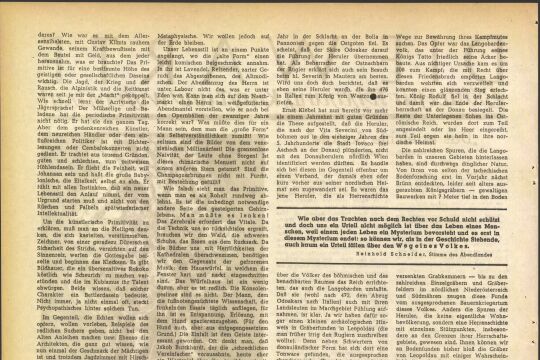





















































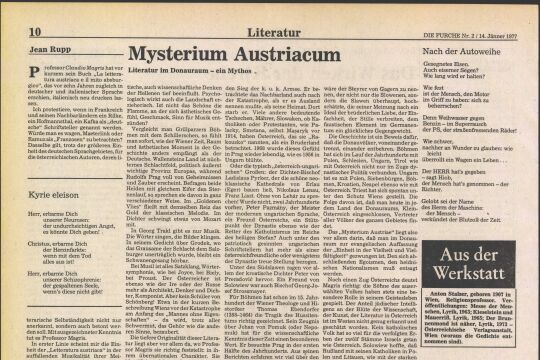




















.png)
