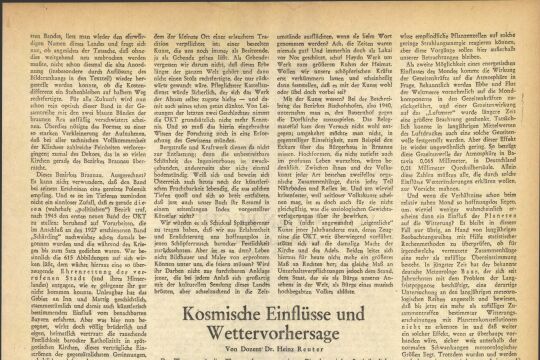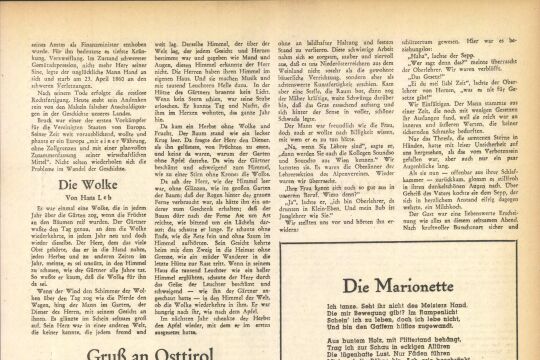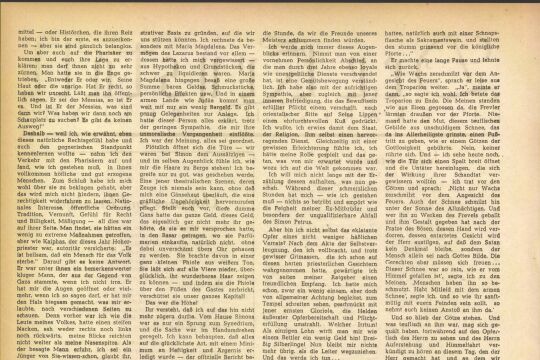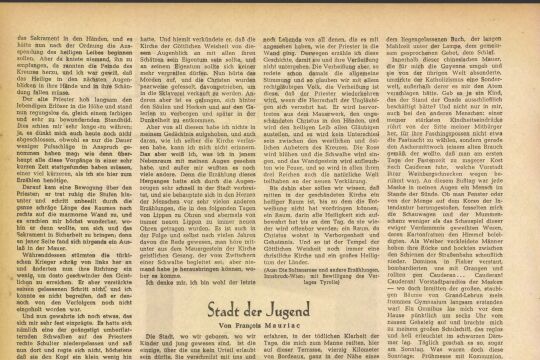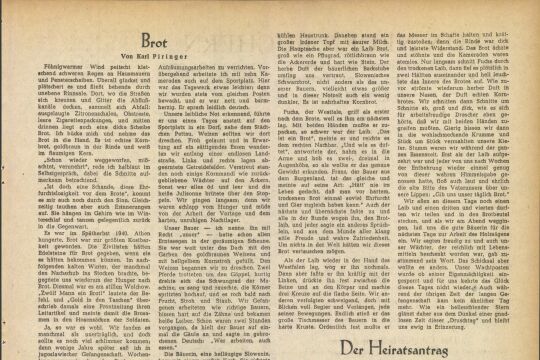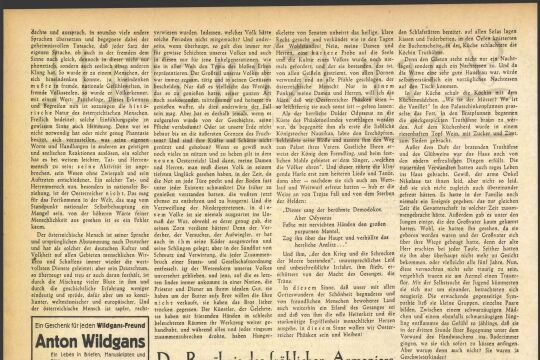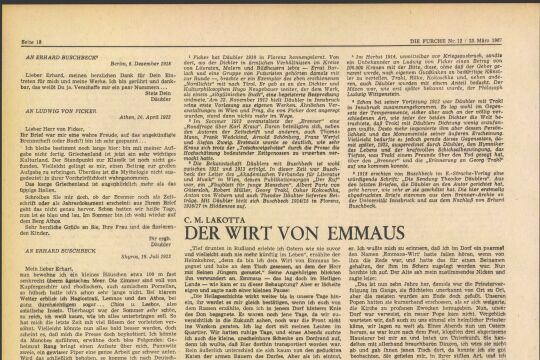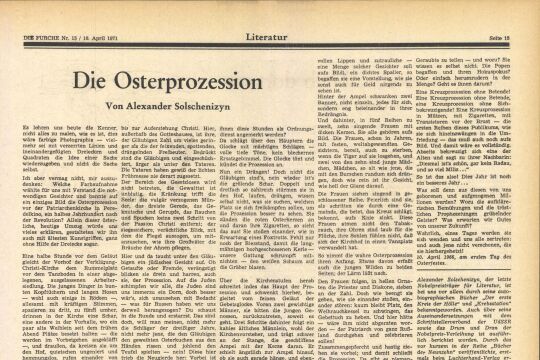Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Fest in der Provence
Mein Vater hatte in seinem ganzen Leben bloß drei Bücher gelesen, nämlich das Neue Testament, Die Nachfolge Christi von Thomas a Kempis und den Don Quijote, der ihn an seinen Feldzug in Spanien erinnerte und ihm während der Regenzeit Zerstreuung bot.
„Zu meiner Zeit gab es nur wenige Schulen“, erzählte er uns. „Mir hat ein armer Mann, der einmal in der Woche auf die Höfe kam, das Alphabet beigebracht.“
Nach Brauch und Sitte der Familienväter schrieb er sonntags nach der Vesper seine geschäftlichen Angelegenheiten, Rechnungen und Ausgaben, mitsamt seinen Anmerkungen in eine große Agenda, die Cartabeou genannt wurde. 4
Immer war er zufrieden, wie das Wetter auch sein mochte, und wenn er die Leute manchmal über den stürmischen Wind oder den sintflutartigen Regen klagen hörte, sagte er: „Ihr guten Leutchen, der da oben weiß recht gut, was er tut und was uns frommt. Wie wäre es denn, wenn der große Wind nicht käme, der die Provence aus der Erstarrung weckt... wer würde dann den Nebel und Dunst über unseren Mooren zerstreuen? Und hätten wir die heftigen Regengüsse nicht, wie würden dann die Zisternen, Brunnen und Bäche gespeist? Ein jedes Ding ist notwendig, meine lieben Kinder.“
Mochte er auch am Wegrand ein Stück Holz auflesen, um es zum Herd zu tragen, mochte er sich auch im bescheidenen Alltag mit Gemüse und Schwarzbrot begnügen und sogar beim Festmahl stets mäßig bleiben und seinen Wein mit Wasser mischen, immer war sein Tisch gedeckt, seine Hand und sein Beutel offen für jeden Armen, der des Weges kam. Wenn von einem Menschen gesprochen wurde, lautete seine erste Frage, ob er ein guter Arbeiter sei, und wurde sie bejaht, so sagte er: „Dann ist er ein braver Mann, und ich bin sein Freund.“
Für meinen Vater, der an den alten Bräuchen festhielt, war der Weihnachtsabend das große Fest. An diesem Tage spannten die Knechte die Ackergäule früher aus als sonst; meine Mutter gab jedem einen in Ol gebackenen, in eine Serviette eingeschlagenen schönen Fladen, eine Scheibe Mandelnougat, eine Handvoll Feigen, selbstgemachten Schafskäse, Sellerie für Salat und eine Flasche Wein, der im Herbst gekeltert worden war.
Die Dienstleute begaben sich dahin und dorthin, ein jeder zu seinem Wohnort, um im eigenen
Haus das Weihnachtsscheit anzuzünden. Auf unserem Hof blieben nur die armen Teufel zurück, die keine Familie hatten. Mitunter kamen gegen Abend noch Verwandte, etwa ein alter Junggeselle. „Fröhliche Weihnachten, Gevatter!“ riefen sie. „Wir sind gekommen, um das Weihnachtsscheit mit euch zusammen anzuzünden.“
Dann zogen wir gemeinsam frohgemut aus, das Weihnachtsscheit zu holen; es mußte - so wollte es der Brauch - der Stamm eines Obstbaumes sein. Wir trugen es in einer Reihe zum Hof, der Älteste am einen Ende, ich, der Jüngste, am andern. Dreimal machten wir in der Küche mit dem Baumstamm die Runde. Hierauf goß mein Vater vor dem Kamin feierlich ein Glas Wein über das Weihnachtsscheit. Dann wurde es auf die großen Feuerblöcke gelegt, und sobald die erste Flamme emporzüngelte, bekreuzigte sich mein Vater und sagte: „Heiliges Scheit, nähre das Feuer!“
Danach setzten wir uns alle zu Tisch.
Oh, dieses heilige Mahl, wahrhaftig heilig, da die ganze Familie friedlich und glücklich um den Tisch saß. Statt der römischen Lampe, die an einem dicken Schüfrohr hing und uns das ganze Jahr hindurch mit ihrem Ol Helligkeit gab, strahlten an diesem Abend drei Kerzen auf dem Tisch; wenn ihr Docht sich zum einen oder anderen hinneigte, galt es als ein schlimmes Vorzeichen. An beiden Tischenden grünten in einem Teller die Weizenkörner, die wir am Tag der heiligen Barbara, am 4. Dezember, zum Keimen in Wasser gelegt hatten.
Feierlich erschienen auf dem weißen Tischtuch nacheinander die Weihnachtsgerichte: Schnek-ken, die jeder mit einem langen Nagel aus dem Gehäuse hervorholte; gebackener Dorsch und Meeräsche mit Oliven; Artischok-ken und Sellerie mit Pfeffer; und danach alle die Süßigkeiten, die es nur an diesem Tage gab: in öl ge-backene, flache Kuchen, getrocknete Weinbeeren, Mandelnougat, Bratäpfel und vor allem das große Weihnachtsbrot, von dem nach frommem Brauch nicht gegessen wurde, bevor der erste Arme, der vorbeikam, ein Viertel erhalten hatte.
Bis zur Christmette war der Abend lang, und man erzählte sich am Feuer viel von den Vorfahren und pries ihre Taten. Allmählich, doch wie gern, kam mein Vater dann auf seine Erlebnisse in Spanien zu sprechen und auf die Belagerung von Figueras.
Am Neujahrstag kamen viele Kinder, alte Leute, Frauen und Mädchen, die uns schon früh am Morgen begrüßten:
„Wir wünschen euch allen ein gutes Jahr, Meister und Meisterin, mit so viel Gutem, wie Gott es will.“
„Auch wir wünschen euch ein gutes Jahr“, antworteten meine Eltern und überreichten jedem als Neujahrsgeschenk zwei lange Brote und dicke, runde Laibe.
Bei uns war es wie auch in manchen andern Häusern Brauch, am Neujahrstag zwei Backöfen voll Brot an die Armen des Dorfes zu verteilen:
„Und sollte ich hundert Jahre leben, so will ich hundert Jahre backen, will hundert Jahre Brot an die Armen verteilen.“
Diese Worte kehrten jeden Abend in dem Gebet wieder, das mein Vater vor dem Schlafengehen sprach. Und bei seiner Beerdigung konnten die Trauergäste sagen:
„So viele Brote er uns gab, so viele Engel mögen ihn begleiten. Amen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!