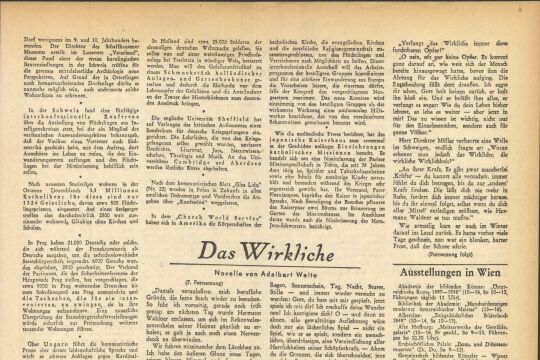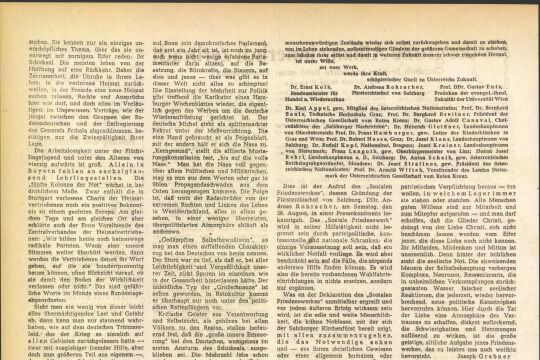Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Friedrich Torberg: Redepflicht erfüllt
Flaubert, von einem kürzlich verstorbenen Freunde redend, schreibt an einen der noch lebenden, sein Herz sei nur mehr ein einziger großer Friedhof. So fühle auch ich schon, seit sie schier reihenweise wegsterben: nächste und nahe Verwandte sowie die Meister und die Kumpane, die Partner und die Vertrauten in Kunst und Leben: die Mutter, dann Reinhard Federmann, plötzlich Kurt Moldovan, jüngst mein liebster Cousin, und der Botschafter Hartl, und William S. Schlamm, dann Erich Landgrebe - nein, ich mag nicht mehr zählen! - und eben jetzt, am 10. November 1979, Friedrich Torberg.
Fast dreißig Jahre lang habe ich mich seines Wohlwollens - dieses ganz wörtlich genommen - erfreuen dürfen: von unserer ersten Begegnung (im Cafä „Herrenhof“) bis zu seiner letzten Karte (aus Israel) hat er mir wirklich wohl wollen: hat „mein Bestes gewollt“, wie man zu sagen pflegt. Er war vorhanden für mich (auch für mich) mit Ermunterung und Ermutigung, und zwar dergestalt, daß er vorhanden war als die leibhaftige Ermunterung und Ermutigung selbst. Und jetzt auf einmal fehlt das; und das, was fehlt, ist etwas von meinem eigenen Leben.
Doch in die sozusagen physikalische Leere, die ein Mensch mit seinem Hinscheiden in uns aufreißt, tritt immer gleich ein Begriff; und zwar immer derjenige, an dem wir einerseits zwar den Verlust erst so richtig ermessen, anderseits aber auch das erst so richtig erkennen, was der Verstorbene über das physische Dasein und über das physische Werk, ob nun Buch oder Haus oder Kinder, über all das dereinst, ach wie bald, Vergangne hinaus hinterläßt: was er über sein individuell beschlossenes Leben hinaus uns bedeutet, nämlich, im Ur- sinn, wohin er deutet, und was er uns - wir folgen noch immer der Etymologie - damit verständlich macht Diesen Fingerzeig nehmen wir freilich stets dann erst zweifelsfrei wahr, wenn ein Leben im Tod sich gerün- det; indessen: in eben dem Fingerzeig lebt der Verstorbene wirklich, weil wirkend, weiter: in uns, den über den Tod zwar trauernd, doch durch diesen Tod auch verändert Hinterbliebenen. Art und Maß der in uns stattgehabten Veränderung aber erfahren wir eben aus jenem Begriff, der den Toten hinfort vertritt, ja im wörtlichsten Sinne repräsentiert: ihn uns ständig vergegenwärtigt; aus jenem Begriff, der durchaus nicht ein sentimentales Grabmal, sondern ein „monumentum“ wahrlich „aere per- ennius“ ist, da ja nichts, was an Geist je in die Welt gesetzt ward, aus dieser je wieder verschwindet (woraus, en passant, erhellt, warum es heilsam ist, Gutes, und tödlich, Böses zu dichten und trachten).
Nun: was mir, auf die Radiomeldung vom Tode Friedrich Torbergs hin, in den momentan entleerten Sinn trat, das war der Begriff der Pflicht, und zwar wörtlich mit Goethe: „der große Begriff der Pflicht“ - und zugleich, wie A. P. Gütersloh diesen Begriff für den Schriftsteller konkretisiert hat: „Es darf ein Mensch, der des Wortes mächtig ist, keine Lage schweigend verlassen: dies fiele zu leicht, dies gälte nicht vor dem Gotte.“ Und wenn man spricht - so fährt Gütersloh fort -, dann komme es nicht darauf an, „gerade von diesem da und in eben diesem Augenblicke verstanden zu werden, sondern einzig darauf, zu sagen, was nur jetzt oder nie mehr, und nur von uns und von keinem ändern, gesagt werden kann“.
Dieser „Redepflicht“ hat Friedrich Torberg gehorsamt, und zwar keineswegs nur unter diesem Titel, mit dem er anno 1933, als erst Vierundzwanzigjähriger, die deutsche literarische Welt gegen Hitler zur Raison, also zur Vernunft zu bringen gehofft und dabei, immerhin, sich selber den Wappenspruch gedichtet hat. Wie vor den braunen, so ist er später auch vor den roten Herrenmenschen nicht verstummt; und selbst das Zeitungsdeutsch konnte ihm nie die Rede verschlagen. Der altklugen Dummheit der Sprechenden hat er die Altersweisheit der Sprache entgegengesetzt - er hat die Welt beim Wort genommen, und siehe, da ward sie zum Witz!
Nein: sprachlos, mehr als die Redensart meint, war er nie; im Gegenteil: immer ganz Wort, nämlich Antwort auf alles Begegnende: auf das Erhabene wie auf das Komische, auf die Entartung wie auf das Genie, auf ein Bibelwort wie auf ein Fußballmatch, auf eine Landschaft wie auf einen Menschen. Auf Sprache, auf Spucke. Auf Weh, auf Wehwehchen. Nein: er hat „keine Lage schweigend verlassen“: nicht Schule, nicht Sport, nicht Kaffeehaus, nicht Redaktion; nicht Erfolg, nicht Flucht, nicht Ehrung, nicht Schmähung; und am wenigsten die eines jüdischen Dichters in deutscher Zunge. Und hier, an dem Punkte, sei erst einmal schweigend verweilt wie am Grab.
Aber horch! Was raschelt da im Gebüsch, im Gezweig? Naht etwa jemand, der Geld bei der CIA kassiert hat, um dem Kollegen ein „Haltet den Dieb!“ noch flugs nachzurufen, also den Grabstein zum Eckstein schändend; Ach nein! Es rauscht im Blätterwald nur von dem hörbaren Aufatmen, das durch die so jäh enthemmte Kulturwelt Österreichs, durch diese literarische Promille- und Prozentwelt geht: „Brechtseidank, nun sind wir ihn endlich.los!“ Klammheimlich triumphiert so der Fortschritt im Fußtritt. Der giftige Ärger über die (sowieso schier ostentativ verspätete) Zuerkennung des Großen Staatspreises jedenfalls ist der satten Befriedigung gewichen darüber, daß jenem Fortschritt, der ja überhaupt bloß in der asyntaktischen Aneinanderreihung verbaler Fußtritte sich bewegt, nun eine Barrikade weniger im Wege steht; jenem Fortschritt, dem ich allhier das Motto schreibe: „Im Anfang war das Wort, und am Ende ist das Geschwätz.“
Der Umgang mit geistigen Gütern wird also noch laxer und noch frivoler werden, als er schon ist: weil hinfort noch geringer besorgt, durch Exempel erprobt, vom besseren Beispiel gottbehüte gar beschämt zu werden. Mit kleinerem Mut und mit größerem Mutwillen wird man sich noch mehr herausnehmen als bisher: noch mehr Freiheiten sich so nehmen, als ob diese die Ursachen seien und Freiheit die Wirkung, statt umgekehrt; Freiheiten, als ob diese ein apriorisches Recht und nicht als Lizenzen der Freiheit erst rechtens wären; Freiheiten also, die in dem Kurzschluß gesetzloser Freiheit ja doch nur die Zwänge einer paranoiden, einer so infantilen wie hybriden Geistes- und Seelenverfassung, kurz: die Symptome einer fundamentalen Störung im religiösen Haushalt des Menschen sind; Freiheiten, welche somit nie zu Freiheit, sondern zu demjenigen Phänomen sich potenzieren, das von Tacitus als „Falsa species liberta- tis“ agnosziert wird. Zurück!
Ja, zurück zu Torberg, der angekämpft, angelebt hat gegen jeden falschen Schein von Freiheit, und zwar angekämpft hat, um zu sehn, was dahintersteckt; und es war überall das, was Tacitus einstens ge- sehn: die malignitas - nicht eigentlich das Böse, wie wir’s gemeinhin denken, sondern das grundsätzliche Übelwollen. Und er hat angekämpft gegen die malignitas als ein wahrer (ein letzter?) Liberaler: verpflichtet nicht nur der libertas, sondern zuerst schon dem innersten Wesen der Freiheit: der liberalitas - was nicht bloß so viel wie Güte bedeutet, sondern, als positives Analogon zur malignitas, das grundsätzliche Wohlwollen.
Er hat - und ob! - gekämpft; doch aus dieser Konstitution heraus gegen irgend etwas nur dann, wenn dies das Mittel war, für irgend etwas zu kämpfen: nie eigentlich, um zu vernichten, sondern immer, um zu helfen, zu retten: um, mit Lichtenberg, „denen von unserer Seite Mut und Stärke zu geben“. Aus diesem Grunde, eben dem des grundsätzlichen Wohlwollens, sind sogar die Polemiken Torbergs aktuelle geblieben.
Und - um dort anzuknüpfen, wo wir gestört worden sind -, und nicht seine jüdische Herkunft mitsamt dem Bekenntnis zu dieser, sondern erst jene liberalitas hat ihm ermöglicht, dem neuesten ewigen Schicksal der Judenheit jetzt schon, bei noch nicht völlig entlüfteten Gaskammern, lyrisch und episch nachzuspüren; nur als ein grundsätzlich Wohlwollender war er befähigt, statt zu richten zu dichten. Freilich: wie schwer grade diese Redepflicht ihm, dem vereinsamten Überrest einer einst weit verzweigten Familie, gefallen sein mag, darf wohl nur ein Jude zu ermessen versuchen - wir anderen haben, wie auch immer unser literaturkritisches Urteil ausfalle, vor dieser ethischen Hochleistung einfach den Hut zu ziehen.
Aber freuen dürfen wir uns auch - wie ja auch Torberg selber sich gefreut hat: darüber, daß ihm die Zeit und die Kraft vergönnt gewesen, zu sagen, was wirklich nur er wie kein andrer hat sagen können. Den „Schüler Gerber“ oder die „Mannschaft“ etwa, „die hätte auch ein anderer schreiben können; dazu hat man mich nicht unbedingt gebraucht“. Jedoch, fügt Torberg hinzu, „für die ,Tante Jolesch1 hat man mich unbedingt gebraucht“ - überraschend wohl nur für jene, die als ein Witz-Büchel nehmen, was als eine den Tränen abgetrotzte heitere Ehrenrettung des ausgetilgten altösterreichischen Judentums uns gegeben ward.
Vielleicht überhaupt erst vor diesem scheinbar luftigen, scheinbar lustigen Hintergrund sehn wir mit schneidender Schärfe die jüdische Problematik, wie sie in frühem Erzählwerken offengelegt, ohne Selbstschonung bloßgelegt worden: in „Mein ist die Rache“ und in „Hier bin ich, mein Vater“ - beide noch vom akuten Schmerz inspiriert -, und dann, das chronische Leiden sondierend, im „Süßkind von Trimberg“.
Daher: Pardon, Friedrich Torberg, nicht bloß als den wortgewandten Testamentsvollstrecker jener Tante, sondern, viel umfassender noch, als einen sprachgewaltigen Kronzeugen jüdischen Selbstverständnisses haben wir, grade wir Eichmann-Neffen, Sie gebraucht! Das Licht, das Sie unter den Scheffel gestellt haben, scheint in der Finsternis.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!