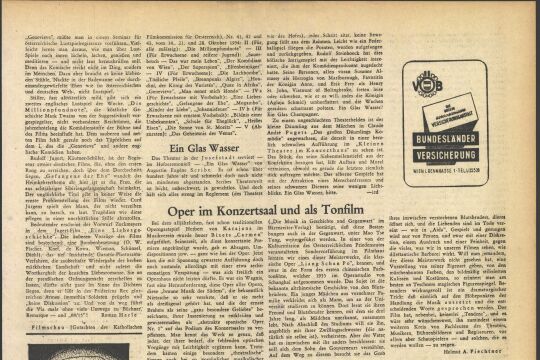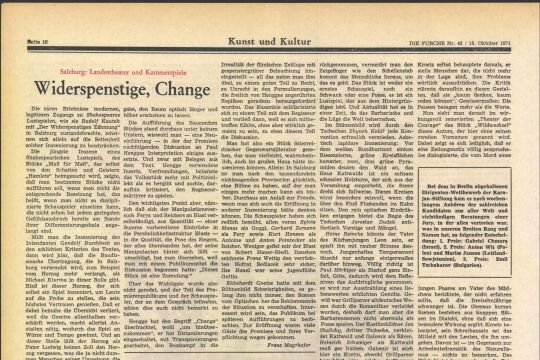Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gemetzel als Weltordnung, Grazer Fehlschläge
Im Grazer Schauspielhaus zeigte sich an Hand einer Gastinszenierung des „Macbeth“ durch Günther Tabor, wie „anwendbar“ Klassiker sein können. Shakespeare läuft in besonderem Maße Gefahr, Opfer aller möglichen Deutungen und Mißdeutungen zu werden. Die Interpretation Günther Tabors ist in mancher Hinsicht gewiß schlüssig, kann aber, weil sie Eindeutigkeit und Fixierung auf ein vorgefaßtes Schema anstrebt, nicht ohne Kor- rigentien und akzentverschiebende Eingriffe auskommen. Tabors Konzept basiert hauptsächlich auf der Shakespeare-Interpretation durch Jan Kott, die den „Macbeth“ als alptraumhafte Vision einer absurden Welt voll blutiger, nie endenwollender Gewalttaten sieht und das mörderische Ehepaar seine Untat als sexuelle Ersatzhandlung begehen läßt. Die Auslegung des Dramas durch Tabor, daß nämlich jeder Mächtige früher oder später seinen Macbeth, das heißt: seinen eigenen Schlächter findet und dadurch die Gewalt endlos perpetuiert wird, hat auch Ionesoo seinem „Macbett“ zugrundegelegt. Nur haben Io- nesco und auch der Ostdeutsche Heiner Müller den originalen „Macbeth“ umgeschrieben, um ihm die von ihnen gewünschte Eindeutigkeit zu unterlegen. Tabor jedoch führt in seiner Grazer Inszenierung - die übrigens ohne Artauds „Theätre de cruautė“ nicht denkbar wäre - kein neues Stück vor, sondern „verändert“ das alte: packend zwar, aber doch eigenmächtig und so entscheidend, daß eine dem Original fremde Tendenz sichtbar wird, die dem Lauf der Weltgeschichte aber schon nicht mehr das geringste Fünkchen Hoffnung läßt.
Die Grazer Aufführung, in der Walther Reyer kein sonderlich ruhmvolles Debüt als Macbeth gab, war über die eben erwähnten prinzipiellen Fragen der Interpretationsfreiheit hinaus auch noch aus einem anderen Grund bemerkenswert: zum ersten Mal wurde „Macbeth“ auf einer Bühne in der Übersetzung Theodor von Zeyneks gespielt. Der Rezeption des Textes hat dies sicherlich nicht geschadet, denn die deutsche Version Zeyneks, der einst Generalstabschef einer österreichischen Armee war (er starb 1948), ist besser, sprechbar und verständlicher als die üppig-fließenden, aber oft genug auch unbestimmt-zimperlichen Verse der Dorothea Tieck. Daß die Hexen bei Zeynek als nornenähnliche Schicksalsschwestem auftreten, ist zwar ein Verstoß gegen das Original, tut jedoch der präzisen Schärfe und größeren Schlagkraft seiner Verdeutschung keinen Abbruch.
An sich erfreulich, daß die Grazer Oper nach jahrelanger Pause sich wieder des Opemkomponisten Janäöek erinnert und ein Werk auffährt, das in Graz noch nicht gegeben wurde: „Das schlaue Füchslein.“ Doppelt zu begrüßen, daß für das schwierige Werk ein kompetentes Team engagiert wurde: der Regisseur Vaclav Veznik ist Oberspielleiter der Brünner Oper und ein wirklicher Kenner der Janäcek- Tradition, die Bühnenbüdentwürfe stammen vom jugoslawischen Maler Ivan Lakovič, Dirigent Miro Belama- rič aus Zagreb ist ebenfalls mit der Brünner Janäcek-Pflege aufs beste vertraut. Somit wäre scheinbar alles getan worden, um eine authentische Interpretation dieser mährischen Naturoper sicherzustellen.
Daß der Erfolg sich dennoch nicht einstellte, hat zwei Ursachen. Die Geschichte vom Füchslein Schlaukopf, seiner Liebe, seinem Tod und seiner Wiedergeburt ist bekanntlich voller naturmystischer Anspielungen, die sich ins Kosmische weiten. Zwar versuchten die bezaubernd naiven Dekorationen in ihrem ständig wechselnden Ineinanderfließen ein Waldweben im Kreislauf von Werden und Vergehen zu beschwören; zwar gelangen dem Regisseur wunderschöne mimische Detaüs; zwar kam da,und dort augenblicksweise eine tschechowartige Atmosphäre im Land der Menschen auf; zwar erwies sich der Dirigent als subtiler Kenner der vom Rhythmus und der Sprachmelodie her bestimmten Klangwelt Janäceks. Aber der Gesamteindruck wurde ausschlaggebend gestört durch eine überbordende Choreographie im Stil des schon erledigt geglaubten „Kindermärchens“, in dem Mücklein, Häslein und Fröschlein in mißverstandener Herzigkeit den symbolischen Wald unsicher machten. Daß die besten Intentionen eines Dirigenten zuwenig sein können, bewies außerdem das Orchester, das an’ Klangqualität und Präzision mehr als einiges zu wünschen übrig ließ.
Nach den gezielten Bemühungen des „steirischen herbstes“, das Publikum mit den Prinzipien des Ausdruckstanzes vertraut zu machen, holte Ballettmeister Waclaw Orli- kowsky mit dem ersten Ballettabend der Grazer Opernsaison nun zum Gegenschlag aus: damit dieser recht massiv ausfalle, begnügte man sich nicht nur mit der Wahl einer Mumie des klassischen Tanzes, nämlich Adolphe Adams „Giselle“ -, es mußte selbst die Originalchoreographie, wie sie sich aus der Entstehungszeit des Werkes zur Petersburger Fassung durch Pe- tipa entwickelt hat, als Grundlage der Grazer Einstudierung herhalten. Als Pendant zur archivalischen Tätigkeit des Ballettmeisters fungierte Bühnenbüdner Wolfram Skalicki diesmal als Dekorationsmaler mit stil echt nachempfundenen Kulissen aus der Spätromantik.
Ob dieses bewußte Bekenntnis zur Verstaubtheit und zur nostalgisch getarnten Langeweile dem pädagogischen Eros eines Museumsführers entspringt oder dem Ehrgeiz eines beflissenen Historikers, der den Weg „ad fontes“ zumindest des klassischen Tanzes erhellen will, soll nicht untersucht werden. Fest steht, daß solch historisierender Akt auch die technische Qualität der großen Zeit des „Ballet Russe“ wenigstens in Ansätzen haben müßte. Dies war in Graz nicht der Fall, sieht man von den beiden Protagonisten Linda Papworth und dem Zagre- ber GastM arin Turku ab. Der Rest war trotz Flugmaschinen und poetischen Farben, exakter Einstudierung und brav befolgtem Drill im Grunde nur ein Aufdecken įer Grenzen des Grazer Opemballetts. Erst nach jahrelanger intensiver Schulung durch einen Mann wie Orlikowsky wird diese Truppe den von ihrem Chef intendierten Aufgaben gewachsen sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!