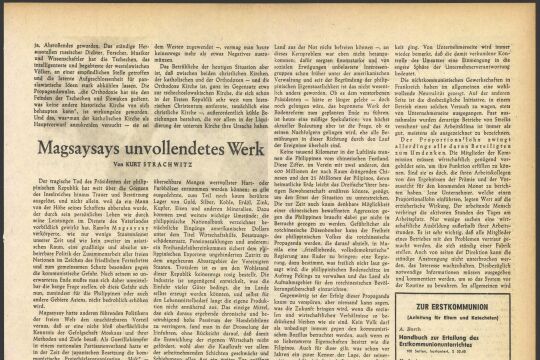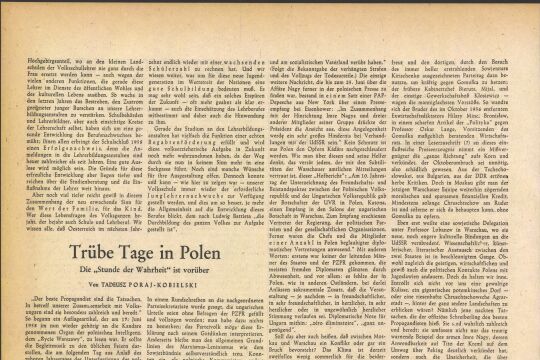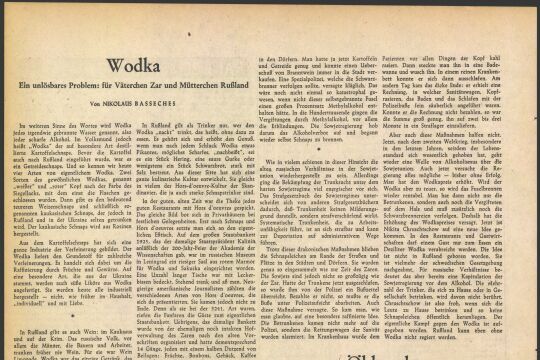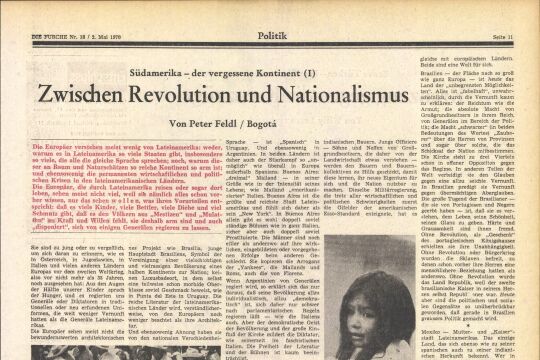Generation der uberflussigen
Die Gleichschaltung der peruanischen Presse und die Verringerung der Meinungsfreiheit in dem von einer Offiziers] unta regierten Land deutet auf wachsende innenpolitische Spannungen. Bislang ist Peru noch immer die „liberalste Diktatur Südamerikas“. Die Frage, wie lange es beides bleiben kann, muß offengelassen werden. Der Kurs der Junta ist in den Augen der alten Oligarchie linksradikal, den echten Linksradikalen aber viel zu weich.
Die Gleichschaltung der peruanischen Presse und die Verringerung der Meinungsfreiheit in dem von einer Offiziers] unta regierten Land deutet auf wachsende innenpolitische Spannungen. Bislang ist Peru noch immer die „liberalste Diktatur Südamerikas“. Die Frage, wie lange es beides bleiben kann, muß offengelassen werden. Der Kurs der Junta ist in den Augen der alten Oligarchie linksradikal, den echten Linksradikalen aber viel zu weich.
Peru hat, wie in FURCHE Nr. 32/ 1974 („Die Soldaten, die Retter...“) berichtet, die Bodenreform lückenlos verwirklicht; der gesamte Groß-gundbesitz ging in die Hände jener über, die den Boden tatsächlich bearbeitet haben, nämlich der auf den Farmen ständig Beschäftigten, wobei aber das Heer der Tagelöhner, Ge-legenheits- und Saisonarbeiter und damit die überwiegende Mehitielt der Agrarbevölkerung unberücksichtigt blieb. In einem gewissen Sinn haben es diese Menschen, die die Mehrheit der Peruaner bilden, heute schwerer als vor ver Bodenreform, denn die neuen Besitzer der Latifundien, nämlich die Mitglieder der bis zu 40.000 und 50.000 Menschen zählenden Kooperativen, sind daran interessiert, ihren eigenen Lebensstandard zu heben, das heißt kostensparend zu wirtschaften, und dies wiederum heißt mit möglichst wenigen außenstehenden Saisonhilfskräften auszukommen.
So hat Peru zwar unter allen südamerikanischen Ländern wohl die tiefgreifendsten sozialen Reformen verwirklicht, damit aber das Elend der breiten Massen der traditionellen Landbevölkerung kaum verringert. Mehr war in den wenigen Jahren der Junta-Herrschaft auch schwer möglich.
Trotzdem steht die Offiziersjunta nicht nur unter Druck der alten besitzenden Oberschicht, sondern unter einem starken Druck von links. Die peruanische Linskopposition fordert Gerechtigkeit, fordert Gleichheit — und sei es Gleichheit auf Kosten des Lebensstandards, auf Kosten von Entwicklungstempo und wirtschaftlicher Effizienz. Das Rückgrat der Linksopposition bildet der linksorientierte Teil des Klerus. Während rund 75 Prozent des Klerus eine Haltung vorsichtiger Unterstützung der Junta ohne direkte Identifizierung verfolgen, steht das restliehe Viertel extrem rechts oder extrem links.
Links stehen vor allem junge Priester aus Europa. Auf 6000 Peruaner kommt ein Priester — doch herrscht in Peru ein erheblicher Mangel an heimischem Priesternach-wuchs. Unter den 2500 Priestern sind nur ganze 1000 Peruaner, und selbst ein Teil von diesen besteht aus naturalisierten Ausländern. Der Rest des Klerus, 1500 Priester, kommt aus allen katholischen Ländern, in erster Linie Kanada und Spanien.
Linksmarxistische und lankskatholische Opposition treffen sich in der Forderung nach Verminderung der sozialen, vor allem der Einkommensunterschiede zwischen den Extremen des Lumpenproletariats auf der einen, den Aristokraten der industriellen und landwirtschaftlichen Managements auf der anderen Seite. Anderseits beruht aber gerade der wirtschaftliche Erfolg etwa der ver-genossenschafteten Großgrundbesitze auf dem Know-how ihrer Generaldirektoren, deren (von den Mitgliedern der Kooperativen beschlossene) Gehälter sich durchaus mit europäischen Managerbezügen verlgei-chen können. Diese Gehälter erhalten dem Land das Know-how der Enteigneten, die anderenfalls das Land verlassen hätten, und sie sind eine der wichtigsten Bedingungen dafür, daß in Peru eine totale Bodenreform durchgeführt werden konnte, ohne daß sie einen landwirtschaftlichen Produktions- oder Produktivitätsrückgans zur Folge gehabt hätte. Da Gegenteil war der Fall. Noch Ist agrarwissenschaftli-ches Know-how In Peru Mangelware — je breier die Schicht der fachlich Ausgebildeten wird, desto schneller werden auch die Gehälter der Koope-rativ-Direktoren und die Einkommen der Mitglieder einander entgegenkommen. Der revolutionäre, oder besser: ein noch revolutinärerer Weg würde für Peru die gerechtere Verteilung eines wesentlich kleineren Sozialproduktes, würde Gleichheit in der Armut bedeuten.
Die Junta hat erkannt, und es war nicht schwer zu erkennen, daß die Zukunft des überschüssigen Landproletariats nicht auf dem Land liegen kann. Eine Beteiligung aller jener, die zwar voll von den Großgrundbesitzern abhingen, aber eben nur vier Monate im Jahr Arbeit hatten, an der neugeschaffenen Kooperative wäre wesentlich „gerechter“ gewesen, als die Ubergabe des Bodens an die Vollbeschäftigten. Anderseits aber hätte diese gerechtere Lösung verschiedene schwerwiegende Nachteile gehabt:
• Vergrößerung der Zahl jener Menschen, die von den Erträgen einer Kooperative leben müssen, Senkung dea ohnehin schon niedrigen Lebens-Standards — in vielen Fällen unter die Elendsgrenze.
• Ein Überangebot an menschlicher Arbeitskraft, das die Technisierung und damit die Modernisierung der Kooperativen, also der peruanischen Landwirtschaft, verlangsamt oder überhaupt unmöglich gemacht hätte.
• Das Problem der Freisetzung von Agrarbevölkerung samt allen damit zusammenhängenden Rechts- und Sozialproblemen (auf welche Weise soll in einer Genossenschaft entschieden werden, welche Mitglieder, also Mitbesitzer, weggeschickt, also enteignet werden?) als schwerer Ballast für eine möglicherweise nahe Zukunft.
Für das Millionenheer des peruanischen Lumpenproletariats gibt es nur eine einzige Chance auf ein menschenwürdiges Dasein. Diese Chance heißt Industrialisierung. Folgerichtig wird die Industrialisierung von Perus Poltoffizieren auch mit allen Mitteln gefördert. Während der landwirtschaftlich genutzte Boden als ein nicht beliebig vermehrbares Gut vergesellschaftet wurde, öffnete die Junta dem Privatkapital alle Wege zur gewinnversprechenden Anlage in industriellen Investitionen. Die für die peruanische Industrialisierung benötigten Kapitalien kommen — soweit es sich nicht um reinvestierte Industriegewinne handelt — vor allem aus drei Quellen: Peruanisches Privatkapital, ausländisches Kapital, das direkt in Peru industriell investiert wird, und vom Staat investierte, auf dem internationalen Kapitalmarkt aufgenommene Kredite. (Peru gilt heute als überaus kreditwürdig, die Regierung hat kaum Probleme, Kredite zu bekommen.)
Das Reservoir an inländischen Investitionsmitteln wurde durch die Modalitäten der Enteignung des Großgrundbesitzes stark vergrößert.Wie berichtet, war die Entschädigung für die Grundherren von der Qualität ihrer Wirtschaftsführung und von ihrer Steuerehrlichkeit abhängig, wobei die vorhandenen Investitionsgüter wesentlich großzügiger abgelöst wurden als der eigentliche Grund und Boden. 10 bis 20 Prozent der Entschädigungen wurden bar ausbezahlt, der Rest in Schuldbonussen, die mit sechs Prozent pro Jahr verzinst und in 15 Jahren abgestattet werden. Die Besitzer dieser Schuldbonüsse können dieses eingefrorene Kapital jedoch augenblicklich flüssigmachen, wenn sie es für industrielle Investitionen verwenden und dabei jeweils den in Form von Schuldbonussen eingezahlten Betrag in Form eines Barzuschusses verdoppeln. Eine Gelegenheit, von der sehr stark Gebrauch gemacht wird, da die erzielten Industriegewinne viel höher sind als die sechsprozentige Verzinsung.
Aber auch Perus Industrie ist auf Vergesellschaftung programmiert. Auch sie in einer Form, die einerseits wirkungsvoll ist, anderseits das private Kapital, das Peru so bitter nötig braucht, nicht verprellt. Wie in allen Ländern der Andengruppe, dürfen auch in Peru ausländische Anleger jährlich maximal 14 Prozent des investierten Kapitals als Gewinn frei ins Ausland transferieren, der Rest muß in Peru verbleiben, kann aber in verschiedenen Formen reinvestiert werden. Darüber hinaus müssen in Peru alle ausländischen Unternehmen innerhalb von 15 Jahren ab Gründung, spätestens aber ab 1973, mehrheitlich in peruanische Hand übergehen. Im Gründungsver-. trag ist vorzusehen, in welchen Etappen der inländische Kapitalanteil steigen wird, bis er die geforderten 51 Prozent erreicht.
Da reinvestierte Gewinne steuerfrei bleiben, ist die Investitionstätigkeit sehr stark, wobei die einzige Schwäche darin besteht, daß meist 'im eigenen Betrieb reinvestiert wird, so daß die Investitionstätigkeit zu einem großen Teil mehr nach den Zufälligkeiten der jeweiligen Gewinne als nach den Entwicklungs-notwendigkaiten erfolgte.
Die Junta forciert die Mitbeteiligung der Arbeiterschaft am industriellen Anlagevermögen und wendet auch dabei ein System an, welches das private Unternehmertum nicht bremst: Ein Viertel aller Industriegewinne gehört den Arbeitern. Zehn dieser 25 Prozent der Gewinne vor Steuern werden an die Arbeiter und Angestellten der jeweiligen Firmen bar ausgeschüttet, und zwar fünf Prozent gleichmäßig auf alle Arbeitnehmer aufgeteilt und fünf Prozent in Abhängigkeit vom individuellen Lohnniveau. Die restlichen 15 Prozent der Gewinne vor Steuern werden der Comunidad industriell übergeben, einer Gemeinschaft aller Arbeitnehmer des Betriebes, die diesen ihren Gewinnanteil im Unternehmen reinvestiert. Es handelt sich dabei um stimmberechtigtes Kapital, und über dieses stimmberechtigte Kapital, und nur über dieses, findet die Mitbestimmung der Arbeitnehmer statt. Die Anteile der Comunidad industrial sind Eigentum dieser Körperschaft, der alle Arbeitnehmer des Betriebes angehören — scheidet ein Arbeiter aus, bekommt er von der Comunidad einen Betrag ausgezahlt.
Der Kapitalsanteil dieser Betriebsgemeinschaft ist vorerst auf 50 Prozent des Gesellschaftskapitals begrenzt, in den zwei Jahren, die seit Inkrafttreten des Beteiligungssystems vergangen sind, haben die Arbeiter schätzungsweise zehn bis fünfzehn Prozent der peruanischen Privatindustrie übernommen. Das Regime und seine Berater nehmen an, daß die „kritische Grenze“ von 50 Prozent in zehn Jahren erreicht sein könnte — bis dahin ist Zeit, das heikle Problem der Kapitalsmajorität zu lösen. Wesentlich an diesem Vergesellschaftunigsmodell ist, daß es ohne jede Enteignung funktioniert — Mitbestimmung und Beteiligung der Arbeitnehmer werden lediglich über die Gewinne, also den Zuwachs, realisiert, und das Tempo der Vergesellschaftung ist mit dem Entwicklungstempo der peruanischen Industrie direkt gekoppelt. Forciertes Entwicklungstempo beschleunigt die Arbeitnehmer-Mitbeteiligung, zugleich aber auch die private Gewinn-maximierung, so daß Investoren und Arbeitnehmer am Zuwachs des Investitionsvolumens einträchtig partizipieren — einträchtig zumindest solange, bis sich das Problem der Majoritäten stellt.
Und einträchtig auch nur, solange der Verteilungskonsensus der Klassen unter Junta-Auspizien zementiert bleibt. Peru-Kenner, wie der Österreicher Peter Feldl, der den peruanischen Industrieminister und dessen Stab berät, sehen keinerlei Alternative zur Junta und auch keine Kräfte, die sie ernsthaft gefährden könnten. Das aufgeklärt-patriarchische Regime von Offizieren, Äie alle wichtigen Schlüsselpositionen überwachen und auch die Regierung aus Uniformträgern zusammensetzen, läßt sich einerseits nicht dreinreden, aber anderseits die anderen reden: Zumindest bislang sind in Peru nicht nur alle politischen Parteien einschließlich der kommunistischen zugelassen (nicht aber Wahlen), und die gewerkschaftlichen Organisationen genießen umfassende Freiheiten. Das gewerkschaftliche Spektrum reicht von der kommunistischen Gewerkschaft (der größten des Landes) über streng katholische, am ehesten christlich-sozial zu nennende Gewerkschaften bis zur „Gewerkschaft der Revolution“, die die Junta direkt unterstützt. Streiks sind gestattet, doch tritt nach einiger Zeit ein Vermittlungsmechanismus in Tätigkeit. Der Gesamtverlust von zwei bis drei Prozent der Gesamtarbeits-zeit durch Streiks hält sich in Grenzen — wie überall, wird in größeren Unternehmen mehr als in kleineren gestreikt. Bislang wurde kein Ausstand behördlich gebrochen.
Einer gegängelten Presse steht zumindest bisher ein völlig freier Buchimport gegenüber. In den Buchhandlungen von Lima ist das gesamte Spektrum der in spanischer Sprache gedruckten politischen Literatur zu haben — bis hin zum Maoismus. Bücher sind zollfrei und es gibt weder Einfuhrbeschränkungen noch irgendwelche Einfuhrlenkungsmaßnahmen.
Doch der „Druck im Kessel“ ist nicht gering. Die Zahl der in der Landwirtschaft nicht mehr und in der Industrie noch nicht Gebrauchten wächst, das Millionenheer des Lumpenproletariats drängt in die berstenden Städte. In den Städten werden nur fünf Prozent Vollarbeitslose registriert — aber ein sehr, sehr hoher Prozentsatz ist unterbeschäftigt. Für die Provinzen liegen überhaupt keine Beschäftigungsstatistiken vor. Die Offlziersjunta, die die letzte demokratisch gewählte, im Dreiparteienclinch gestrandete demokratische Regierung gestürzt hat (die letzten Wahlen fanden 1964 statt), hofft, dieses Arbeitslosigkeitsproblem, das, unabhängig von allen politischen Systemen, das Problem des lateinamerikanischen Kontinents ist, teils durch Kolonisierung (Neulandgewinnung), teils durch die Entwicklung des Dienstleistungssektors im Gefolge der Industrialisierung zu lösen. Das Problem der Favelas, der riesigen Slums im städtischen Umland, wird heute auch in reichen Staaten, wie Venezuela, nur durch Wohnungsbau größten Maßstabes, durch die Errichtung neuer Wohnviertel in sparsamster Schnellbauweise, die aber doch mit allem Notwendigen, wie Strom, Wasser und Kanalisation ausgestattet sind, gelöst. Viel mehr kann kein lateinamerikanisches Land für seine „verlorene Genaration“ der von der Landwirtschaft abgestoßenen Menschenmassen vor den Toren der Industrialisierung tun.
Peru hat einem Subkontinent des Elends wie Indien immerhin zweierlei voraus. Die Möglichkeit, große Landstriche urbar zu machen — Peru zum Beispiel verfügt jenseits der Anden im Amazonasbecken über riesiges, fruchtbares Land, ein Land, wo heute kaum noch ein Mensch auf jedem Quadratkilometer lebt, Land, dem nur die Infrastrukturen, sprich Investitionsmittel, fehlen. Und immerhin ein politisches Management, das die Paralyse der politschen Kräfte überwunden, sich aber auch die faschistische Diktatur ä la Chile erspart hat und die Freiheit des Geistes, nicht aber die Freiheit der Korruption genießt. Freilich: Niemand kann die Fortdauer dieses Status quo auf Dauer garantieren. Die Junta balanciert auf einem hauchdünnen Grat.
Immerhin steht Chile in der Reichtums-, oder besser, in der Skala zunehmender Armut unter den Andenländern an zweiter bis dritter Stelle. An erster Stelle steht als reichstes Land der Anden-Zollunion Venezuela, gefolgt einst von Chile, über dessen wirtschaftliche Situation allerdings jetzt wenig gesagt werden kann. Die Rangfolge wäre fortzusetzen mit Peru, Kolumbien, Ekuador und als ärmstes Land der Anden Bolivien.
Diese Länder stehen in einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang. So ist die natürliche Verbindung zwischen Kolumbien und dem tausende Kilometer entfernten Chile stärker als die Kolumbiens mit dem Nachbarn Brasilien, denn die natürliche Verbindung heißt Meer, die natürliche Trennung bilden die Anden und die riesigen Räume Brasiliens. Venezuela ist in einer gewissen Außenseiterposition, weil jenseits des Panamakanals gelegen. Die Andenländer sind natürliche Handelspartner, verbunden durch den büligen Seetransport entlang der südamerikanischen Westküste, vom Rest der südamerikanischen Welt getrennt, durch die extrem teuren, weil langen innerkontinentalen Landverbindungen und durch die Anden. Auch der Seeweg rund um Feuerland ist lang und teuer — die Passage des Pana-makanales nur teuer..
Während die wirtschaftliche Zusammenarbeit der lateinamerikanischen Zollunion noch nicht weit ge-f dienen ist, findet zwischen den Ländern der Anden-Zollunion ein erhebliches Maß an Zusammenarbeit statt — trotz aller Verschiedenheit der politischen Systeme. In dieser Union arbeiten parlamentarisch-verfassungstreu regierte Länder wie Kolumbien mit eher rechtsstehend-laxen Offizieren (Ekuador), Iinksrefor-merischen Offizieren (Peru) und Faschisten (Chile) zusammen, was soweit geht, daß etwa große Investitionsprojekte wie Kraftwerke oder Stahlwerke im Wirtschaftsausschuß der Andenunion (die ebenfalls als „Junta“ bezeichnet wird) diskutiert und abgestimmt werden.