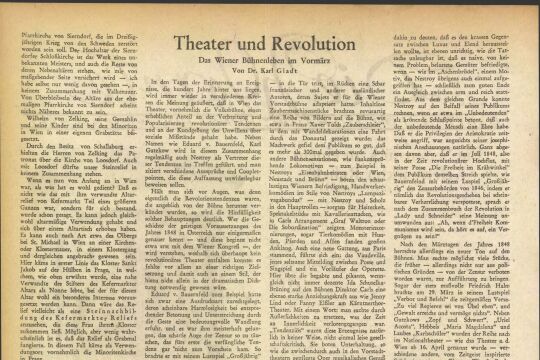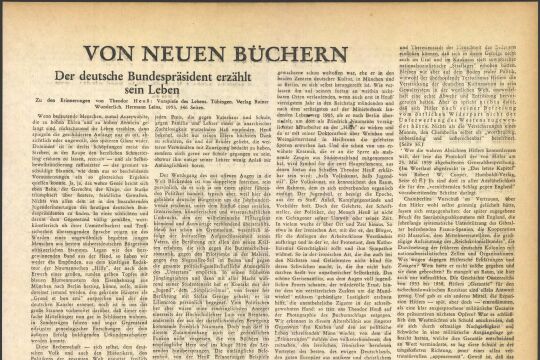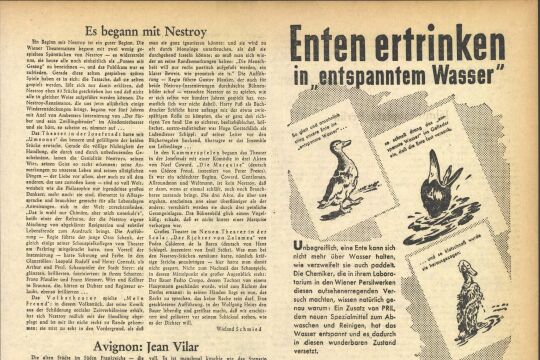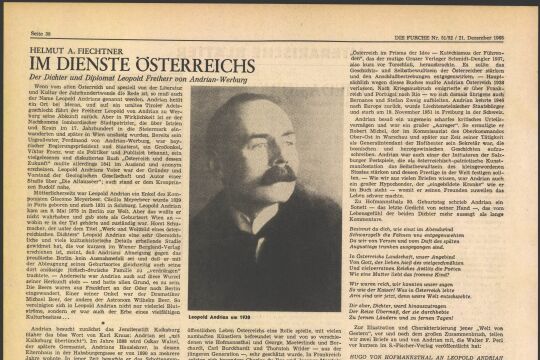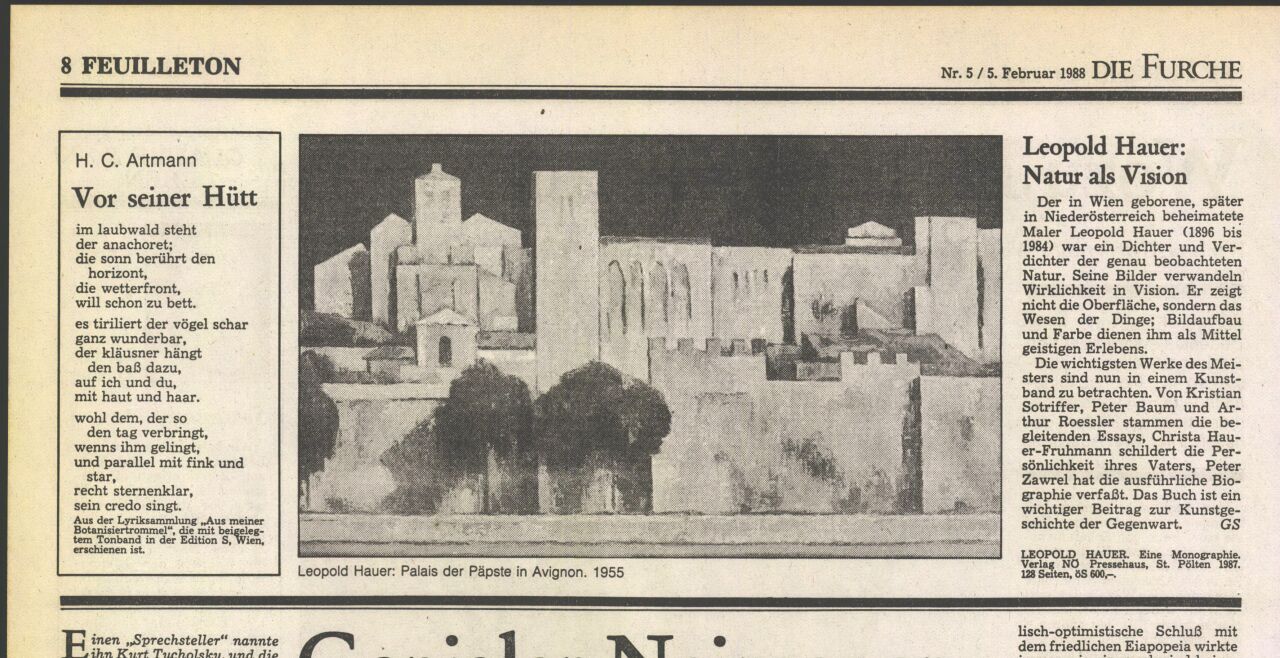
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Genialer Neinsager
Einen „Sprechsteller“ nannte ihn Kurt Tucholsky, und die Kaffeehaus-Szene Wiens wurde um ein Original ärmer, als der Mann mit dem Monokel 1938 nach New York emigrieren mußte: Anton Kuh. Uber tausend Zeitungsartikel des selbstbewußten Bohe-miens, der Karl Kraus mit beißender Ironie attackierte, sind bereits bekannt.
Im Zuge der Recherchen für meine Dissertation stellte mir Hans Weigel eine Rarität zur Verfügung: Anton Kuh bearbeitete
1932 für die Berliner Volksbühne den „jumpacivagabundus“ von Johann Nestroy. Die Bearbeitung selbst ist bis heute verschollen.
Was aber dank Hans Weigels Umsicht erhalten gebliebenist,ist das Theaterprogramm vom 11. Juni 1931 mit einem Aufsatz von Anton Kuh.
ELISABETH NÜRNBERGER
Johann Nestroy (1802 bis 1862), den man in Deutschland gemeinhin bloß als Verfasser von ein paar turbulenten, ein bißchen angestaubten Possen kennt und unwülkürlich den Lokaldichtern von der Art Adolf Glaßbrenners beizählt, war in Wirklichkeit weit mehr: einer der größten Satiriker der Weltliteratur und einer der genialsten Aphoristiker der deutschen Zunge. Die Germanisten haben ihm das Prädikat des „Wienerischen Aristophanes“ verliehen; er würde unseres Erachtens eher den Beinamen eines „Schopenhauer der Vorstadt“ verdienen. Seine Figur und sein Lebenswerk muten an, als ob Mephisto als Wiener Coupletsänger auf Erden niedergestiegen wäre.
Woher kommt es, daß man trotz aller entgegengesetzten Beteuerung von dieser Bedeutung Nestroys außerhalb Wiens und Österreichs so wenig weiß? Etwa, weü er doch, wie sich der unorien-tierte Dünkel ausdrückt, eine Lokalangelegenheit darstellt? Weil er ganz in der Mundart dem mittel- und norddeutschen Gehör nicht leicht zugänglich ist? Nein. Denn es ist nicht der Dialekt, der das Verständnis für ihn bisher erschwerte, sondern: die Unpopula-rität seines Geistes. Es bleibt nämlich die Sonderbarkeit bestehen, daß einer der volkstümlichsten Possendichter aller Zeiten nicht mit dem Gehirn der Mehrheit, sondern mit dem eines Ausnahmemenschen dachte. Dieser Mann war in der Anschauung des Daseins in einem Grade ungemütlich, daß ihn die zeitungsschrei-benden Anhänger der Kunst- und Volksgesundheit, solange er lebte, als Schädling und Verderber der wahren Volksmuse brandmarkten und ihm sogar später, wie einem kleineren Voltaire, in den
Nachrufen die Christlichkeit vorenthielten.
In Wien spürt man diesen Widerspruch zwischen der Gemütlichkeit der Sprache und der Un-gemütlichkeit ihres Inhalts sofort und empfindet ihn als den für Nestroy typischen höhnenden Satanismus. In Deutschland aber, für dessen Ohr Gemütlichkeit und Wiener Dialekt dasselbe sind und dessen Menschen, so paradox es klingt, im Grund moralischere und gemütlichere Wesen sind als die Wiener, bleibt man, ohne den Sinn jenes Gegensatzes zu verstehen, nur durch den Tonfall befremdet, der warm tönende Worte aus kaltem Herzen hinauszuschleudern scheint.
Darum, glauben wir, kommt es bei einer Bearbeitung, respektive Umdichtung Nestroys, wenn man dieses Dichters Geist und nicht seine Dramaturgie greifbar machen will, weder auf philologische Texttreue noch auf die Ubersetzung in ein anderes Idiom an (zwischen diesen beiden Extremen bewegten sich bisher alle Nestroy-Bearbeitungen, die in Berlin ans Licht kamen), sondern auf die verständliche Uber-tragung eben dieses Tonfalls. Worin besteht aber dessen Wesen? In einer ununterbrochenen Frozzelung des Schriftdeutschen. Dieses Schriftdeutsche ist für Nestroy, den Wiener, Phrase schlechthin. Er braucht also die moralischen Phrasen nicht im einzelnen lächerlich zu machen, sondern besorgt es in Bausch und Bogen, mit nichts als einer hochtönend-spöttischen Redseligkeit, die der Syntax, durch geheuchelte Ehrfurcht vor ihr, den Garaus macht. Das liegt den Nestroy-Figuren freilich ganz wunderbar, da sie ohnedies, wie die richtigen Komödienfiguren, durch ihren inneren Wortvorrat zu platzen scheinen.
Der „Lumpacivagabundus“, der in diesem Sinn und ohne Respekt vor dem hundertjährig überlieferten szenischen Gerüst der alten Posse für die „Volksbühne“ neu geformt wurde, ist im übrigen die große Ausnahme unter den Nestroy-Stücken — etwa wie Shakespeares Heinrich V. unter den Königsdramen. Er ist der Versuch des genialen Neinsagers zu einem herzhaft-volkstümlichen Ja. Eben dadurch aber und weü Nestroy sich deshalb zu einer idyllischen Einfachheit und Harmlosigkeit sozusagen erst verkünsteln mußte (der moralisch-optimistische Schluß mit dem friedlichen Eiapopeia wirkte immer wie ein geschwind beigesteuertes Anhängsel), hat gerade diese berühmteste seiner Possen trotz der ewigen Aktualität ihrer Figuren (Landstreicher-Tramp) einen Hauch von Vorzeitlichkeit behalten, der auch durch die freieste Text- und Szenenbearbeitung niemals recht entfernbar schien. Sie war eine wunderbare, einfache Radierung aus dem Vormärz, doch in keinem anderen Kostüm denkbar. Es galt also eine Transskription ins Zeitlose vorzunehmen und den eigentlichen, das heißt: anti-idyllischen Geist Nestroys auch für dieses Stück wieder in sein Recht zu setzen. (Zu diesem Zweck mußten ganze Szenen erfunden, einige Couplets hinzugedichtet, die Gestalt des „Lumpazi“ durchs Stück geführt, Motive aus einem zweiten Teü der Dichtung („Der Weltuntergangstag“) aufgenommen und ein im wesentlichen neuer dritter Akt geschrieben werden.) Dagegen war das Zauberbeiwerk des Stücks beizubehalten, ja als dessen dichterisches, also zeitloses Licht zu verstärken. Der Bearbeiter sah bei alldem die Möglichkeit durchaus ab, daß aus der gleichen Richtung, von der aus Nestroy noch über seinen Tod hinaus eine Versündigung am gesunden Geist des Volksstücks vorgeworfen wurde, nunmehr eine Versündigung am gesunden Geist Nestroys festgestellt werden konnte.
In der neuen Form des „Lumpa-ci“ soll der heitere Vagabundengeist seine Gültigkeit für die Menschen und die Zeit von 1931 erweisen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!