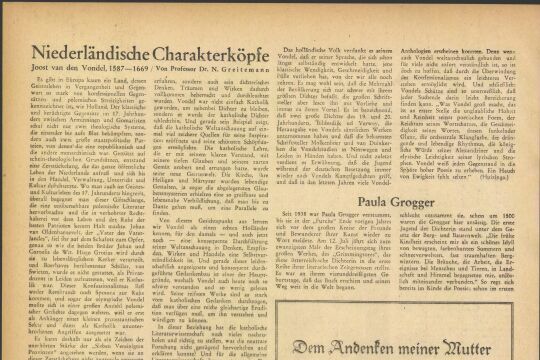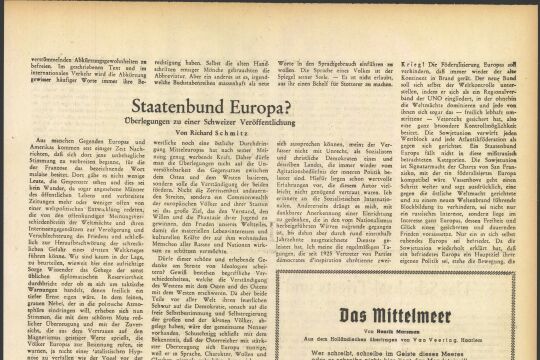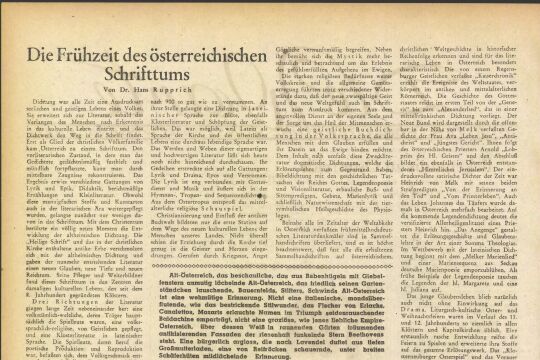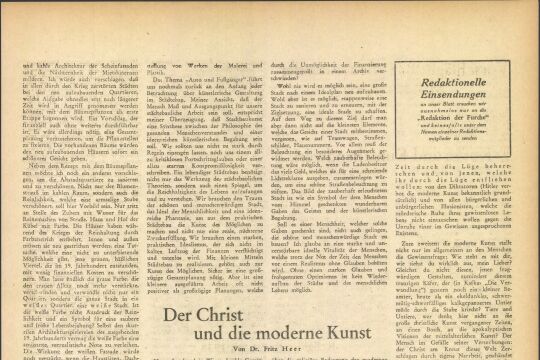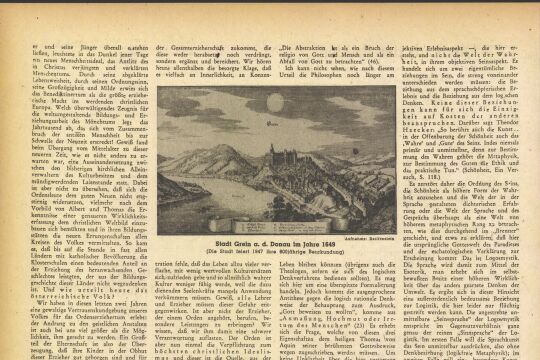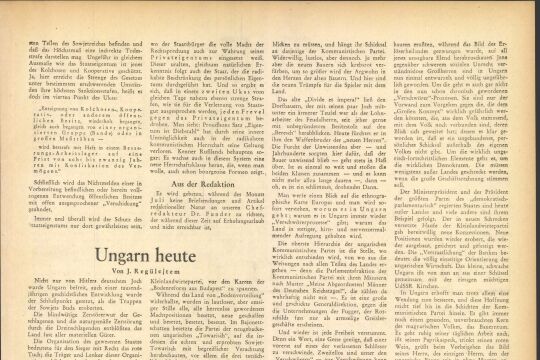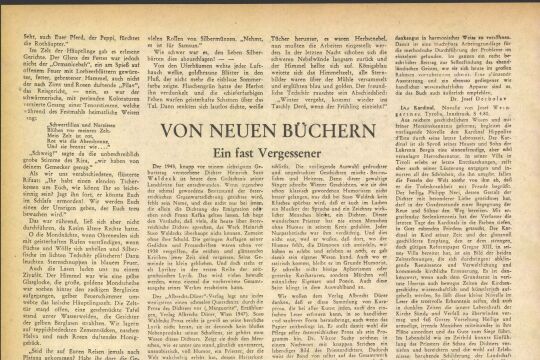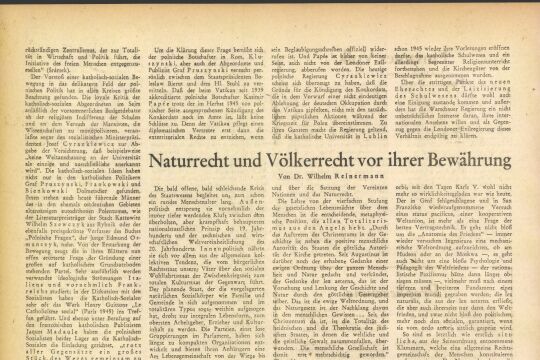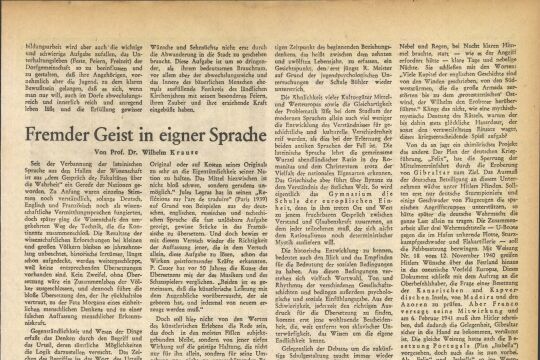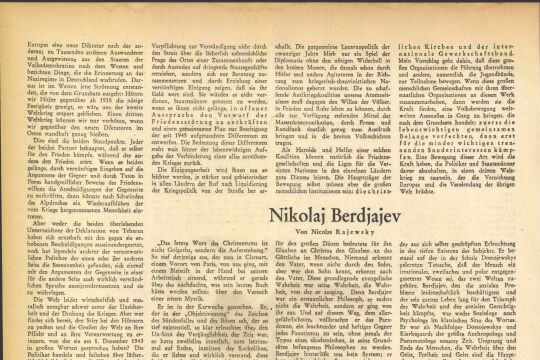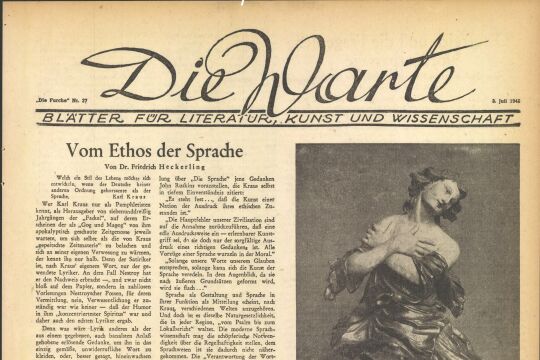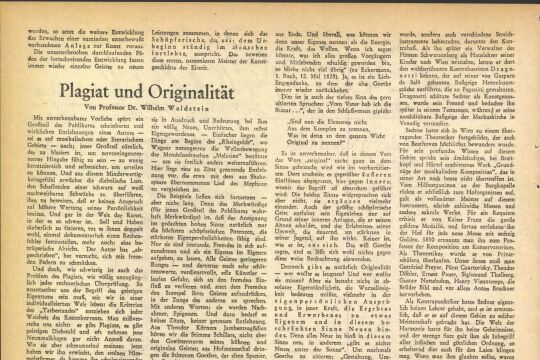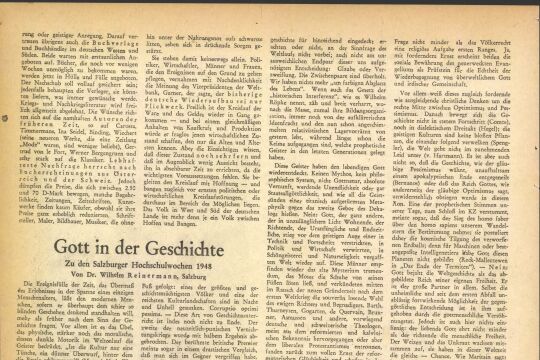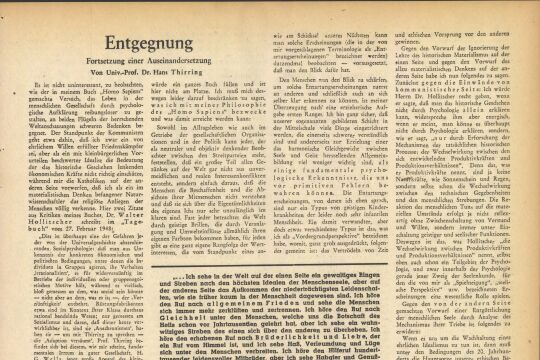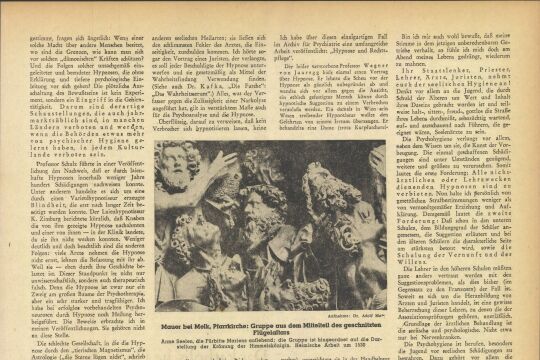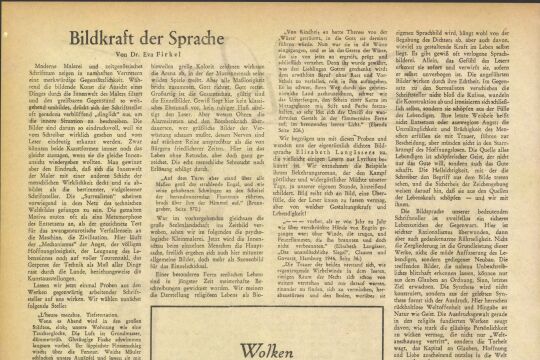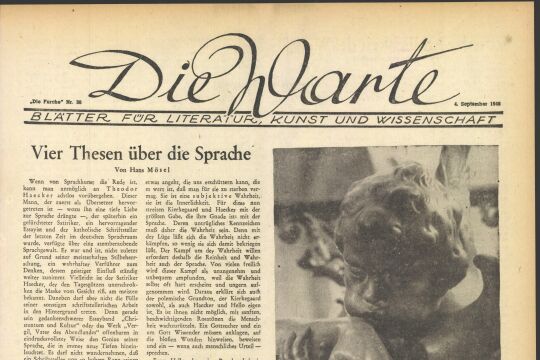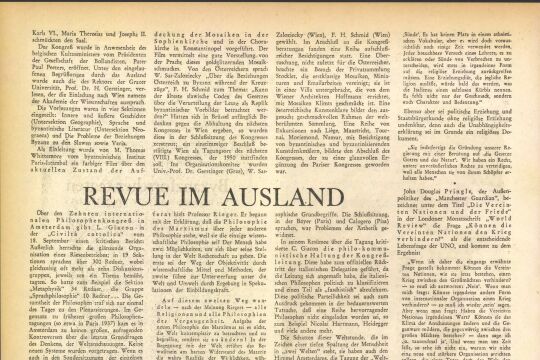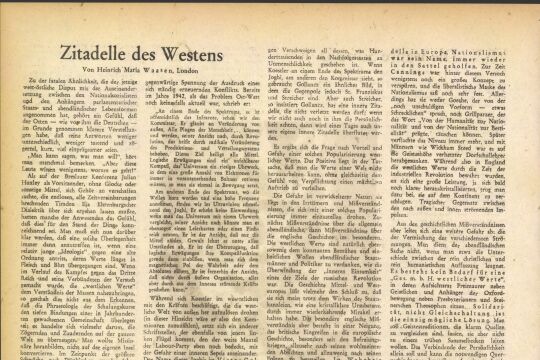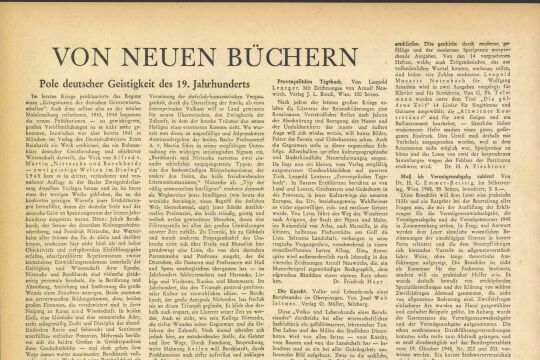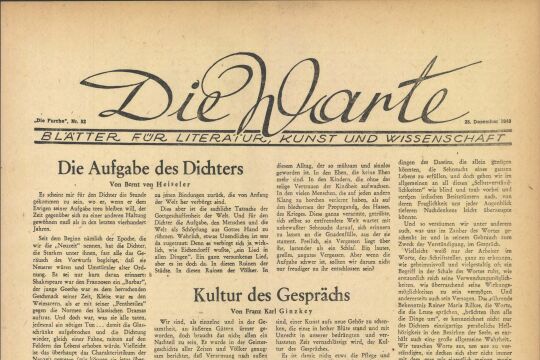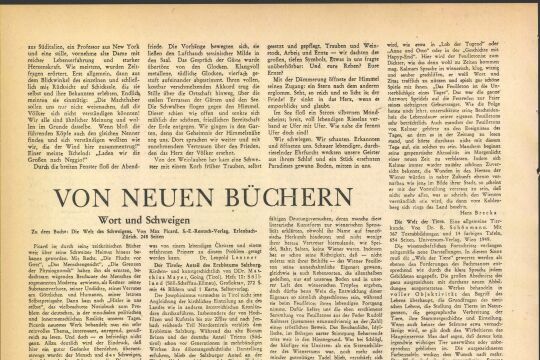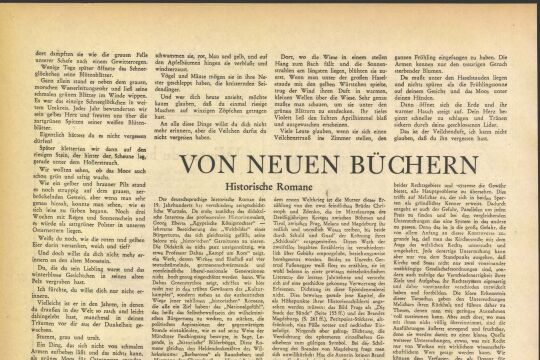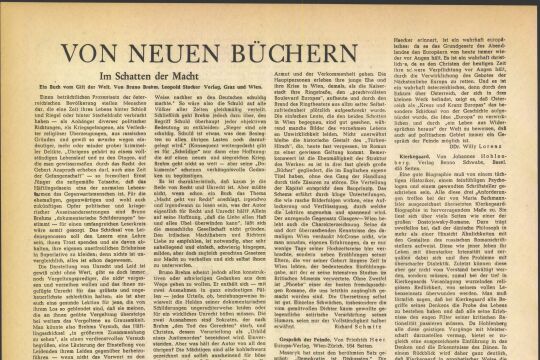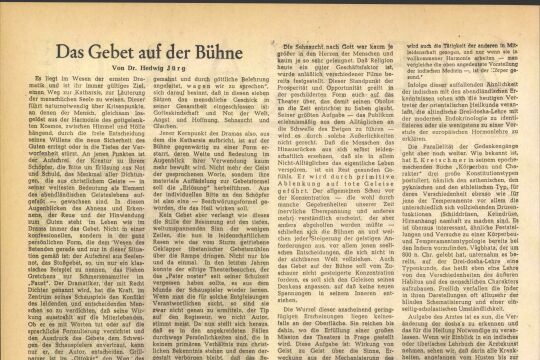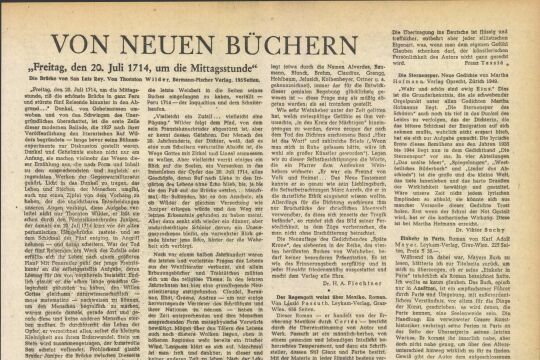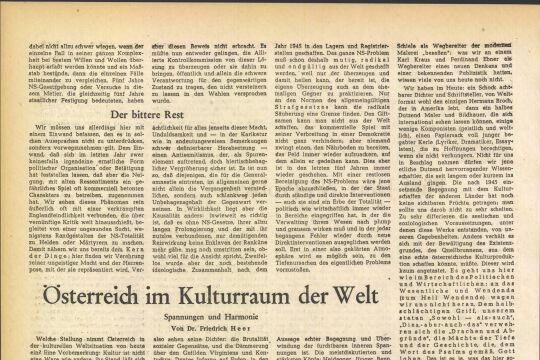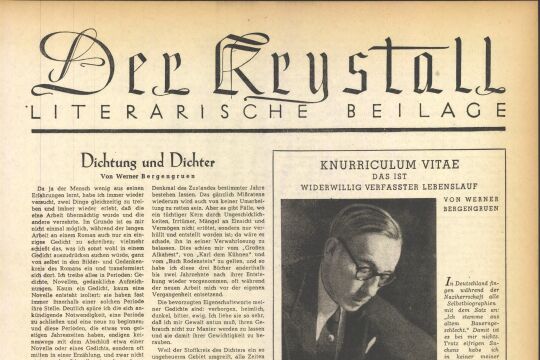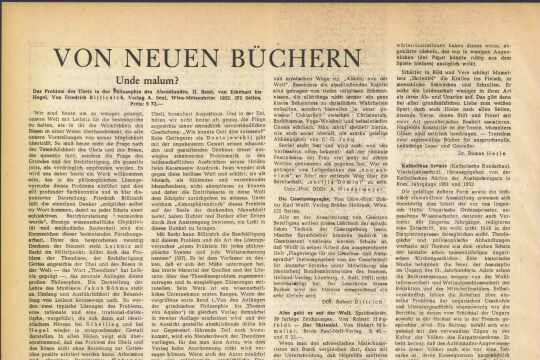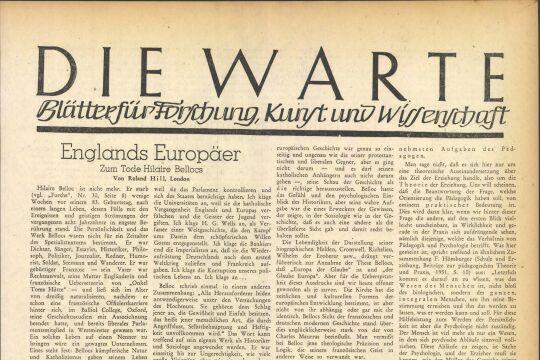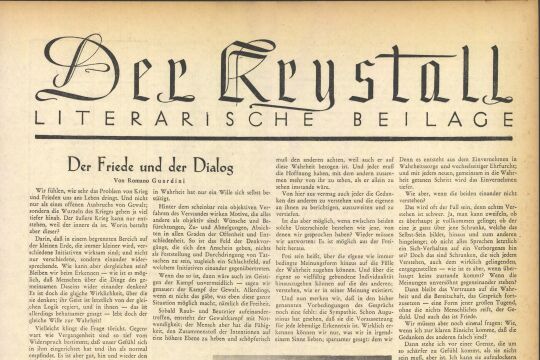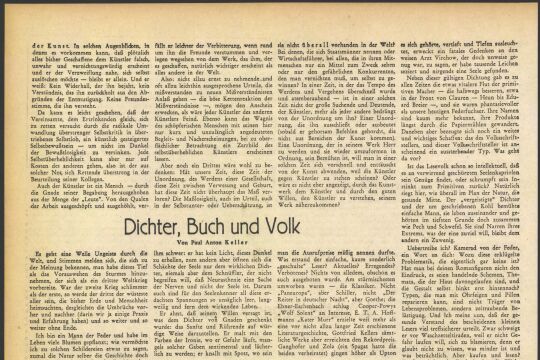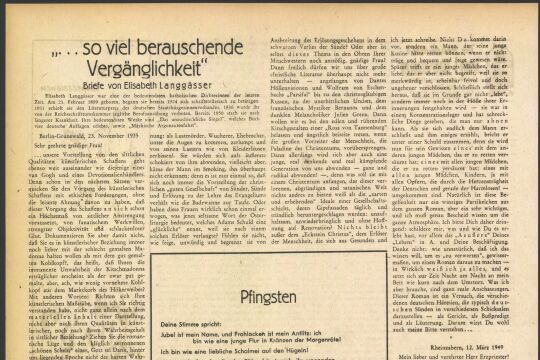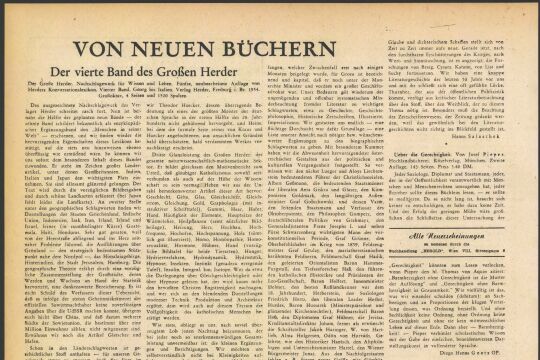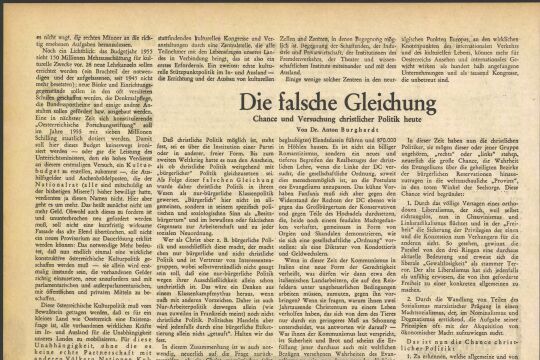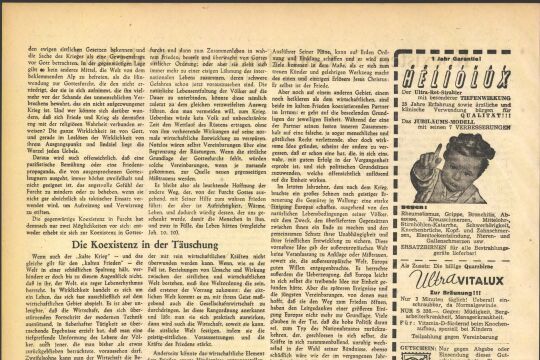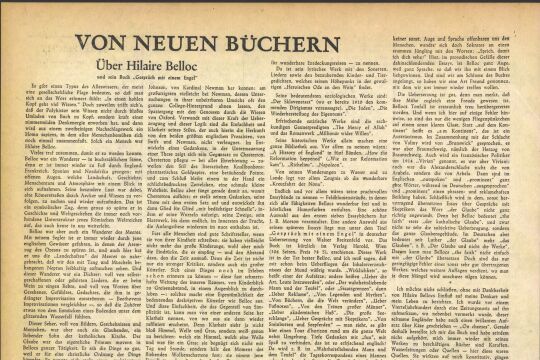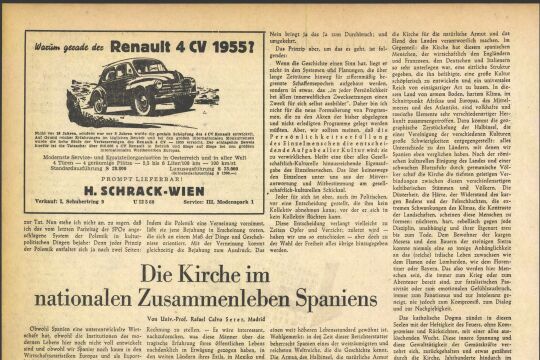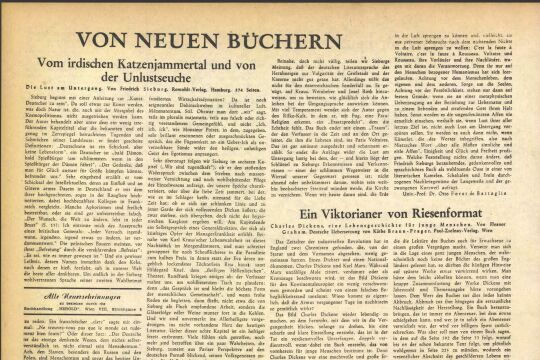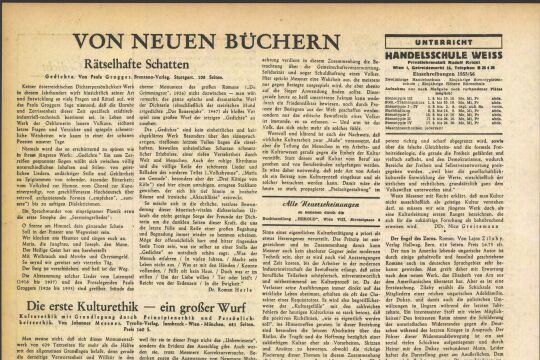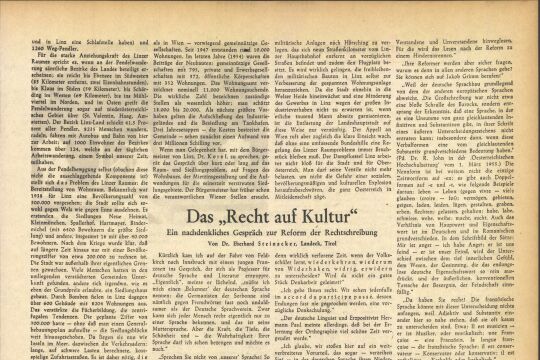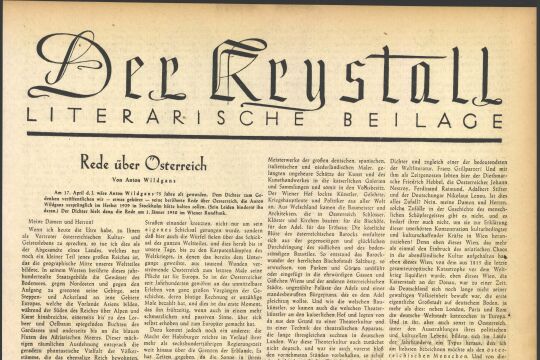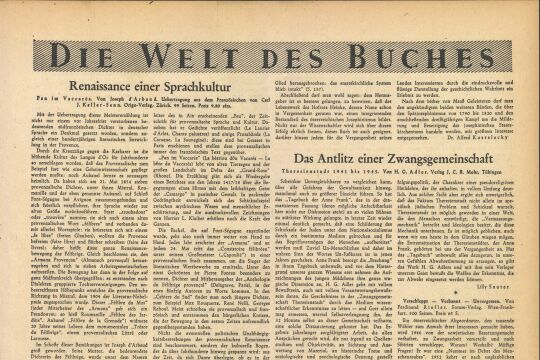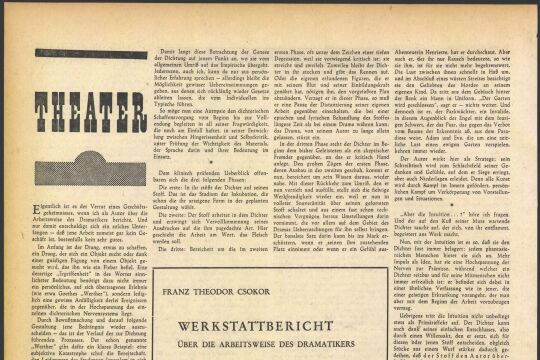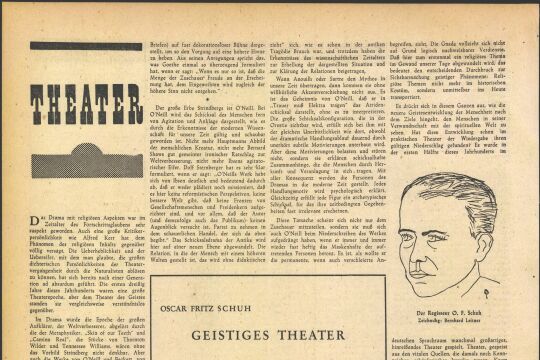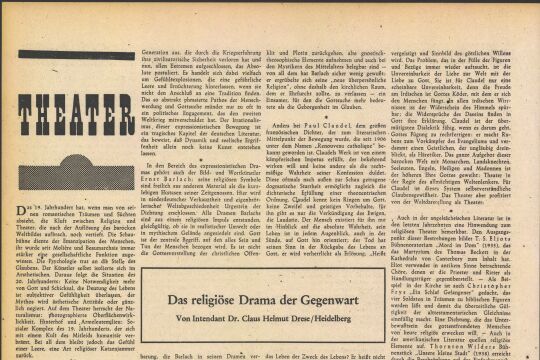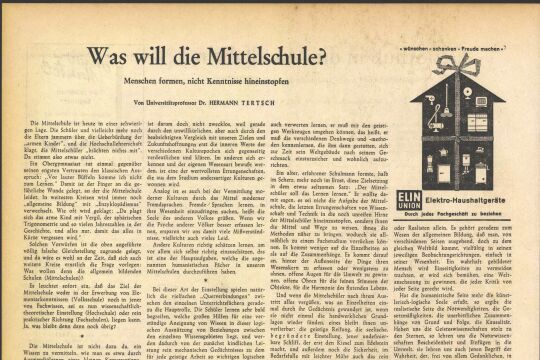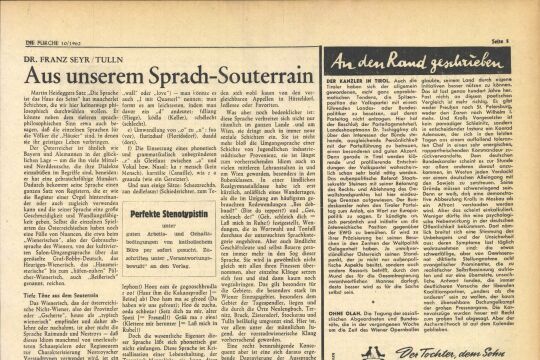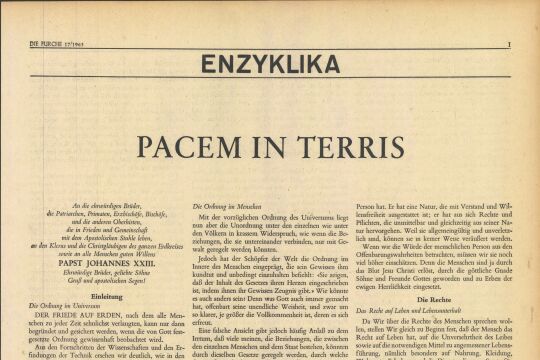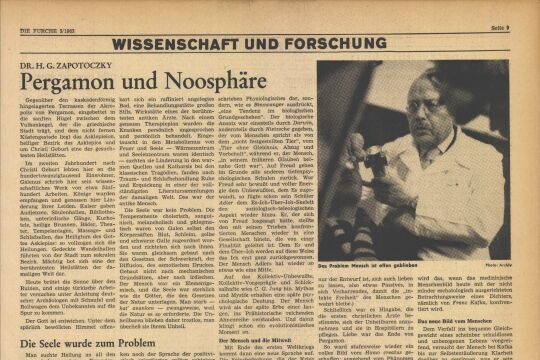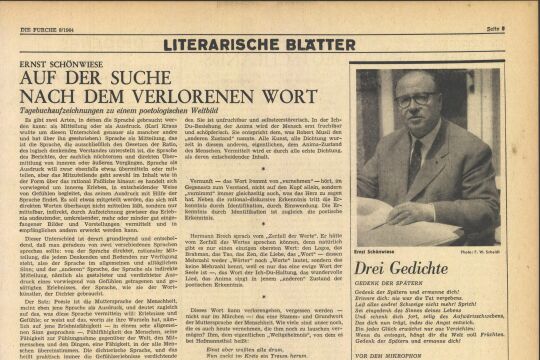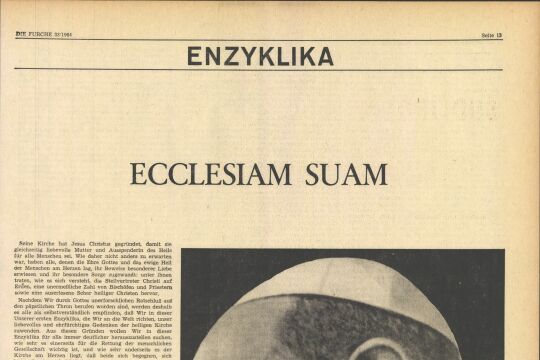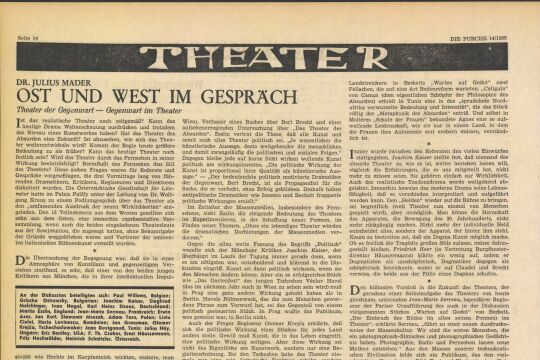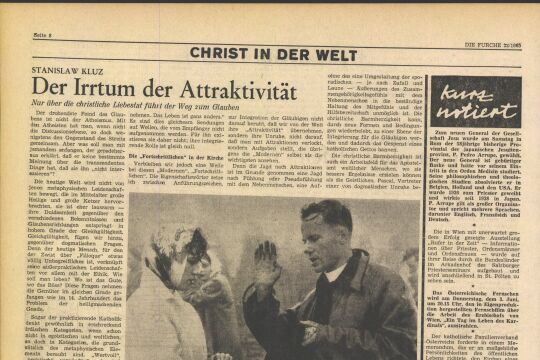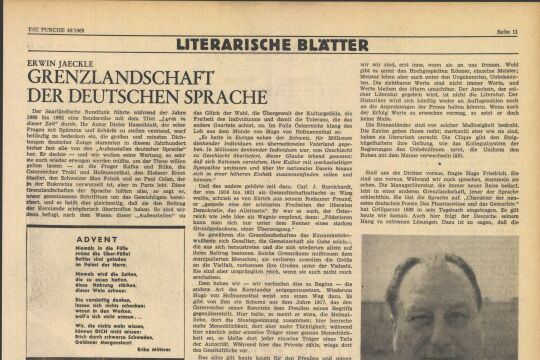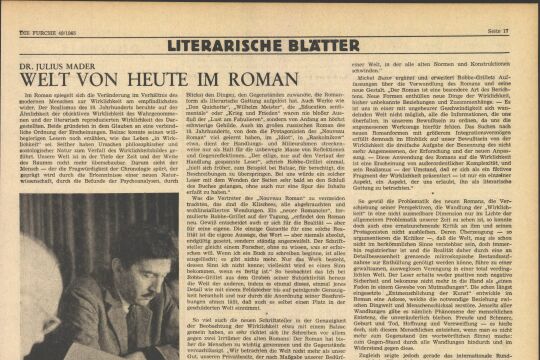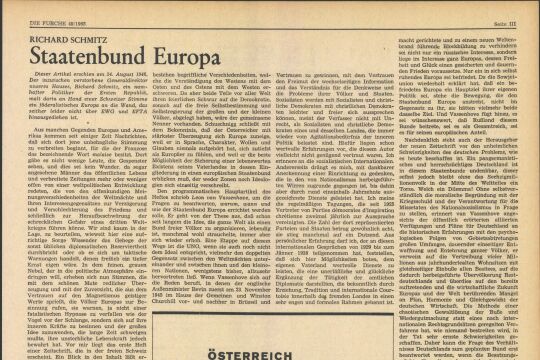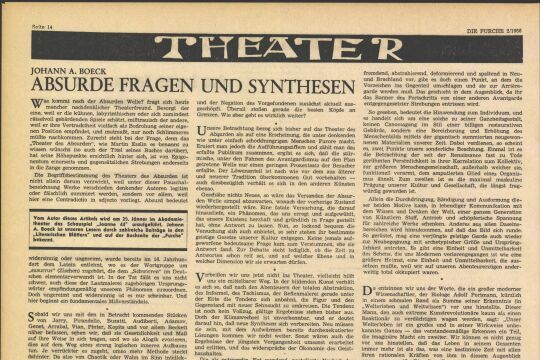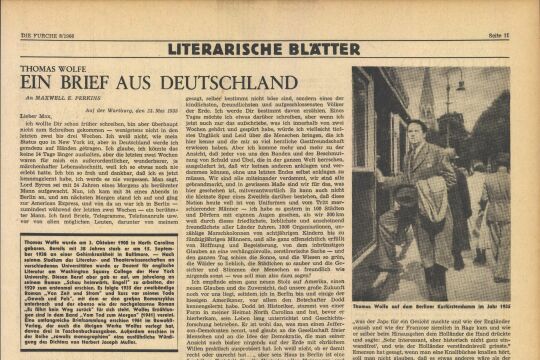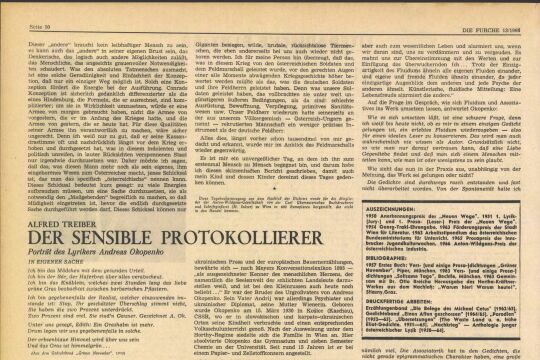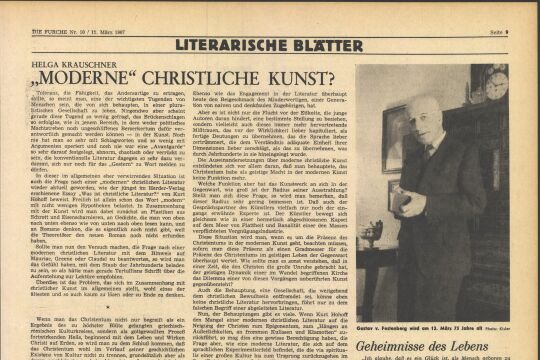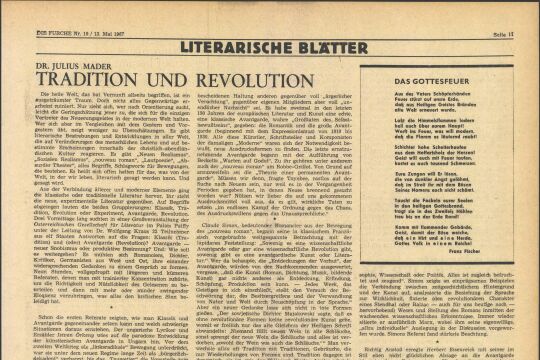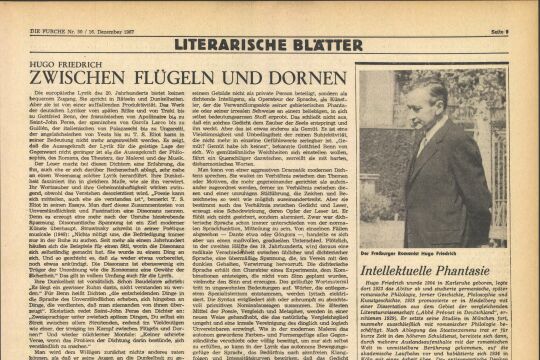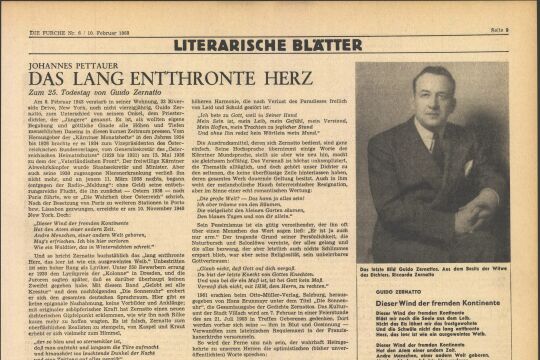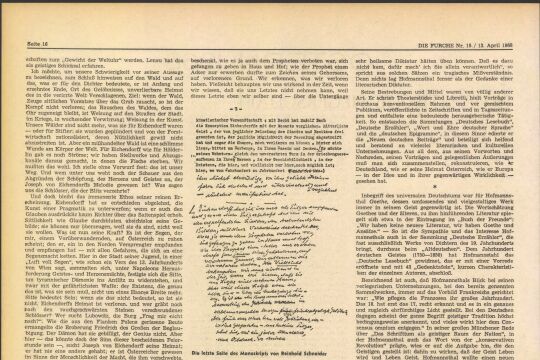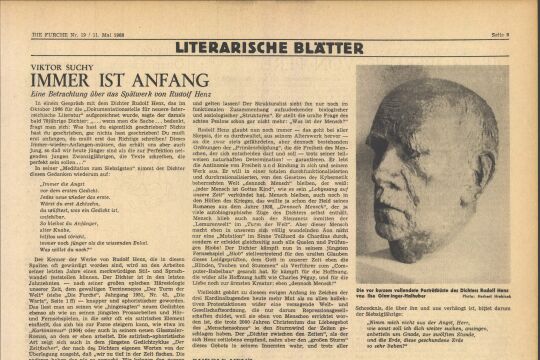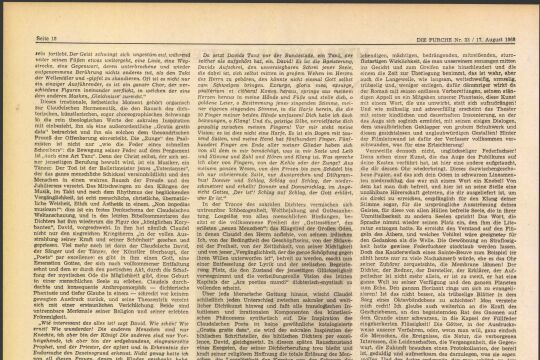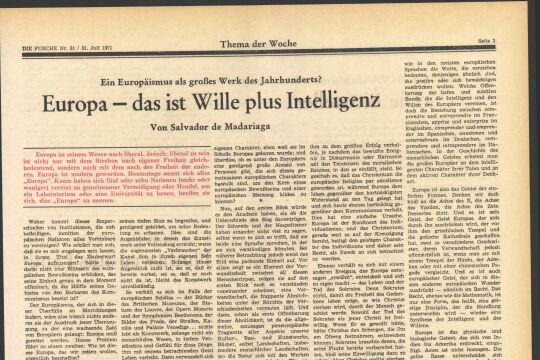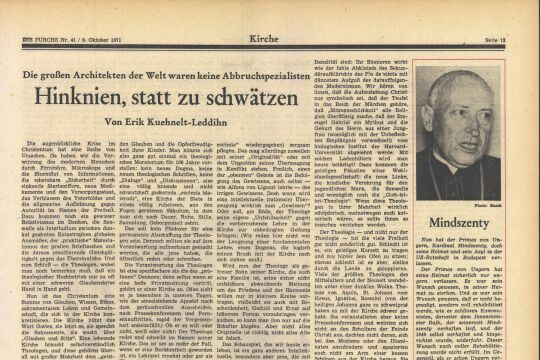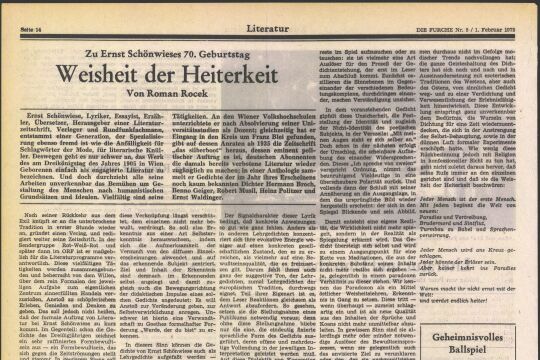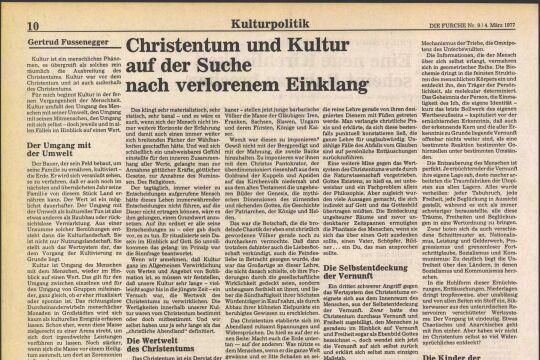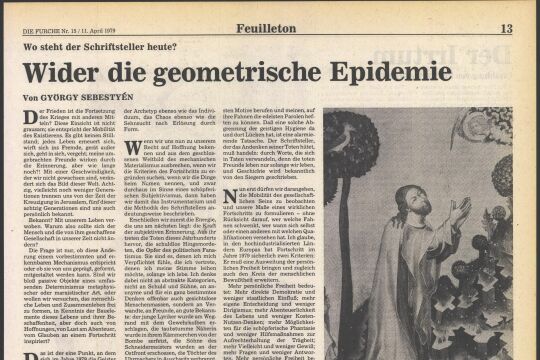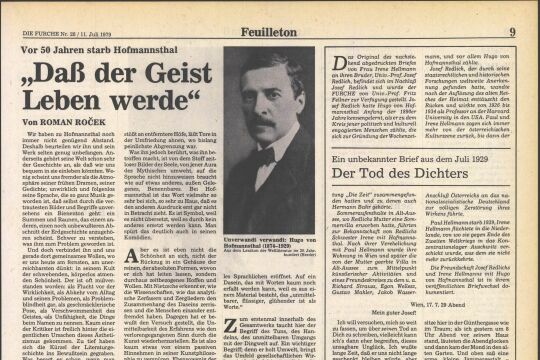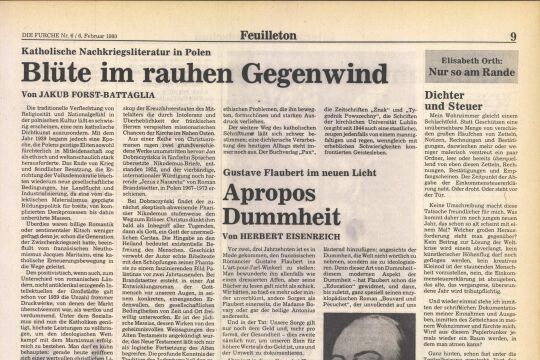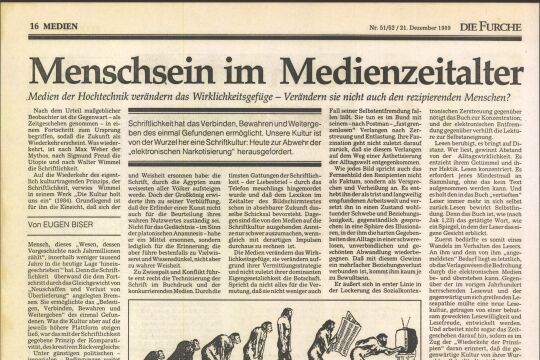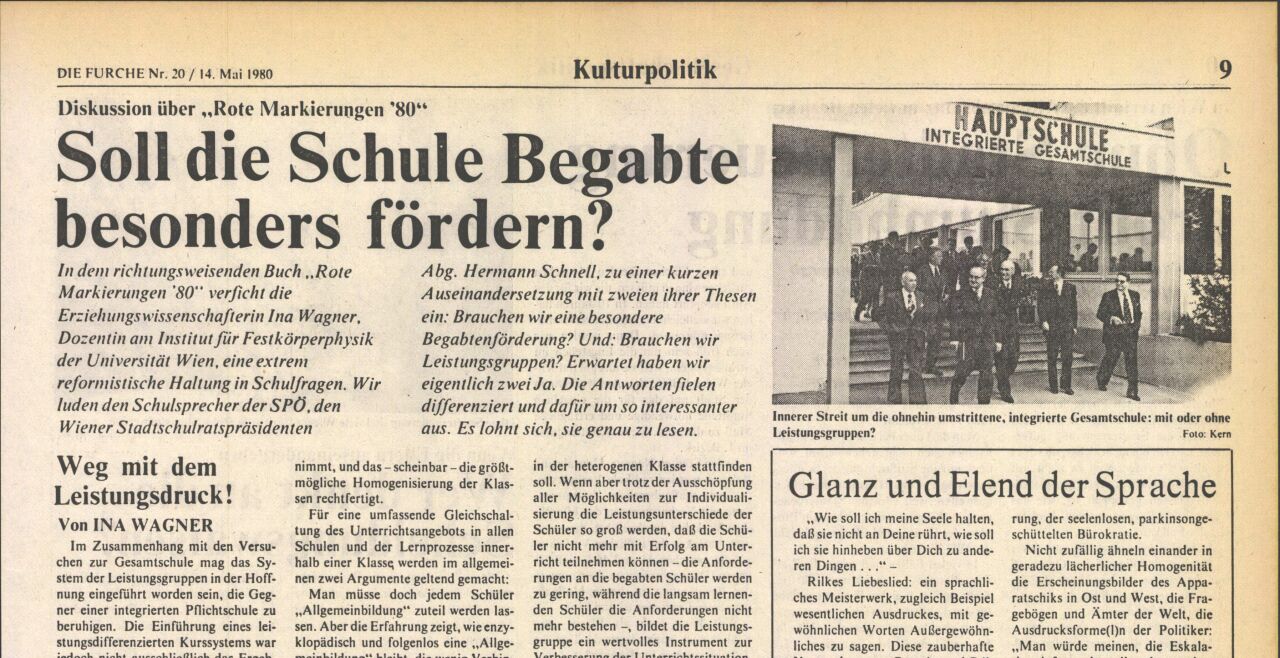
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Glanz und Elend der Sprache
„Wie soll ich meine Seele halten, daß sie nicht an Deine rührt, wie soll ich sie hinheben über Dich zu anderen Dingen ...” -
Rilkes Liebeslied: ein sprachliches Meisterwerk, zugleich Beispiel wesentlichen Ausdruckes, mit gewöhnlichen Worten Außergewöhnliches zu sagen. Diese zauberhafte Verwendung von Sprache und Stilmittel, dieser schöpferische Akt, aus der Vielfalt des Lebens facettengleich Begriffliches zu schaffen, stellt die bildhafte Verbindung her zwischen Gedanken und Ausdruck, zwischen dem Geistigen aller Menschen und Völker.
Immer schon waren aber auch Glanz und Macht der Sprache im Kampf der Nationen stählerne Waffen, nicht minder gewichtig denn Hellebarde und Schwert. Wie durchdrang langhin das geschmeidige Französisch als europäischer Kulturträger den gesamten Kontinent!
Die Mechanisierung, Nivellierung und gestaltlose, verwaschene, stereotypisierende Eigenart dieses Jahrhunderts brachte eine gefährliche Verarmung der Sprache und damit des Denkens mit sich.
Der armselige Wortschatz anspruchsloser Werbung, die schablonenhafte Verwendung hartnäckiger Modewörter begründen mit indolenter Beharrlichkeit, wie akut die schwindsüchtige Farblosigkeit zum Siechtum drängt, einer Sprache, die einem Goethe, einem Herder, Nietzsche und Schopenhauer noch als feinnerviges Instrument höchster Vollendung, diffizilster Mitteilung und Verkündigung diente. Die derzeitige Verfassung der Sprache widerspiegelt die Erstarrung unseres Denkens, die Erschlaffung der gesamten Geisteshaltung - die Tatsache unserer Resignation vor der anarchistischen Welt der Technisierung, der seelenlosen, parkinsongeschüttelten Bürokratie.
Nicht zufällig ähneln einander in geradezu lächerlicher Homogenität die Erscheinungsbilder des Appa-ratschiks in Ost und West, die Fragebögen und Ämter der Welt, die Ausdrucksforme(l)n der Politiker: „Man würde meinen, die Eskalation infrastruktureller, konzertierter Aktionen stehe im echten sozio-biologischen Kontrast zum Problem, wie seitens der wohlfahrtseigenen Gebietskörperschaften legitim pflegeleichte Schutzanzüge gegen strahlungsintensive Sprachverderbnis ausgegeben werden sollen.”
Könnte die nach Luther vollkommenste aller Sprachen jemals wieder den Wortschatz erweitern, die Art der Wortfolge stärker prägen, die freie Wortstellung, Betonung und Logik verfeinern, sollte sie wieder als die wahre Sprache der Philosophie gelten dürfen, sollte ihre mächtige Gestaltungskraft nicht in saftlosen Schablonen verkümmern, muß zuvörderst unser Denken wieder klarsichtig und ehrlich, unser Kampf gegen die oberflächliche Erbärmlichkeit und das Elend leeren Ausdrucks nachhaltig geführt werden.
Wie sagt Weinheber? Der Sprachverderber ist der eigentliche Hochverräter.
Verbessern wir unsere Gedanken, seien wir unnachsichtig gegen gestaltloses Geschwafel, ringen wir im Alltagsgespräch um den treffenderen, farbigen, besseren Ausdruck.
Sonst könnte nach hundert Jahren ein gebildeter Deutscher - befragt zum Wandel der Sprache - nur antworten: „Ich lachen, Du lachen, wer nicht lachen?” Und dies wäre dann nicht bloß anschaulich übertrieben um der Sprachgeschwächten willen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!