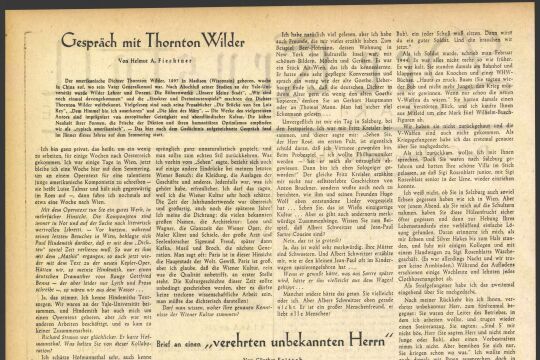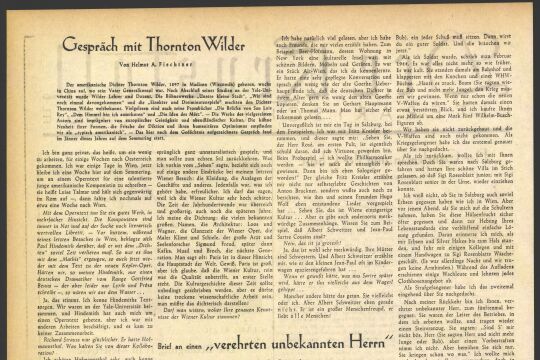Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gruppenbild mit Schattenseiten
Nicht länger als fünf Jahre - von 1933 bis 1938 - währte in Österreich das von Dollfuß und Schuschnigg geführte Regime, das entweder als Austrofaschismus oder als christlicher Ständestaat umschrieben wird. Von seiner Literatur wissen wir heute wenig. „Versunken und vergessen - das ist des Sängers Fluch"? Wer jene Zeit noch miterlebt hat, weiß, daß sie - trotz aller Schönheitsfehler, die mit einer Diktatur verbunden zu sein pflegen - fünf Jahre Aufschub vor der nationalsozialistischen Besetzung gebracht hat. Das bedeutete unter anderem viele gerettete Menschenleben, auch wenn man damals in Österreich eine Art verschlampten Operetten-Faschismus durchexerzieren mußte.
Die westlichen Demokratien rührten keinen Finger für das von Hitler bedrohte kleine Land. Einziger Protektor war Mussolini, und so mußte man sich vor ihm faschistisch gebärden. Als Hitler Dollfuß ermorden ließ, machte ein italienischer Brenner-Aufmarsch noch dem Putsch ein Ende. Als später Rom seine Hand abzog, war der Weg für Hitler frei. Zwischendurch ein kostümierter Spuk, bei dem man statt des Hakenkreuzes das Kruckenkreuz populär zu machen suchte und statt des Braunhemdes die graue Uniform der österreichischen Sturmscharen, wo nicht gar die Kluft der Heimwehren trug. Das Kostüm, das dem Staat verpaßt wurde, war eine ständische Verfassung, die niemals ernstlich in Kraft gesetzt wurde. Politisch kein sehr eindrucksvolles Bild. Wie haben sich unter diesem Regime die Musen entwickelt?
Friedbert Aspetsberger, Ordinarius der Germanistik in Klagenfurt, beleuchtet in einer Schrift, die seltsamerweise im Taunus erschien, die Literatur Österreichs während jener kurzen Ruhepause vor der Annexion Österreichs. Man weiß sehr wenig von ihr, denn das meiste, was damals dem Regime zuliebe geschrieben wurde, ist aus zweierlei Gründen vergessen: zum einen, weil seine Autoren ungern daran erinnert werden, zum anderen weil es in seinem Phrasenschwulst so gut wie unlesbar geworden ist. Hier gibt es also eine Menge zu entdecken und auszugraben -Aspetsberger tut es.
Sein „Aufhänger" erscheint allerdings etwas eigenwillig. Er rollt ein literaturhistorisches Panorama auf anhand des damals geschaffenen österreichischen Staatspreises (Vorbild des nach dem Krieg wiedererstandenen Preises). Tatsächlich haben die meisten der vom Regime protegierten Literaten entweder irgendeinmal diesen Preis erhalten oder als Juroren daran mitgewirkt. Es war eine wohl abgestimmte Freunderlwirtschaft, bei der eine Hand die andere wusch. Man blieb unter sich und entfaltete das Bild einer vaterländischen Blut- und Bodenliteratur.
Unter den Namen, die hier angeführt werden, befinden sich Wenter, Ortner, Max Meli, Karl Heinrich Waggerl, Rudolf Henz, Schreyvogl, Guido Zernatto und andere. Pikanterie am Rande: Wenter konnte einmal den Staatspreis nicht bekommen, weil eine dienstliche Meldung der Polizeidirektion Innsbruck ihn als stadtbekannten Nazi auswies. Folge: ein Jahr später hat er ihn dann doch bekommen.
Was Aspetsberger hier an Zitaten anführt, ist in der Tat lesenswert. So schwülstig und kitschig hätte man sich diese Prosa nicht vorgestellt. Es fällt aber auch auf, daß gerade die literarisch Begabtesten aus diesem Kreis hier ausgesprochen zu kurz kommen, so Guido Zernatto oder der mystische Lyriker Heinrich Suso Waldeck. Was aus dieser wechselseitigen literarischen Schadensversicherung nach dem Anschluß wurde, ist bemerkenswert. Henz hat sich hauptsächlich als Kunstrestaurator durchgebracht, bis er nach 1945 wieder daran gehen konnte, den österreichischen Rundfunk aufzubauen. Zernatto, der so etwas wie ein Chefideologe der Kultur im Ständestaat gewesen war, wählte den Weg in die Emigration und ist im Ausland gestorben. Der Schutzherr des geistigen Lebens im Ständestaat, der Unterrichtsminister Pernter, wurde ins KZ verschleppt.
Die meisten der vaterländischen Barden hatten allerdings nicht zu klagen, eher zujubeln. Sie priesen etwa im Tonfall „Mein Führer, habe Dank!" die neue Zeit. Sie konnten dabei sogar denselben geschwollenen Wortschatz verwenden, in dem sie vaterländisch gedichtet hatten, ehe sie völkisch wurden
die hier gebotenen Textproben sind verblüffend. Die Klüngelwirtschaft, die Robert Musil damals „Kulturpolitikskultur" genannt hat, mutet an wie eine tragische Operette.'
Und dennoch ist dieses literarhistorische Portrait einer kurzlebigen Epoche verzeichnet, denn - um mit Nestroy zu sprechen - man sieht viele, die nicht da sind. Aspetsbergers Gruppenbild mit Staatspreisträgern läßt außer Betracht, daß es im damaligen Österreich noch sehr viel anderes an literarischem Leben gegeben hat, das sich nicht um die paar Zeitschriften der staatlichen Protektionskinder geschart hat. Daß sich Karl Kraus fürdas Dollfuß-Regimeausgesprochen hat, weil er nur in ihm eine Rettung vor Hitler sah, wird immerhin am Rande erwähnt. Aber im damaligen Österreich schrieb Franz Theodor Csokor sein bestes - und am Burgtheater überaus erfolgreiches - Stück, den „3. November 1918" mit einer eminent österreichischen Problematik, die das vaterländische Regime sehr wohl für seine Ideologie vereinnahmen konnte.
Da schuf Zuckmayer in Henndorf „Salwäre", während sein „Schelm von Bergen" an der Burg lief, und der junge Horvath kam immerhin an Kleinbühnen zu Wort. Ernst Lothar trat zwar als Dichter weniger hervor, war aber als Direktor des Theaters in der Josefstadt eine eminent wichtige Figur im literarischen Leben. Franz Werfel, damals gerade mit der „Verdi-Renaissance" an der Staatsoper beschäftigt, gehörte zum Freundeskreis Schuschniggs und bekannte sich auch in Vorträgen zur österreichischen Mentalität dieser Jahre. Und wenn es auch nicht zur Literatur, sondern zur Musik gehört, soll doch nicht vergessen werden, daß Schuschnigg ein eminent musikalischer Mensch war, der der Wiener Staatsoper ebenso viel Förderung angedeihen ließ, wie den Salzburger Festspielen, wo der aus dem faschistischen Italien geflohene Toscanini und Bruno Walter den Ton angaben und eine Art musisches Auslagenfenster des bedrohten Kleinstaates arrangierten.
Daß es mit einer faschistischen Meinungszensur nicht weit her war, konnte ein jubelndes Publikum allabendlich in den aus dem Boden - oder richtiger in den Boden hinein - sprießenden Kleinkunstbühnen erleben, so etwa in der „Literatur am Naschmarkt", wo Rudolf Weys, Hans Weigel und andere Erstaunliches an Kritik zuwege brachten.
Aspetsberger zitiert ausführlich Zeitschriften wie den „Augarten quot;, die als eine Art Parteiorgan der Staatspreisträger-Clique figurierten. Nicht präsent ist in dieser Aufzählung Ernst Schönwiese, in dessen „Silberboot" damals Musil, Kafka, Broch, Urzidil u. a. laufend zu Wort kamen. Das treffendste Wort zu dieser Art von österreichisch verschlamptem Faschismus hat Robert Musil in einem in Wien öffentlich gehaltenen Vortrag gesprochen: daß dem freien Geist „wirklich kein Haar gekrümmt worden ist, daß er aber auch nicht gerade der staatlichen Haarwuchsmittel teilhaftig wird". Es gab also abseits des offiziell geförderten Klüngels damals eine Reihe sehr bedeutender literarischer Persönlichkeitenwir würden wünschen, wir hätten heute eine solche Fülle davon! Robert Musil, der seine Abrechnung mit dem Zeitgeist in seinem dann als Essay veröffentlichten Vortrag „Uber die Dummheit" abhielt, war zwar kein Protege der „Kulturpolitikskultur", konnte aber dank dem Mäzenatentum privater Freunde die Arbeit an dem „Mann ohne Eigenschaften" fortführen.
Wenn diese Studie sich immer wieder auf offiziell geförderte, aber doch eher periphere Zeitschriften wie den „Augarten" oder „die pause" stützt, dürfte doch nicht übersehen werden, daß die wahren Literaturpäpste der Zeit in den damals noch sehr angesehenen Wiener Zeitungen saßen, etwa in der „Neuen Freien Presse", dem „Tagblatt", dem „Wiener Tag", und dort schrieben ganz andere Leute als der hier geschilderte Clan. Edwin Rollett etwa hat damals die Sonntagsbeilage der „Wiener Zeitung" zu einem sehr repräsentativen Querschnitt durch die österreichische Kultur ausgebaut.
Es gab also sehr wohl beachtenswerte literarische Aktivitäten, auch wenn der Vordergrund von Gestalten wie Wenter und Ortner beherrscht wurde, die dann mit fliegenden Fahnen ins braune Lager übersiedelten. Dennoch ist diese Studie lesenswert, weil sie ein makabres Schattenspielmitgrotesken Schlaglichtern beschwört um Autoren, die inzwischen längst vergessen sind.
LITERARISCHES LEBEN IM AUSTROFASCHISMUS. Von Friedbert Aspetsberger. Verlag Anton Hain, Königstein/Taunus, 222 Seiten, öS 369,50.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!