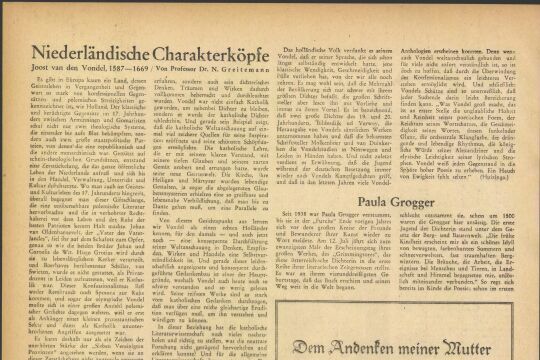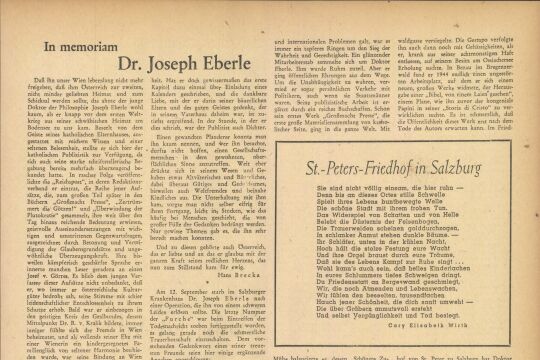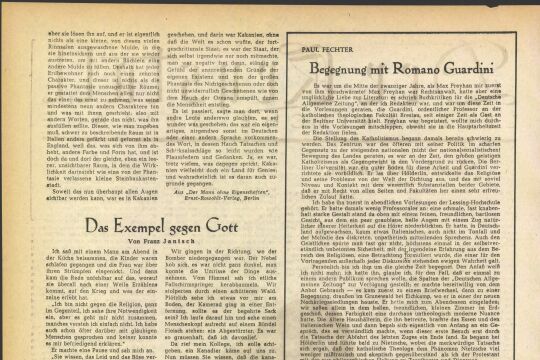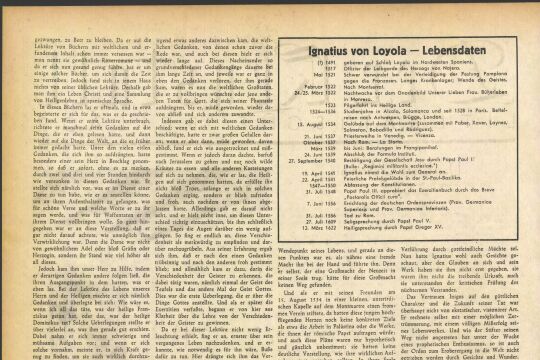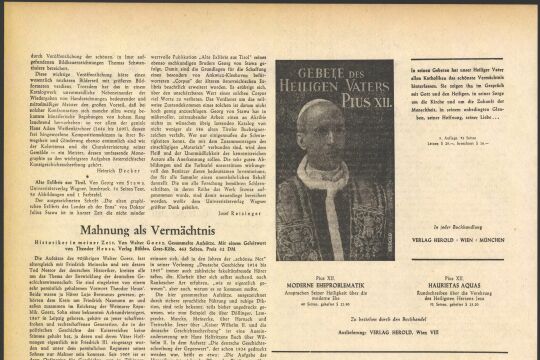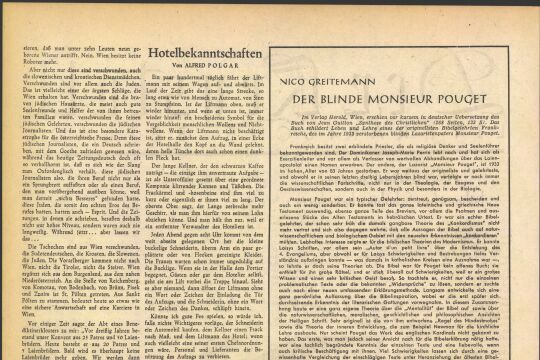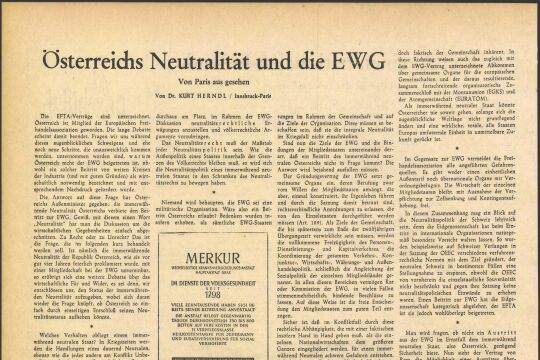Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Guardini — was bleibt ?
Vor 100 Jahren, am 17. Februar 1885, wurde Romano Guardini geboren. Haben die Werke dieser großen Theologenpersönlichkeit auch unseier Zeit etwas zu sagen?
Vor 100 Jahren, am 17. Februar 1885, wurde Romano Guardini geboren. Haben die Werke dieser großen Theologenpersönlichkeit auch unseier Zeit etwas zu sagen?
Wenn man heute, in diesem „Flachland des Geistes”, von dem schon Nietzsche gesprochen hat, nach herausragenden Gestalten Ausschau hält, fällt der Blick nach Albert Schweitzer und Martin Buber nicht zuletzt auf Romano Guardini. Geboren in Verona, dieser Schnittstelle des romanischen und germanischen Kulturkreises, ah sich Guardini zeitlebens dazu berufen, die Gegensätze des Daseins geistig zu verarbeiten und lebendig auszuhalten. Und vermutlich besteht nicht zuletzt darin das Geheimnis seiner Ausstrahlung, die ihm bis ins hohe Alter bewahrt blieb und die Hörer scharenweise zu seinen Vorlesungen und Predigten lockte.
Dabei stand sein Anfang im Zeichen tastender Versuche. Erst auf dem Umweg über natur-und wirtschaftswissenschaftliche Studien fand er zur Theologie; und die Erinnerungen, die er an die konfliktreichen Jahre in Tübingen und im Mainzer Priesterseminar bewahrte, gehörten keineswegs zu den erfreulichsten seines Lebens. Indessen war ihm aufgegangen, daß nur derjenige, der sein Leben einsetzt, es wirklich bewahrt; und mit dieser Erkenntnis, die einer Entscheidung für die Kirche gleichkam, gewann er den festen Standpunkt für sein gesamtes Denken und Wirken.
Bestimmend wurde für ihn die Fühlung mit der Quickborn-Bewegung und die Teilnahme an ihren Treffen auf der Burg Rothenfels. Denn hier entdeckte er den Reichtum der Liturgie und den Menschen, jenseits aller Zweckrationalität, als Kultwesen. Erste Schriften, die seinen Namen rasch im ganzen deutschen Sprachraum bekannt machten, gaben dieser Entdeckung Ausdruck.
Die tiefste Zäsur seines Lebens brachte jedoch die Berufung auf den neuerrichteten Lehrstuhl für „Katholische Religionsphilosophie und Weltanschauung” an der Universität Berlin. Mit der Umschreibung dieses Lehrstuhls stellte sich ihm seine geistige Lebensaufgabe, wie sie ihm entscheidend durch den Philosophen Max Scheler deutlich gemacht worden war: die konkrete Weltwirklichkeit mit den Augen des christlichen Glaubens zu sehen und für andere sichtbar zu machen.
In ständiger Umkreisung der großen Themenfelder Welt, Mensch und Gott suchte Guardini, unbeirrt durch die gewaltigen politischen Umbrüche,', dieser Aufgabe mit erstaunlicher Beharrlichkeit bis zum Erlöschen seiner geistigen Kräfte zu genügen. Als kompromißloser Gegner des aufkommenden Totalitaris-mus führte ihn sein Weg dann freilich für mehrere Jahre nach Aufhebung seines Berliner Lehrstuhls in die innere Emigration, nachdem das nationalsozialistische Regime auch noch die Schließung von Burg Rothenfels verfügt hatte.
Demgemäß war es Romano Guardini, in dem die katholische Theologie nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit am raschesten ihre Sprache wiederfand. Nach einer kürzeren Lehrtätigkeit in Tübingen übernahm er 1948 den für ihn wiederum neu errichteten Lehrstuhl für Christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie an der Universität
München, den er erst als Hochbetagter infolge eines quälenden Nervenleidens aufgab. Nach Jahren wachsender Verdüsterung, aber gestützt auf einen großen Kreis ihm treu ergebener Freunde und Bewunderer, starb er bei Ausbruch der Studentenrevolte am 1. Oktober 1968 in München.
Wenn man sich fragt, was Guardinis mächtig anschwellender literarischer Produktion die mächtige Resonanz einbrachte, wird man drei Momente beachten müssen.
Zunächst half Guardini seinen Lesern Dinge entdecken und sehen, die sie vorher nicht oder kaum beachtet hatten. Sprechender Beleg dessen ist seine weltberühmt gewordene Schrift „Von heiligen Zeichen” (von 1927), mit der er vielen den Reichtum der Liturgie und der kultischen Feier neu erschloß.
Gleichzeitig verhalf Guardini, der sich immer in erster Linie als Erzieher verstand, seinen Lesern aber auch zu einem vertieften Verständnis ihrer selbst. Dem hatte er schon durch seine philosophische Grundschrift über den „Gegensatz” (von 1925) vorgearbeitet; und diesem Ziel dienten dann insbesondere die der Erkundung des Menschseins gewidmeten Schriften „Welt und Person” (von 1940) und „Freiheit, Gnade, Schicksal” (von 1948).
Und schließlich redete er von alledem nicht in einem fachwissenschaftlichen Idiom, sondern in einer ebenso verständlichen wie gepflegten, an Goethe und Rilke geschulten Sprache.
Guardini war es aber nicht nur um eine vertiefte Sicht der Welt-und Lebenswirklichkeit zu tun. Zu einer Zeit, als sich die zunehmend unter politischen Druck geratenen Kirchen auf Verteidigungspositionen zurückzogen,betrieb er vielmehr konsequent das Werk einer christlichen Horizonterweiterung, weil ihm damals schon klargeworden war, daß die großen Herausforderungen durch die sich rapide wandelnde Welt nur im offenen Dialog bestanden werden konnten.
Was „christliche Weltanschauung” sei, ließ er sich deshalb vor allem im interpretatorischen Gespräch von großen Gestalten der Geistesgeschichte sagen, von denen ihm nach Ausweis seiner Schriften vor allem Piaton (Der Tod des Sokrates), Augustinus (Die Bekehrung des Aurelius Augustinus), Dante (Der Engel in Dantes Göttlicher Komödie), Pascal (Christliches Bewußtsein), Hölderlin (Weltbild und Frömmigkeit), Dostojewskij (Der Mensch und der Glaube), Rilke und Mörike wichtig wurden.
Kontrapunktisch dazu arbeitete Guardini aber auch auf die Konzentration des Glaubensbewußtseins hin. Nachdem er in seiner grundlegenden Schrift „Vom Sinn der Kirche” (von 1922) ein betont innerliches Bild von Christentum und Kirche entworfen hatte, wandte er sich in nicht weniger als drei Schriften, von denen die Meditationsfolge unter dem Titel „Der Herr” (von 1937) Weltruhm erlangte, dem christologi-schen Zentralgeheimnis des Glaubens zu.
Wie er im Vorwort seiner Studie „Jesus Christus. Sein Bild in den Schriften des Neuen Testaments” (von 1940) feststellt, hatte er die großen Interpretationen im Grunde nur deshalb verfaßt, um im Umgang mit den geistigen Schlüsselfiguren das Instrumentarium für eine zulängliche Erschließung der Gestalt Jesu zu gewinnen. Daß er gleichwohl das erzieherische Interesse am Menschen nicht aus dem Auge verlor, beweist das aus dem Nachlaß veröffentlichte umfangreiche Werk „Die Existenz des Christen” (von 1976).
Dennoch behielt die „Sorge um den Menschen”, wie er eine späte
Schriftensammlung überschrieb, bei ihm nicht das letzte Wort. Vielmehr schrieb er in einem seiner nachgelassenen „Theologischen Briefe an einen Freund” (von 1976) zu der Frage nach dem leitenden Interesse der Theologie den bemerkenswerten Satz: „In der Regel scheint es die Sorge um das Heil des Menschen zu sein... Ist es aber das im Letzten Entscheidende? Müßte der Theologe nicht vor allem um Gott Sorge tragen?”
Unwillkürlich stellt Guardini mit dieser Frage zusammen auch die nach seinem eigenen Fortwirken in der Gegenwart. Sie stellt sich in seinem Fall sogar mit besonderer Dringlichkeit; und dies aus zwei Gründen. Denn einmal scheint die Geschichte dadurch einen gerechten Ausgleich zu schaffen, daß sie denen, die sie bei Lebzeiten mit einer großen Breitenwirkung bedachte, diese Wirkung nur für eine befristete Zeitdauer zugesteht, während sie andere, die zunächst im Schatten standen, später um so nachdrücklicher auf den Leuchter stellt.
Nicht umsonst verstand Guardini seine Arbeiten selbst als „Gelegenheitsarbeiten”, die ihm durch die Notwendigkeit der jeweiligen Stunde eingegeben und abgenötigt worden waren und deshalb in erster Linie auch für den Augenblick ihrer Entstehung bestimmt blieben.
„Dennoch behält er auch für die Gegenwart paradigmatische Bedeutung.”
Sodann gehört es zum Schicksal derer, die einen Weg bahnen, daß andere auf ihm weiter vorankommen als sie selbst, so daß sie ungeachtet ihrer Pionierleistung in den Hintergrund treten. Auch läßt sich nicht übersehen, daß Guardini, vornehmlich aus pädagogischen Gründen, wohl aber auch mit Rücksicht auf die repressiven Bedingungen während seiner früheren Schaffensjahre vielfach nicht so weit ging, wie es nach seinen eigenen Prämissen her gefordert war.
Auch war Guardini mehr ein Denker des Raums und des Bildes als der Zeit und des Wortes. Und das bringt ihn zu dem gegenwärtig herrschenden Zug des Denkens auf eine nur schwer zu überbrückende Distanz. Dennoch behält er, gerade in der Distanz, auch für die Gegenwart paradigmatische Bedeutung. Zwar könnte der Satz, mit dem er der durch den Ersten Weltkrieg verunsicherten Jugend das Stichwort ihrer religiösen Sinnfindung zurief — „Die Kirche erwacht in den Seelen!” - heute in dieser Form nicht nachgesprochen werden; paradigmatisch aber bleibt, daß es ihm gelang, das religiöse Grunderlebnis der Zeit auf eine einzige und dazu noch unmittelbar ansprechende Formel zu bringen.
Ebenso dürfte seiner Strukturanalyse des menschlichen Existenzraums kaum eine Nachwirkung beschieden sein; dennoch stieß er mit der Forderung der „Annahme seiner selbst” (von 1960) ins Zentrum der heutigen Existenzerfahrung. Schließlich wird man nicht übersehen dürfen, daß Guardini mit seinen Christusbüchern dem gegenwärtigen Gespräch über Jesus wichtige Anstöße gab, und daß er durch seine liturgischen Schriften die Entscheidungen des Zweiten Vatikanischen Konzils zur Neugestaltung des Gottesdienstes entscheidend mitbestimmte.
Vor allem aber ist er, der für unzählige seiner Hörer und Bewunderer zur prägenden Orientierungsfigur wurde, für die heutige Jugend Anlaß, sich nicht zu den von der Konsumindustrie angebotenen Klischees überreden zu lassen, sondern nach jenen Vorbildern Ausschau zu halten, die glaubhafte Orientierung bieten und dadurch zu einem sinnerfüllten Leben verhelfen.
Univ.-Prof. DDr. Eugen Biser leitet das Seminar für Christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie an der Universität München.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!