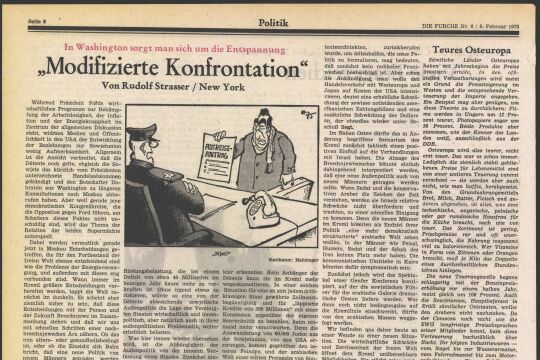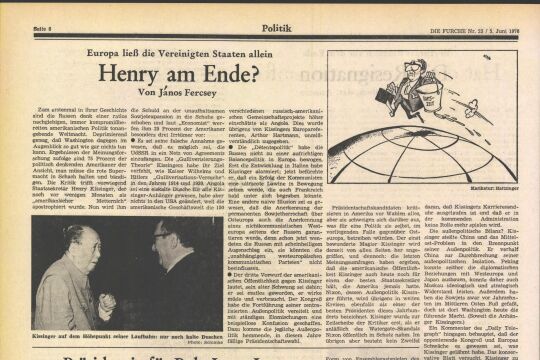Das politische Szenarium, in dem sich der Wahlkampf dieses Jahres 1976 abspielt, unterscheidet sich wesentlich von dem, was noch vor sechs Monaten Politiker verschiedenster Schattierungen veranlaßte, zu kandidieren oder, wie es hierzulande heißt, „den Hut in den Ring werfen“. Die wesentliche Änderung betrifft den Zustand der amerikanischen Wirtschaft.
Lastete im vorigen Herbst noch Ungewißheit über die Entwicklung der Wirtschaft schwer auf dem Lande, so ist es heute bereits jedermann klar, daß der Tiefpunkt der Rezession schon weit zurückliegt. Diese Feststellung treffen nicht nur Theoretiker, man fühlt den Boom auch, wenn man durch Warenhäuser oder Supermarkets geht. Dementsprechend sind auch jene Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, die ihre Kampagne auf Brot- und Butterargumente aufgebaut hatten, zurückgefallen oder bereits ausgeschieden, während Kandidaten, die gegen das unkontrollierte Wachstum der Bürokratie zu Felde ziehen oder sich in außenpolitische Probleme verbeißen, mehr Erfolg haben. Nicht zuletzt hat diese günstige Entwicklung der Wirtschaft wesentlich dazu beigetragen, Präsident Fords Position zu stärken und die Herausforderung Exgouverneur Reagans abzuwehren.
Der Angriff auf die Wirtschaftspolitik der Regierung ist freilich noch nicht abgeblasen. Noch sind sieben Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung arbeitslos und man kann, wie demokratische Politiker es formulieren, noch immer ertrinken, auch wenn man nicht mehr zehn Meter tief unter Wasser ist, sondern nur deren zwei. Aber die Inflation, auf Jahresdurchschnitt berechnet, liegt unter fünf Prozent und da ein viel größerer Teil des Elektorats Angst vor einem neuerlichen Wettlauf der Löhne und Preise hat als vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, finden die noch immer von liberalen Politikern geforderten Arbeitsbeschaffungsprogramme wenig Anklang.
Jener Politiker, der momentan noch in den Kulissen steht und darauf wartet, daß sich die augenblicklich führenden Demokraten die Stimmen und Delegierten für den zu nominierenden Kongreß so teilen, daß keiner die notwendige Majorität erhält — Hubert Humphrey nämlich —, scheint hingegen immer noch auf die wirtschaftliche Karte zu setzen. Schon seit der vernichtenden Niederlage Hoovers während der großen Rezession galten die Republikaner als „wirtschaftlich verwundbar“. Humphrey will es offenbar- nochmals versuchen, trotz des geänderten Szenariums. Nun darf nicht übersehen werden, daß Humphrey als Vizepräsident Johnsons für die Ausweitung des Vietnamkrieges mitverantwortlich ist, so daß er „in der Außenpolitik wenig zu suchen hat“. Er ist dort ebenso „verwundbar“ wie in dem ganzen Komplex „Watergate und die Moral in der Politik“. Auch er hat, wie Nixon, die zulässigen Grenzen bei der Wahlfinanzierung überschritten und von speziellen Interessentengruppen Wahlspenden entgegengenommen, die als ülegal gelten. Auch er hat versucht, seine als Vizepräsident gesammelten Aufzeichnungen gegen Steuerrefundierung zu verschenken. Seine politische Weste ist also nicht rein. Nur, daß eine auf Nixon eingeschossene linke Presse Humphrey mehr oder weniger ausklammerte oder, wenn sie schon über Untersuchungsergebnisse berichten mußte, diese irgendwo „unter dem Strich“ verschwinden ließ. In einem schonungslosen Wahlkampf würden jedoch solche an sich meritorisch unwichtige Details aufgeblasen werden und könnten im heutigen Klima der Moralisierung und Selbstbezichtigung äußerst nachteilig'sein. Wenn Humphrey nominiert wird, müßte er daher „wirtschaftlich“ angreifen; aber mit zunehmender wirtschaft-
cen, Kandidat der Demokraten zu werden.
Somit verbleibt die Außenpolitik als eines der dominierenden Wahlthemen dieses Jahres. Das ist eigentlich um so erstaunlicher, als die amerikanische Bevölkerung recht wenig Interesse und Verständnis für außenpolitische Zusammenhänge aufbringt. Das ist nicht nur eine Auswirkung der Niederlage in Vietnam, wo man sich, wie man meint, die Finger verbrannte, weil man von den Problemen Asiens nichts verstand, sondern vielfach noch ein Auswuchs überheblicher Einschätzung der eigenen Macht und Größe. Wann immer die USA in eine isolationistische Phase ihrer Geschichte schlitterten, lag dieser Entwicklung die Überlegung zugrunde: „Was geht uns schon die übrige Welt an? Wir sind ein autarker Kontinent, niemand kann uns ernstlich bedrohen.“ Obwohl diese Argumentation heute überhaupt nicht mehr stimmt — die USA führen bereits 50 Prozent ihres Energiebedarfes ein —, schwingt auch heute noch im Verhalten der Amerikaner etwas von diesem Mythos der Überheblichkeit mit. Und wenn man Vertreter dieser Denkungsart auf die Kette außenpolitischer Niederlagen verweist, dann heißt es zumeist: „Das ist doch vollkommen uninteressant, wenn wir einmal in unserer Hemisphäre angegriffen werden sollten, dann würde die Verteidigungsreaktion der Bevölkerung überwältigend sein. Dann kann Amerika, wie nach Pearl Harbour, wieder Wunder an Rüstung und Abwehr vollbringen.“ Wenn aber niemand angreift und der Verschleiß unkontrollierbar weitergeht? „Dann wird das Pendel eines Tages zurückschlagen.“
Inzwischen aber bleibt die Außenpolitik noch immer das Hobby von Professoren, Journalisten oder professionellen Diplomaten. Sichtbares Symbol amerikanischer Außenpolitik ist Außenminister Kissinger, auf den man sich rechts und links aus entgegengesetzten Gründen einschießt.
Wir wollen zunächst jene Gegner ausklammern, die in Kissinger den verhaßten Weggefährten des erfolgreichen Außenpolitikers Nixon sehen und bei allen Untersuchungen gegen CIA oder FBI über ihn stolpern. Manche Kenner der wirklichen Hintergründe der CIA-Untersuchung behaupten, den Parlamentariern, die sich hier vordrängen, vor allem dem neuesten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Senator Church und dem Abgeordneten Pike, gehe es lediglich um die Eliminierung Kissingers und überhaupt nicht um den CIA.
Wenn man aber von dieser mächtigen Gruppe absieht, einigen sich Links und Rechts auf die Formel, Kissinger habe die Russen in seiner Detentepolitik zu große Konzessionen gemacht. Der damit ausgeübte Druck ist so mächtig, daß Präsident Ford das Wort Detente, das dem Durchschnittsamerikaner sowieso fremd ist, aus seinem Vokabular gestrichen hat. Die Politik gegenüber Rußland heißt jetzt „Friede durch Stärke“ und daran kann eigentlich keiner etwas aussetzen. „Was hat uns die Detente gebracht?“, fragen Reagan, der republikanische Herausforderer Fords, oder Jackson, der konservativste Demokrat. „Die Sowjets legen die Abmachungen von Helsinki zu ihren Gunsten aus, sie beschwindeln uns bei der Atomwaffenkontrolle, sie intervenieren durch ihre kubanischen Milizen in Angola, und zu alldem finden sie diese Politik auch noch richtig und kündigen auf ihrem Parteitag mehr dergleichen an.“
Laut Jimmi Carter, dem Novizen und derzeitigen Favoriten der Demokraten, dessen außenpolitischer Horizont bisher noch nicht getestet wurde, betreibt Kissinger eine gefährliche Geheimpolitik, in die niemand Einblick nehmen könne. Nach Carter sollte der Kongreß noch mehr Einfluß auf die Außenpolitik nehmen.
Man kann sich vorstellen, wohin
aas tunren wurae, aa jsjssinger serc mehr als einem Jahr im offenen Kampf mit dem Kongreß liegt, der die meisten seiner Initiativen blok-kiert hat. Es ist heute soweit, daß der Außenminister in seiner internationalen Verhandlungstätigkeit schwerstens beeinträchtigt ist, weil seine Verhandlungspartner nicht mehr wissen, ob der Kongreß dem zustimmen wird, was der Außen-
minister versprochen hat. Carter glaubt auch hier, wie in allen anderen Fragen, die breiten Massen zu interessieren, er versucht immer, in der Hauptströmung der öffentlichen Meinung zu schwimmen.
An sich wissen informierte und objektiv denkende Demokraten genau, daß es in der jetzigen Phase amerikanischer Geschichte zur Detente — oder wie immer diese Politik genannt wird — keine Alternative gibt. Es waren ja die Demokraten, schon seit Roosevelt, die den Ausgleich mit der Sowjetunion predigten. Es ist noch nicht so lange her, daß ein Goldwater der Kriegstreiberei bezichtigt wurde und „der alte Nixon“ als bankrotter Söldling des kalten Krieges. Erst als der „neue Nixon“, in Erkenntnis der Gegebenheiten, auf Detente umschwenkte, wurde diese Politik für die Demokraten plötzlich zu einem „Herschenken ohne Gegenleistung“.
Zur Zeit ist das amerikanische Volk, gerade wegen seiner immer stärker auftretenden isolationistischen Tendenzen, weder materiell noch moralisch willens, eine Politik der Konfrontation zu honorieren. Admiral Zumwalt, einer jener alten Haudegen vom rechten Flügel des politischen Spektrums, ist ein erbitterter Gegner Kissingers. In einer soeben veröffentlichten Publikation versucht er, Kissinger bloßzustellen, indem er ihm insinuiert, die USA als Großmacht abgeschrieben zu haben. Er glaube, mit der Demente noch das Beste für die absteigende Nation herausholen zu können. Obwohl Zumwalt mit dieser Insinuierung Kissinger bloßstellen wollte, dürfte er den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Er irrt auch, wenn er meint, damit die öffentiche Meinung gegen den Außenminister mobilisieren zu können. Denn alle Angriffe auf Kissinger hatten bisher geringe Tiefenwirkung. Meinungsbefragungen ge-
ben Kissinger immer noch mehr als 50 Prozent Zustimmung zu seiner Amtstätigkeit, und das ist angesichts des Trommelfeuers, unter dem er arbeitet, erheblich. Zuletzt dürfte Ägyptens Bruch mit der Sowjetunion die Position des Außenministers gestärkt und von den Rückschlägen in Europa und Afrika abgelenkt haben.
Da Außenpolitik die Kunst ist, mit dem Vorhandenen und Möglichen zu operieren, dürften die Angriffe von rechts bald in sich zusammenbrechen. Nicht nur steht es um Reagans Nominierungschancen
schlecht, nicht nur liegt Jackson weit hinter Carter, sondern auch dem gesunden Menschenverstand müssen die Möglichkeiten der amerikanischen Außenpolitik einleuchten. Wie sollte etwa eine amerikanische Milizarmee, die zu einem großen Prozentsatz aus Negern besteht, in Afrika eingesetzt werden?
Eher ist noch der Vorwurf gegen Kissinger stichhältig, daß er unter dem Druck der Kritik nur hohle Drohungen gegen Castro ausstoße, der ja in Afrika nur ein sowjetisches Vollzugsorgan ist, oder daß Kissinger irrelevante Komiteesitzungen mit sowjetischen Partnern absagt, während er zugleich mit aller Energie nach einem Abrüstungsabkommen strebt. Solche Abweichungen vom außenpolitischen Kurs schwächen, weil unglaubwürdig, seine Position und stärken jene seiner Gegner, die fühlen, daß ihre Angriffe Wirkungen zeitigen.
Die amerikanische Außenpolitik dürfte somit in diesem Wahljahr zu einem der Hauptthemen werden. Es ist zu hoffen, daß die ausgedehnte Diskussion auch den bisher wenig Interessierten die Augen für Zusammenhänge öffnen wird, obwohl die Streitgespräche vorläufig nur die oberste Oberfläche berührt haben.



































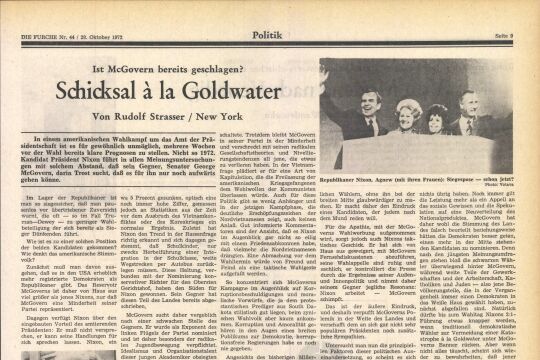


















.jpg)