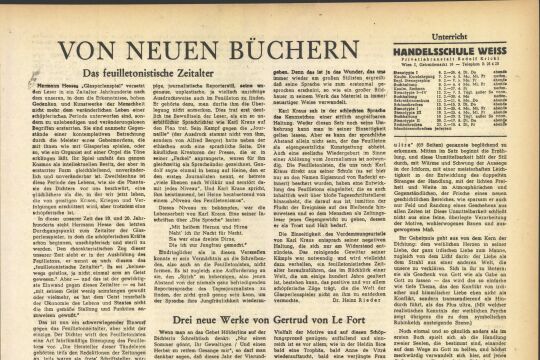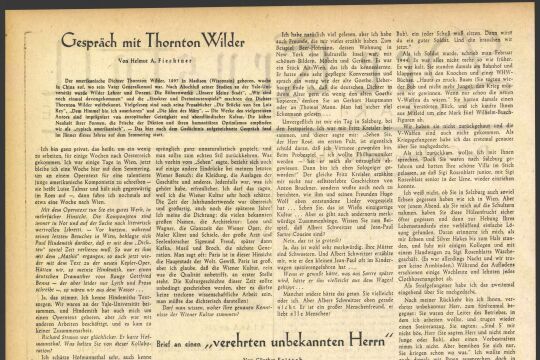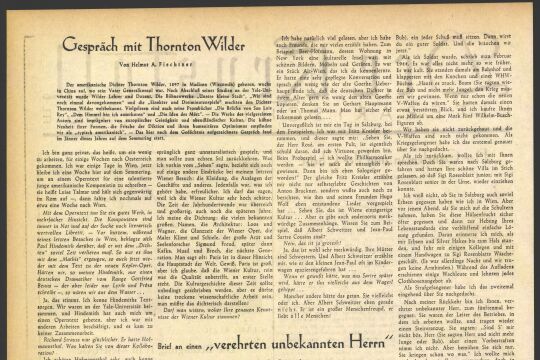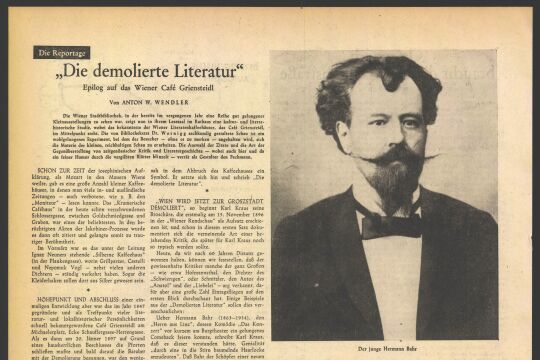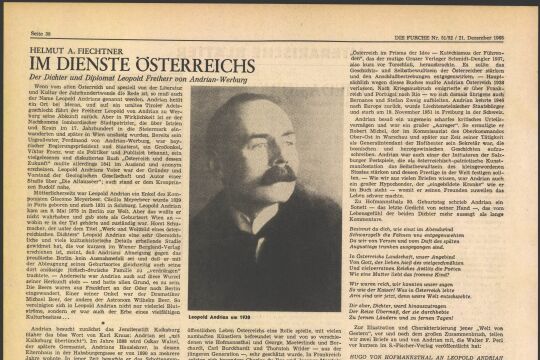Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Kampf gegen die Lüge
Die Stelle, die diesem Gedenkaufsatz als Motto dient, oft und oft zitiert, steht im programmatischen Leitartikel für die erste Nummer seiner Zeitschrift „Die Fackel“. Sie wurde zur Sensation des Tages und machte binnen kurzem derartiges Aufsehen, daß nach zehn Tagen 30.000 Exemplare verkauft waren. Sogar ihr Erscheinungsrhythmus war polemisch: Sie kam nur dreimal monatlich heraus, und das richtete sich gegen den „Zeitungsstempel“, eine neue Steuer, die riUr von Tages- oder Wochenblättern ein-
gehoben wurde. Erst später erschien sie „in zwangloser Folge“, weü der Herausgeber und (ab 1911) alleinige Autor des Organs sich als Künstler auf keinen Termin festlegen ließ.
Kraus schrieb leicht und schnell, aber er korrigierte dann lange und unermüdlich. Zwölf und mehr Fassungen jedes Artikels waren die Regel: Die in der österreichischen Nationalbibliothek und in der Wiener Stadtbibliothek archivierten Druckfahnen beweisen es. Doch wenn er später einzelne Essays oder Glossen seiner Zeitschrift zu Auswahlbänden sammelte, begann das Uberarbeiten von neuem.
Vor siebzig Jahren — es wurde gerade der Erste Weltkrieg geprobt - schrieb er: „Paternoster heißt ein Lift. Bethlehem ist ein Ort in Amerika, wo sich die größte Munitionsfabrik befindet.“ Damals arbeitete er an seinem dritten Aphorismenband und nannte ihn „Nachts“: denn er schrieb nachts, und Nacht war es in einer schier entmenscht kriegerischen Menschenwelt. Sein literarisches Glaubensbekenntnis: „Wort und Wesen — das ist die einzige Verbindung, die ich je im Leben angestrebt habe.“ In einer Zeitung las er einen burschikos-vulgären Ausdruck für die Offensive, die gerade im Gang war, zitierte ihn und wollte ihn nicht wahrhaben: „ ,Es wird weiter gedroschen.' Nein, so grausam sind wir nicht. Immer noch mehr Phrasen als Menschen!“
•X^arl Kraus heute? Die Frage JL\jst nicht einfach und darf nicht vordergründig beantwortet werden. Es geht also überhaupt nicht darum, daß 1974 zu seinem hundertsten Geburtstag eine Kraus-Woche in Wien abgehalten wurde, daß „Die letzten Tage der Menschheit“ mehrfach — in sehr umstrittenen Inszenierungen - da und dort aufgeführt wurden, daß
es in London 1984 ein großartiges Kraus-Symposion gab, dessen Vortragstexte unlängst in Buchform (Edition Text + Kritik, München 1986) herausgekommen sind, daß es seit 1977 die Quartalszeitschrift „Kraus Hefte“ gibt, oder daß im Mai dieses Jahres auch in Wien wieder Karl Kraus j, vier Tage lang kongreßmäßig zur Debatte stand; und es geht nicht einmal darum, daß seit gut zehn Jahren die 37 Jahrgänge seiner Zeitschrift „Die Fackel“ (rund 20.000 Seiten) als Reprint zu haben sind, daß bei Kösel/München eine siebzehnbändige Ausgabe „Gesammelte Werke“ vorliegt und nun die Verlage Suhrkamp (Frankfurt am Main) und Locker (Wien) eine kommentierte (sozusagen: historisch-kritische) Ausgabe der Schriften Von Karl Kraus planen. Denn das alles ist heute Mode: in einer druckfreudigen und schlechtweg kongreßsüchtigen Epoche.
Das Kardinalproblem ist hintergründig und wissenschaftlich bisher kaum noch angeschnitten: Karl Kraus und die Folgen.
Hofmannsthals sogenannter „Chandos-Brief“ (1901) gab einem Sprachzweifel an den ästhetischen Bemühungen im neuen Jahrhundert ergreifenden Ausdruck, ist viel interpretiert, beredet und auch zerredet worden. Der Sprachzweifel des jungen Karl Kraus, schon zwei Jahre früher definiert, richtete sich — umgekehrt - gegen den Untergang des Denkens im allgemeinen Phrasensumpf. Kraus hielt wenig oder gar nichts von einer Verteidigung der Kunst; er attackierte — um sie zu retten — ihr banales und banalisierendes Gegenteil, denn, so Karl Kraus später: „Es gibt keinen so Positiven wie den Künstler, dessen Stoff das Übel ist. Er erlöst von dem Übel. Jeder andere lenkt davon nur ab und läßt es in der Welt, welche dann das schutzlose Gefühl umso härter angreift.“
Der Stabreim „Wort und Wesen“, von Kraus vor siebzig Jahren ausgesprochen, um alles Ungereimte zwischen der Welt und dem zu deuten, wie sie zur Spra-
che kommt: als beinahe unüberbrückbar gefährliche Diskrepanz ist solche Kluft mittlerweüe ein Hauptthema der Literatur geworden. Der genaue Kraus-Kenner und große Epiker Hermann Broch hat das scheinbar Unmögliche, auf eigene Art, möglich zu machen versucht, immer (wie einen Kompaß) den Zweifel im Bewußtsein, ob das „Geschichtl-Er-zählen“ noch möglich sei. Selbstverständlich kannte er die Kraus-Maxime (im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts publiziert) und anerkannte die darin enthaltene Skepsis: „Einen Roman zu schreiben mag ein reines Vergnügen sein. Nicht ohne Schwierigkeit ist es bereits, einen Roman zu erleben. Aber einen Roman zu lefcen, davor hüte ich mich, so gut es irgend geht.“ Den Leuten „einen Roman erzählen“ ist ja schon lange zur abschätzigen Redewendung geworden.
Kraus und Hofmannsthal (beide Jahrgang 1874) waren
beinahe gleich alt: Kraus kam zwölf Wochen später zur Welt. Sie feierten gemeinsam den Tag der bestandenen Matura, befreundet, später entfremdet. Beide spürten, daß jenes Fin de siecle das Ende eines literarischen Zeitalters bedeutete. Konstruktivsten und andere Linguisten, aber auch die Sprachkünstler versuchen gegenwärtig das Problematische zu entschlüsseln, das der junge Kraus — völlig unsystematisch — instinktiv spürte und dem er dann zeitlebens — satirisch, polemisch, sprachanalytisch — nachspürte. Die schöne Phrase als unschöner Sumpf: Das war seine frühe Diagnose. Der scheinbare Pessimist war eher jugendlich optimistisch und dachte noch an eine „Trok-kenlegung“.
Dieses Vorhaben ist auch ein halbes Jahrhundert nach seinem Ableben keineswegs vollbracht, aber lebhaft im Gange. Wir wissen heute, daß man — durchaus im Sinne von Karl Kraus — an der geplanten „Trockenlegung“ weiterarbeiten muß: um nicht total zu versumpfen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!