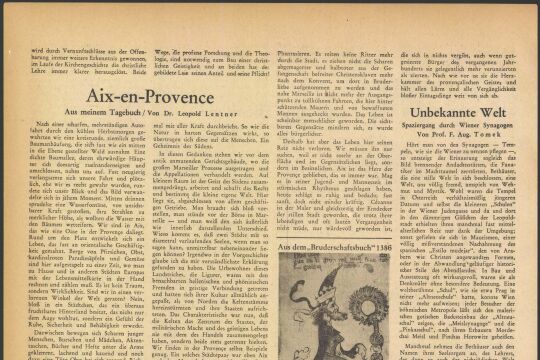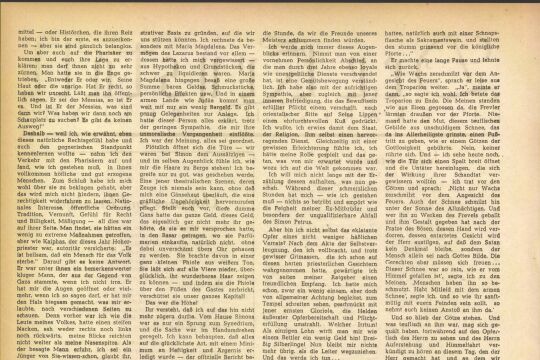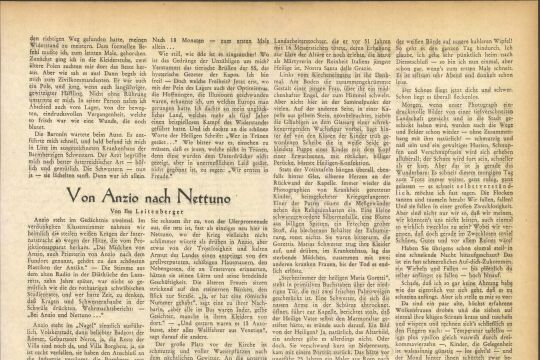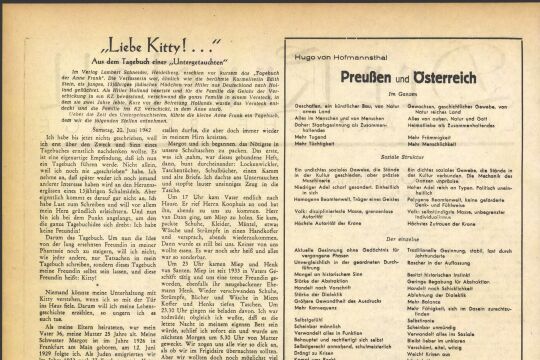Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Kulturklub wird getanzt...
Um in das jüdische Museum in der alten Kazimierz-Synagoge zu gelangen, muß man zunächst einmal an der Türe läuten — das Tor ist versperrt. Es öffnet ein Mann ohne Kopfbedeckung und sagt, daß das Museum geschlossen, er aber ausnahmsweise bereit sei, uns hereinzulassen. Zunächst müssen wir im Vorraum warten, bis er zwei polnische Besucherinnen durch die Ausstellungsräume geführt hat. Seit langem wird hier nicht mehr gebetet — nur noch herumgeführt.
Gleich neben dem Eingang steht eine steinerne Kassa mit hebräischer Inschrift: „Das heißt: 1407 bis 1410 in hebräischer Sprache“, sagt uns der Mann. — „Woher haben Sie das? Das stimmt doch gar nicht.“ — „Das heißt 1407 bis 1410, damals ist diese Synagoge erbaut worden, zur gleichen Zeit wie die Schlacht bei Grunewald.“ Die Synagoge ist also in diesen Jahren erbaut worden, auch wenn man es auf der steinernen
Kassa nicht vermerkt hat. „Wer sich etwas wünschte, konnte einen Wunschzettel in diese Kassa werfen.“ Der Schlitz ist dementsprechend breit. „Es war üblich, gleich Geld dazu zu werfen“, damit die Erfüllung des Wunsches nicht an finanziellen Schwierigkeiten scheitere. Seit langem werden hier keine Zettel mehr hineingeworfen — auch Geld nicht. Man könnte fast meinen, daß es keine Wünsche mehr gibt.
An der Wand ist ein kleiner dunkler Fleck sichtbar. „Das sind die Originalfresken“. Der Rest der Wand ist weiß verputzt worden. „Warum hat man die Fresken nicht restauriert?“ — „Das hätte Milliarden gekostet.“
Das Gewölbe des großen Betrau-mes haben die deutschen Besatzer vernichtet. Die bronzenen Kerzenleuchter ließ einst der Generalgouverneur Hans Frank in seine Residenz bringen. Was von der Kazimierz-Synagoge blieb, diente während des Krieges als Magazin.
Es läutet am Tor — es ist ein jüdisches französisches Ehepaar, das die Ausstellung sehen möchte. Leider, die Ausstellung ist seit Monaten nicht mehr zugänglich, „wegen der Feuchtigkeit“. Die Franzosen kommen gerade aus Prag, wo ihnen die Altneuschul so gut gefallen hat. Morgen fahren sie nach Warschau. Wieviel Juden leben eigentlich heute noch in Krakau? „400 Familien“, sagt der Portier.
Nach dem Rabbiner Ber Meiseis, einem der Führer der Aufstände von 1831 und 1864, ist eine Straße benannt worden. Seitenstraßen davon heißen Izaaka-, Jozefa- und Estery-gasse. Man schickt uns in die ulica Miodowa — dort soll noch eine Synagoge stehen. Wir läuten — in Krakau gibt es keine jüdischen Gebäude mit offenen Toren mehr. Ein Mann ohne Kopfbedeckung öffnet uns und führt uns durch den Hintereingang in die Synagoge. Der Haupteingang ist durch Fässer verstellt. „Die stammen noch von den Deutschen. Was da drinnen ist, weiß ich nicht.“ In der Zeit der deutschen Besatzung war auch diese Synagoge ein Magazin. Die alte Orgel wurde abmontiert und weggeführt. Alles, was aus Holz war, wurde zerhackt. Wie kommt es, daß die alten Luster erhalten blieben? „Die waren ihnen zu hoch oben.“
Die „Kongregacj Zydowska“, die jüdische Gemeinde, befindet sich in der ulica Skawinska. Am Haustor ist kein Hinweis auf die Kongregacj zu finden. Der Eintretende wird nur ersucht, das Stiegenhaus sauber zu halten. Im ersten Stock eine kleine
Blechtafel. Die Tür ist offen. Hier herrscht reger Betrieb. Männer ohne Kopfbedeckung telephonieren, Sekretärinnen tippen Briefe, junge Burschen tragen Akten von einem Zimmer in das andere. Auf dem Gang hängen lebensgroße Photographien elegant gekleideter junger Damen. „Wo ist das Zimmer des Herrn Jakubowicz?“ — Am Ende des Ganges, letzte Türe links. Herr Jakubowicz ist Präsident der jüdischen Gemeinde von Krakau. Er sitzt an einem Schreibtisch mit Telephon, einer Flasche Sodawasser, einer alten Schreibmaschine und einem Haufen von Papieren. Ihm gegenüber, an einem kleineren Schreibtisch, sitzt ein anderer Mann, der gerade verschiedene Formulare auszufüllen hat. Beide tragen Kopfbedeckungen. „In Krakau leben heute 700 Juden, die wir erfassen“, sägt Herr Jakubowicz. „Und dann wahrscheinlich ebensoviele, die wir nicht erfassen können. Zu den hohen
Feiertagen beten in der Miodowa-straße 400 und in der Remu-Synago-ge 80 Personen. Wir bekamen bis jetzt von der Societe de Secours 4000 Dollar monatlich für ganz Polen — dieser Betrag wurde aufgeteilt. Ich war in Genf und habe dort durchgesetzt, daß wir demnächst 7000 Dollar bekommen. Das Geld verwenden wir für die koschere Küche, für die Verwaltung der Synagoge und der Friedhöfe.“ Und nichts für religiöse Erziehung? — „Nein, das jüngste Mitglied der Gemeinde ist 64 Jahre alt.
„Die Beziehungen zu den Behörden sind gut“, fährt der Präsident fort. „Wenn wir etwas für den Friedhof brauchen, bekommen wir es. Gerade jetzt herrscht in der Stadt Fleischmangel, wir haben genug Fleisch — das zeigt doch am besten, wie gut die Beziehungen sind.“ Die Gemeinde bekomme zwar kein Geld vom Staat, aber allein der Umbau der Kazimierz-Synagoge zu einem Museum habe 10 Millionen Zloty gekostet.
Gibt es in Polen einen Antisemitismus? „Eigentlich nein; unter Gierek ist das besser geworden. Es gibt keine Juden mehr, also auch keinen Antisemitismus.“ Als ob Antisemitismus der Juden bedürfte!
„Mein Neffe wird Sie in die Remu-Synagoge führen“, sagt Harr Jakubowicz. Einer der Männer im Zimmer ist also der Neffe des Präsidenten. Auf dem Gang warten Herren mit Aktenkoffern, an den Türen sind keine Mesusoth. Was haben eigentlich diese großen Modephotos mit der Gemeinde zu tun? „Nein“, sagt der Neffe des Präsidenten, „in diesen Büros befindet sich die Verwaltung einer großen Textilfabrik, uns gehören nur die zwei Zimmer am Ende des Ganges.“
Wir fahren durch die Esterygasse und mein Begleiter sagt: „Esther war die Kochanka von einem König, seine Liebste.“ In all diesen Gassen wohnen heute keine Juden mehr — die Leute, die dieses alte Ghetto bewohnen, nehmen die Synagogen und die Friedhöfe in ihrer Nachbarschaft hin, wie man eine Kirche oder eine Moschee hinnimmt, wenn sich die Gläubigen ruhig verhalten.
Der Neffe hat einen Schlüssel zur Remu-Synagoge — wir brauchen nicht zu läuten. Neben der Synagoge liegt der alte Remu-Friedhof. Hier sind große jüdische Ärzte begraben — sie waren an italienischen Universitäten ausgebildet worden und dienten den Königen aus der Jagelionen-Dynastie. Der Stein des Eliezer Aschkenasi, gestorben 5345, ist erhalten — mit einer Schlänge, dem Zeichen der Mediziner auf der Rückseite. Dem Schloime, Hofarzt des Königs Kazimir, half all seine Heilkunst nichts. Die Grabinschrift verzeichnet, daß er verbrannt wurde — warum und wann, weiß man nicht mehr. Hier liegen die Brüder Halicz, Krakaus erste Buchdrucker — hier liegt auch Izaak Aaronowicz, dessen hebräische Druckerei neben denen von Venedig und Amsterdam berühmt war. Und nicht zuletzt liegt hier der große jüdische Philosoph, Moses Isseries, Autor eines jüdischen Gesetzbuches und Sohn des Remu, des Gründers der Synagoge.
Stücke von Grabsteinen, die die Zeit der Mistablagerungen nicht überstanden haben, sind in eine der Friedhofsmauern eingefügt worden. Hier liegt auch Rabbi Eisik Jeikeles, Erbauer der Alten Schul, die heute Kaszimierz-Museum heißt.
Die alte Synagoge in der Szeroka-straße 16 ist heute ein Kulturklub. Am Samstag abend wird dort getanzt. Die Synagoge in der Miodowa ist heute eine Schuhfabrik. „Ich werde in Krakau bleiben“, sagt Herr Garfinkel. „Wie kann ich wegfahren? Ich habe keine Urlaubsvertretung für die Synagoge und für den Friedhof.“ — Und wenn Sie nicht mehr sind, Herr Garfinkel? — „Dann wird alles zusammenfallen. 1964 habe ich noch in Belgien gewohnt, aber ich bin wegen der Synagoge zurückgekommen.“
Auf einer Bank vor der Synagoge sitzt Frau Garfinkel mit einem älteren Mann. „Das ist ein Trinker“, sagt Herr Garfinkel, „der vertrinkt sein ganzes Geld. Früher war er Schneider, jetzt ist er pensioniert.“ — „Da hast Du ein Gebetbuch“, sagt Frau Garfinkel zum pensionierten Schneider, ^„aber paß auf, daß die Dollars nicht herausfallen!“
Einige wenige Sommer lang werden sie noch auf der Bank vor der Remu-Synagoge sitzen können. Frau Garfinkel geht ihrem Mann ein Sodawasser holen, der Schneider geht nach Hause — so sagt er wenigstens.
Am Samstagabend aber wird die Schuhfabrik in der Miodowastraße geschlossen sein und im Kulturklub gegenüber, der früher eine Synagoge war, wird man tanzen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!