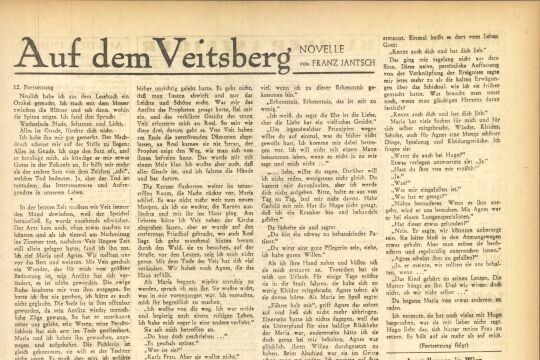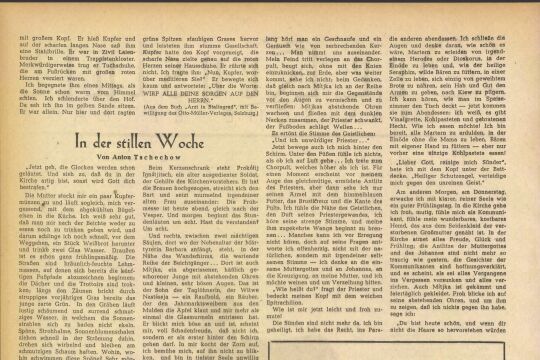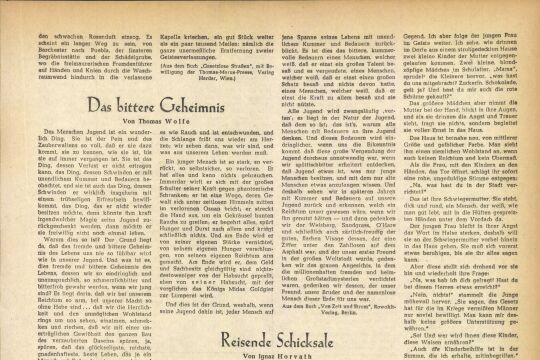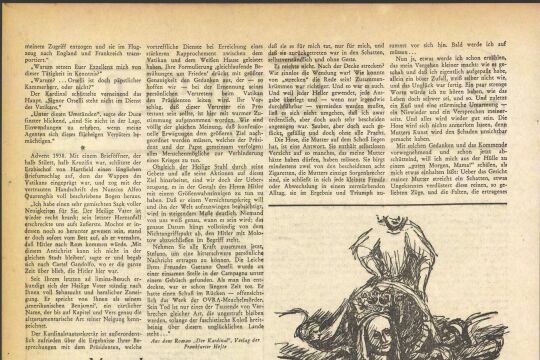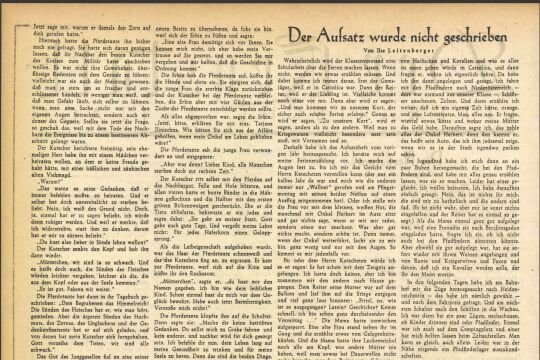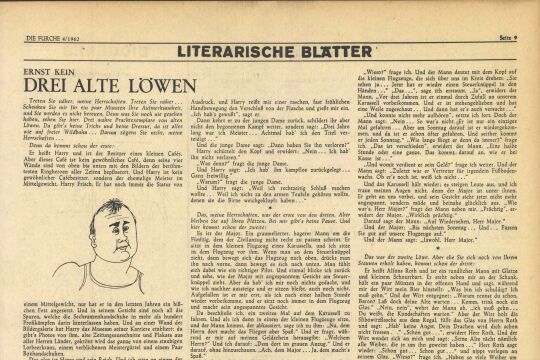Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„In gewisser Beziehung entsetzlich langweilig“
Im Vorwort des -Buches beschreibt die Verfasserin ihr eigenes Schicksal:
Im Vorwort des -Buches beschreibt die Verfasserin ihr eigenes Schicksal:
Ich sitze auf einem Spitalsbett, barfuß, die Beine hängen über einen Schemel. Bekleidet bin ich mit einem weißen Spitalskittel, der hinten am Hals und an der Taille zugebunden ist. Auf dem Kopf trage ich eine grüne Papierkappe, die alle meine Haare bedeckt, einer Duschhaube ähnlich.
Das Zimmer ist klein. Obgleich mein Mann an der gegenüberliegenden Wand lehnt, scheint er mir sehr nahe. Ich kann die Plomben in seinen Zähnen ausnehmen, während er seinen Mund auf- und zumacht. Er schreit mit mir. Soviel ich weiß, weine ich nicht, trotzdem spüre ich Tränen meine Wangen herunterrinnen. Ich registriere den Geruch von Parfüm, und einen Augenblick später betritt meine
Mutter durch die Schwingtür das Zimmer.
Sie sieht gut aus. Mit strahlendem Gesicht sagt sie: „Gott sei Dank, daß es vorbei ist!“ Mitten im Satz merkt sie, daß sie im Irrtum ist, und endet die Feststellung mit einem Fragezeichen. „Nein, es ist nicht vorbei!“ brüllt mein Mann. „Vor der Tür steht eine Tragbahre für sie, und sie hat die Schwester mit der Injektionsnadel hinausgeworfen. Derzeit denkt sie nach.“
Meine Mutter sagt: „Ich weiß nicht, was du meinst.“ Mein Mann ignoriert sie und tritt einen Schritt zu mir. „Von all den vertrottelten Sachen, die du je gemacht hast, schlägt das dem Faß den Boden aus. Zweimal in einer Woche! Was, um Gottes wülen, denkst du eigentlich? Ich möchte wissen - was hat sich denn seit gestern oder heute früh geändert?“
„Hör auf, mit ihr zu schreien!“ ruft
meine Mutter. Mein Mann brüllt zurück. „Du misch dich da nicht ein! Was machst du überhaupt da?“
Ich möchte laut auflachen, aber der Impuls endet in einem Schluchzer. Meine Mutter sagt: „Weine nicht!“ Mein Mann sagt: „Weine nur, weine nur, es wird uns aber nicht weiterbringen.“
In gewisser Beziehung bin ich eine überaus privilegierte Frau von siebenunddreißig Jahren. Ich bin in einem privaten, legalen Abtreibungsspital, wo ein Chirurg, ein alter Freund, auf mich im Operationssaal wartet. Ich bin erst in der fünften Woche. Vorige Woche bin ich aus einem anderen Spital herausspaziert, ohne abgetrieben zu haben, weil ich plötzlich meine Meinung geändert hatte. Ich habe einen Mann, der mich gern hat. Er schreit, weil ihm meine Unentschlossenheit Sorge bereitet, aber prinzipiell hat er mir zugestanden, daß die letzte Entscheidung in meinen Händen liegt:
„Es wäre sehr schwierig, vor allem für dich, und es ist absolut verrückt, aber ja, wir könnten noch ein Baby haben.“
Ich habe eine Mutter, die mich gern hat. Ich habe zwei kleine Söhne, deren kleine Gesichter mein stärkstes Argument gegen diese Abtreibung sind. Ich habe ein Doktorat in Psychologie, das mir unter anderen Vorteilen ein Zuvorkommen unter Kollegen zusichert und das sich in gewissen Sonderbehandlungen ausdrückt, wie zum Beispiel der Tatsache, daß im Moment mein Mann und meine Mutter zu einer Zeit, die nicht Besuchszeit ist, hier bei mir im Zimmer stehen und sich über meinen Kopf hinweg anbrüllen, während ich vor mich hin schluchze.
Diesmal gehe ich heim. Aber eine Woche später kehre ich in dasselbe Spital zurück und lasse abtreiben.
Es war diese Erfahrung, die mich zum Befragen der Menschen in diesem Buch geführt hat. Ich wollte ganz dringend wissen, was eigentlich hinter dem Abtreibungsmythos liegt. Was passiert mit jenen Frauen, die nicht so privilegiert sind wie ich und die nicht frei wählen können, sondern vielmehr durch die Umstände dazu gezwungen werden, ihr Kind zu negieren? Trauern sie mehr oder weniger?
Und was passiert mit jenen, die unter Lebensgefahr in irgendwelche Hinterhöfe schlüpfen müßten, wo Fleischhauer praktizierten - hat das ihre Entschlossenheit gestärkt? Sind die Frauen bei solcher Gelegenheit frei von innerem Schmerz? Welche Kräfte bewegen sie? Und was ist mit jenen, die die Arbeit ausführen?
Was nun folgt, sind Antworten, die ich auf diese Fragen erhielt.
Wenn man sich nachher zu ihnen ans Bett setzt und mit ihnen plaudert, dann gehen sie manchmal aus sich heraus und sagen: „Ich weiß nicht, ob ich das Richtige gemacht habe.“ Ich glaube, viele von uns rechnen nicht mit der Religion. Das ist aber falsch. Ganz allgemein spielt die Religion eine größere Rolle, als wir annehmen. Wir sagen: „Ach, die sind ja Atheisten und glauben nicht.“ Und sie selbst erzählen einem auch, daß sie nicht gläubig sind. Aber wenn es ein großer Fötus ist, dann werden eine Menge Fragen gestellt: „Ist es ein Bub oder Mädchen? Wird es getauft werden?“
Oft wollen die Leute, daß es getauft wird. Wir machen es, es bedeutet gar nichts. Aber wenn es jemanden befriedigt, dann tauft man auch einen Fötus. Wegen der psychologischen Wirkung, verstehen Sie? Es wird von der Kirche nicht anerkannt. Wie kann man auch
einen Fötus zuerst umbringen und dann taufen? Wenn ich glaube, daß es eine Frau glücklich macht, warum nicht? Wenn es ihren seelischen Katzenjammer lindert, warum nicht?
In gewisser Beziehung sind die Abtreibungen ja entsetzlich langweilig. Tagaus, tagein das gleiche! Die Komplikationen sind aufregend für die Schwestern, da gibt es dann eine Abwechslung ...
Alles nach achtzehn Wochen ist, scheint mir, doch schon zu groß. Wenn Sie ein eineinhalb Kilo schweres Kind entbinden, und wir haben schon viele solche gehabt, muß man schon aufpassen mit dem Alter. Das Tragischeste, das ich kenne, ist eine Frau mit einem lebendigen Fötus. Die ist dann völlig geschockt, komplett fertig.
Alles unter vierundzwanzig Wochen kommt in die Verbrennungsanlage. Die Frauen fragen einen ja auch, was mit dem Fötus geschieht. Natürlich kann man ihnen nicht sagen, daß man sie verbrennt. Ich sage immer, sie kommen in ein Gemeindegrab. Ich glaube, das muß man selber entscheiden. Jeder für sich. Meine Meinung ist, daß wir nicht genug nachher machen.
Ich finde, es sollte eine Stelle geben, wo sie mit dem Arzt sprechen können, der den-Eingriff gemacht hat. Ich finde, sie bekommen von dem Arzt, der es macht, nicht genug Betreuung. Er besucht sie nachher nicht, er redet nicht mit ihnen. Er sieht sie im Operationssaal, kurz bevor sie auf den Tisch kommen. Ich finde, das ist keine echte Arzt-Patient-Beziehung. Glauben Sie wirklich, eine Zwölf- oder Vierzehnjährige versteht das alles, was damit verbunden ist?
Ich glaube nicht, daß das Personal jemals sehr enthusiastisch war. Ich habe ganz schön Probleme mit dem Hilfspersonal wegen dieser Sache gehabt. Und an abfälligen Bemerkungen, die ich höre, wenn ich so herumgehe, mangelt es wahrlich nicht. Es genügt schon, wenn ein Patient mühsam ist. Dann heißt es gleich „widerlicher Sargnagel“ und „Was kann ich dafür, wenn die wegen einer Abtreibung hier ist? Soll sich's nicht an mir auslassen!“
Ich habe auch welche gehabt, die direkt hinausmarschiert sind: „Danke, nein“, ohne lang und breit Erklärungen abzugeben. „Habe nicht gewußt, daß Sie das machen.“
Jetzt habe ich eine Mischung von Personal, für die eine Auskratzung akzeptabel ist, die aber niemals auf dem Kochsalz-Stock arbeiten würden. Bis zu zwanzig Wochen, finde ich, redet
man ihnen ja zu. Und wenn sie das Gesetz eingeschränkt hätten (es stand eine Verkürzung der Vierundzwan-zigwochenfrist zur Debatte, Anm. d. Ubers.), dann wäre ich ganz dafür. D^nn nachher werden sie eben doch sehr groß.
Haben Sie die Zwanzigwochenkin-der gesehen? Ich muß sagen, mir dreht es den Magen um, und ich bin einer Meinung mit dem Personal, wenn sie sagen, sie finden es abstoßend, einen großen Fötus zu sehen. Es ist sehr traumatisierend für das Personal, so etwas aufzuheben, in einen Behälter zu geben und sagen: „Okay, das geht jetzt zur Verbrennung.“
„Tom“, ruft Dr. Holtzman. Tom dreht die Maschine ab. Holtzman zieht die Absaugspritze heraus und legt sie zum späteren Gebrauch auf das weiße Tuch, das die Patientin bedeckt, und hält seine rechte Hand hin. „Zange, bitte.“
Smith legt ihm etwas in die Hand, das wie eine übergroße Zange für Eiswürfel aussieht. Holtzman schiebt sie in die Vagina und zieht an. Er zieht etwas heraus, das er auf den Instrumententisch legt. „Da“, stellt er fest, „ein Bein. Die Größe des Fötus kann man am besten an den Extremitäten feststellen. Fünfzehn Wochen stimmt genau in diesem Fall.“
Ich wende mich an Smith. „Was hat er gesagt?“ - „Er hat ein Bein losgerissen“, sagt Smith „Da.“ Er deutet auf den Instrumententisch, wo ein perfekt geformtes, leicht gebogenes Bein, ungefähr acht Zentimeter lang, liegt. Es besteht aus einem ausgerissenen Oberschenkel, einem Knie, einem Unterschenkel, einem Fuß und fünf Zehen.
Ich zittere am ganzen Körper, aber ansonsten fühle ich nichts. Der totale Schock kennt kein Leid. „Jetzt habe ich den Brustkorb“, sagt Holtzmann und legt ein weiteres Stück Fötus auf den Tisch. „Das ist ein Stück, das man keinesfalls zurücklassen darf, denn es agiert wie ein Kugellager und infiziert alles.“
(Aus: Magda Denes, DER EINGRIFF Styria 1978, 256 Seiten, öS 178,-).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!