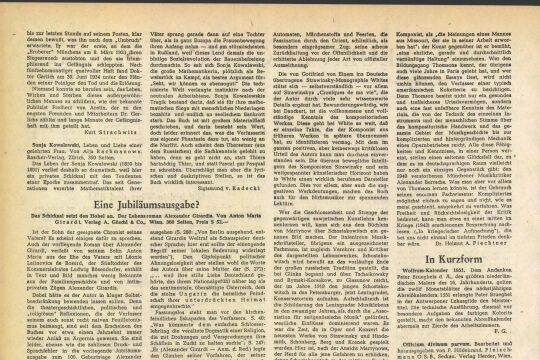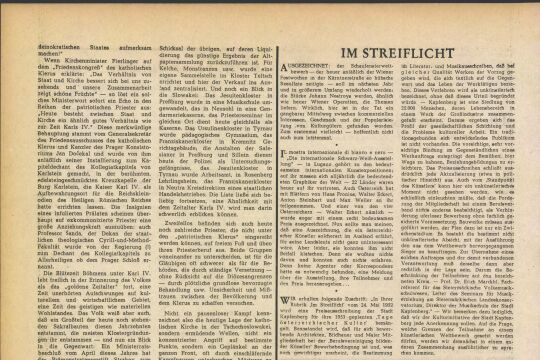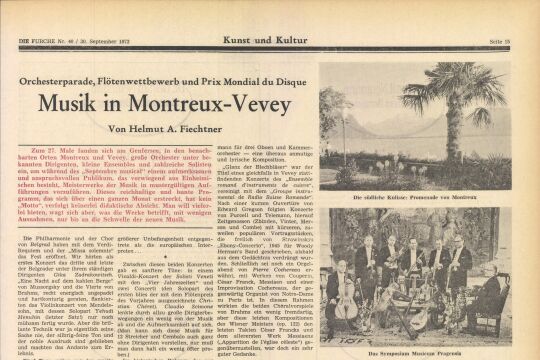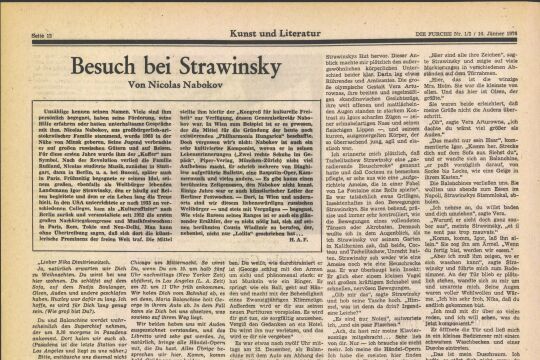Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ives ist noch zu entdecken
Noch vor Beginn der Wiener Konzertspielzeit gab es im Großen Musikvereinsaal ein Gastspiel des Chicago Symphony Orchestra. Dank des Mäzenatentums einer großen amerikanischen Bank und eines »Trusts ‘aus der Heimatstadt des renommierten Orchesters absolviert dieses jetzt eine Europa-Tournee mit 10 Konzerten. Georg Soiti, jetzt Sir George, hat es weit gebracht. Der Kodäly- und Döhnanyi-Schüler war jeweils 9 bis 10 Jahre in führenden Steilungen in Budapest, Frankfurt und an der Covent Garden Opera tätig. In Wien sahen wir ihn nur noch selten. Den Titel eines Generalmusikdirektors hat er sich in der Bundesrepublik erworben, von Köni gin Elisabeth wurde er geadelt. Und als ein General steht er vor seinem Orchester, dessen Chefdirigent er seit 1969 ist.
Sein Renommee und das des Orchesters vermochten den großen Saal des Musikvereins-zu füllen. Das Programm war es sicher nicht. Das war mehr für Kritiker und andere Interessenten, die keine Begegnung mit Charles įves versäumen wollen. Mit Recht. Denn man wird immer wieder von diesem amerikanischen Originalgenie überrascht — und erfreut. Ist er doch neben George Gershwin der einzige wirklich originelle Komponist, den dieses große Land bisher hervorgebracht hat.
Aber ganz so „aus dem Blitz- blauen”, wie man es oft darzustellen liebt, kam diese Begabung nicht. Bereits Charles Edwards Vater war Kapellmeister des Orchesters einer Kavalleriebrigade, und schon als Kind fungierte der Sohn dort als Trommler, der so vertraut mit dem Notenmaterial war, daß er, noch ein Knabe, Arrangements in verschiedener Besetzung anzufertigen vermochte. Frühzeitig lernte er Klavier- und Orgelspiel, und bereits den 13jährigen treffen wir als Organisten in seiner Heimatstadt im Staate Connecticut. Aber damit nicht genug: er studiert an den Universitäten von New Haven und in Yale, wo er damals berühmte Lehrer hatte. Und er komponierte.
Damit freilich war es sehr merkwürdig bestellt. An klassischer Musik von Bach bis Mendelssohn geschult, entdeckte er, etwa in dem Zeitraum von 1900 bis 1920, ganz allein für sich alle jene Neuerungen, um die sich in Europa eine ganze Generation talentierter Komponisten bemühte: Polytonalität und Atonali- tät, Pofyrhythmik und Polymetrik, Klangclusters und Stereoeffekte. Und dies alles ohne die geringste Kenntnis, ja ohne Interesse dafür, was anderwärts sich auf kompositorischem Gebiet ereignete. Denn įves schrieb seine Kompositionen ohne jeden Ehrgeiz und ohne die geringste Aussicht, jemals aufgeführt zu werden. Er war, als Inhaber einer großen Versicherungsanstalt, ein schwer- reicher Mann, ließ zwar einiges auf eigene Kosten drucken, kümmerte sich aber ansonsten nicht weiter um das Schicksal seiner Werke. Er lebte, gemeinsam mit seiner Frau, die wohl die einzige war, die an seinem Schaffen teilnahm, in einer Art splendid isolation: er besaß nie ein Radio, besuchte auch kaum jemals ein Konzert und hielt sich aus jederlei Musikbetrieb heraus. Erst nach seinem Tod im Jahr 1954 wurde er, der bereits 1927 (nach anderen Quellen schon 1921) auf gehört hatte zu schreiben, entdeckt. Schönberg schätzte den Gleichaltrigen sehr hoch, und — Ironie des selbstgewollten Schicksals — am 12. September 1954 ęhoreographierte Balanchine eine aus mehreren Orchesterstük- ken von įves bestehende Suite mit dem Titel „Ivesiana”. Aber da war įves gerade schon gestorben.
Immerhin: damit und durch die Bemühungen fortschrittlicher Dirigenten begann seine Entdeckung, zu der auch Georg Soiti in seinem Konzert etwas beitrug, indem er aus der viersätzigen Suite mit dem Titel „Eine Feriensymphonie” — leider nur — einen Satz mit dem Titel
„Decoration Day” spielte: eine überaus fesselnde, zuweilen impressionistisch-zart verschleierte, teils handfest drauflosmusizierende Schilderung jenes Volksfestes, bei dem, nach Formierung eines großen Zuges, die Gräber auf den Friedhöfen geschmückt werden und, nachdem man auf dem Heimweg immer lustiger geworden ist, die untergehende Sonne den schönen Tag in sanftes Licht taucht.
Im Mittelpunkt des Konzertes stand Beethovens VII. Symphonie. Aber wir können uns mit ihrer Interpretation durch die Gäste aus Chicago nicht einverstanden erklären. Wie kann ein europäischer Musiker wie
Soiti dieses Werk in einer solchen Riesenibesetzung (mit neun Kontrabässen und entsprechenden Massen von anderen Streichern und Bläsern) spielen lassen? Mit Präzision und Handfestigkeit ist da gar nichts auszurichten, besonders nicht in dem zauberhaften Allegretto, einem der anmutigsten Sätze, die Beethoven geschrieben hat.
Voll zum Einsatz seiner beträchtlichen virtuosen und klanglichen Qualitäten kam das Orchester erst mit Strawinskys „Sacre”, der während der letzten Jahre — wie etwa noch vor zwei Dezennien „Till Eulenspiegel” oder Ravels 2. „Daphnis”- Suite — zu einer Art Orches’ter- schilagsr geworden ist, den das Chicagoer Orchester mit aller wünschenswerten Härte, Spannung, Intensität, Präzision und Lautstärke vortrug. — Entsprechend lautstark war auch der Beifall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!