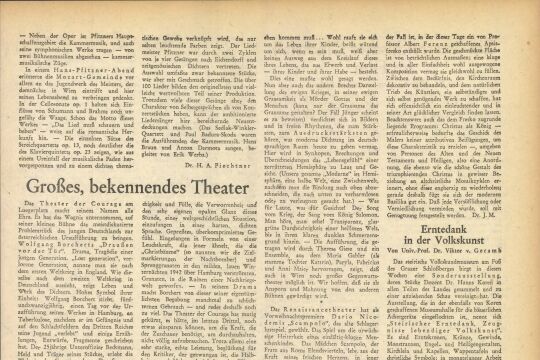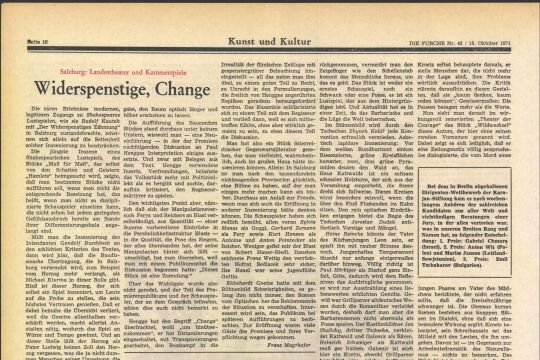Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Jede Hoffnung fahren lassen
Zwei Premieren in Burg und Akademietheater — schon allein durch ihre Terminisiertung an den Hetzten Spieitagen der Saison Musterbeispiele für die Situation eines Theaters, wo es bestenfalls noch ums pure Überleben des Tbea-terbetriebes geht. Ein Trost wenigstens bleibt: Viel kann über die Sommerpause nicht verschlampen. In Ibsens „Gespenstern“ nicht, weil sich sowieso kein Regisseur um sie bemüht hat und Paula Wessely ihre Sellbstdarsteliung in zwei Monaten sicher ebenso virtuos schaffen wird wie jetzt. Bei Walter Felsensteins Inszenierung des „Torquato Tasso“ liegen die Dinge etwas komplizierter. Allerdings nicht weniger hoffnungslos.
Ihre Vorgeschichten beschreiben beide Aufführungen treffender als ihre Schdlderungen es könnten. Für die ^xespenster“ wollte Klaus Maria Brandauer, der den Oswald im Vertrag versprochen hatte, Deutschlands umstrittenen Hans Neuenfels aus Frankfurt nach Wien bringen. Mit Neuenifels' ungewöhnlichem, die Figuren ummünzenden Regiekonzept konfrontiert, verweigerte Patila Wessely die Gefolgschaft. Die Wessely setzte sich gleich doppelt durch: Nachdem man noch rasch Rudolf Steinboeck und Leopold Lindtberg verbraucht hatte, begannen die Proben mit Gerhard F. Hering am Regiepult. Und Dieter Witting, dem Freund der Wessely-Tochter Maresa Hörbiger, als Oswald. Eine der offiziellen Begründungen für die Um-besetzung: Regisseur Hering hätte es so gewünscht, Hering-Wünsche hätte man allerdings ebensogut vernachlässigen können. Auf halbem Weg durch die Proben „erkrankte“ er; Regieassistent Götz von Langheim (der zur Belohnung im Programmheft als „Künstlerischer Mitarbeiter“ notiert) und Gerhard Klirugenberg übelnahmen das Finish der Produktion.
Felsensteins „Torquato Tasso“ wurde weniger intrigenreich, dafür um so schmerzvoller geboren. Bereits Wochen vor der Premiere bat Felsenbein um längere Probezeit. Klingenberg, mißmutig geworden durch regelmäßige Empörungsschreie in der Öffentlichkeit angesichts verspäteter Premieren, bestand auf dem fixierten Termin. Am Tag der Generalprobe resignierte Felsenstein in einem Rundfunkinterview: „Ich glaube nicht, daß es mir gelungen ist, meine Vorstellong dieses Stückes zu vermitteln.“ Er resignierte zurecht. Jetzt hat man das Resultat: Einen pünktlichen Inszenierungstorso. Was Felsenstein wollte, ist bloß zu erahnen.
Einen „gesteigerten Werther“ nannte, zu Goethes Zufriedenheit, ein zeitgenössischer Kritiker den Tasso, der eine Verbindung von Kunst und
Politik, von poetischer und sozialer Realität erträumt — und dessen empfindlicher Egoismus den ersten kleinen Zusammenstoß mit der Welt und ihren Formalitäten, als Totalschaden betrachtet. Zwei Pole: Tasso {Joachim Bissmeier), der exaltierte, hypersensible Dichter, und Staatssekretär Antonio (Rolf Boysen), der souveräne, mit der Realität in perfektem Einverständnis stehende Politiker. Die Spannung zwischen ihnen wird bestimmt durch den Neid des Verwirrten gegenüber dem, der sich auskennt. Und umgekehrt die leicht verständnislose Btewunderung des „Normalen“ für den genialisch Überhitzten.
Aber so unverbindlich kommt man dem Stück nicht bei. Denn der Dichter, der von seinem Fürsten wohlwollend im Lustschloß ausgehalten wird, als Lieferant schöner, unverbindlicher Illusionen „benützt“ wird: Er leidet nicht nur an sich selbst, nicht nur an seiner Innerlichkeit, sondern vor allem an eben dieser Situation. An seiner Rolle als emotioneller Clown, den man im Zeichen von Anstand und Ziemlichkeit in Schranken weist, sobald einem diese Emotionalität zu nahe tritt — und von dem man nichts mehr hören will, sobald der gefühlsmäßige Schmerz sich zum gesellschaftlichen Unbehagen konkretisiert
Scheinbar harmonisiert werden die gegensätzlichen Haltungen durch die sprachliche Vereinheitiichung. Das klassische Gleichmaß zwingt die Emotionen ins Korsett eines strengen sprachlichen Gestus. Hier findet man noch am ehesten den Ansatzpunkt von Walter Felsensteins Leseart: Den Versuch, hinter der klaren Ebenmäßigkeit der Sprache die Wi-dersprücblichkeit der Figuren aufzufächern^ Ihre Foimelhaftiigkeit als Chiffre für die emotionelle Ver-krampftheit der Figuren, den streng gezügelten Rhythmus der Diktion als logische Fortsetzung der strengen Benimm-dich-Regeln und beide als Fesselung der Emotionailität 'zu zeigen.
Hinter der polierten Sprachoberfläche Fahrigkeit, Nervosität, Ver-hemmtheit: Eine (freilich schlechte, undeutliche) Chiffre dafür ist das manirierte, auf den ersten Bück bloße Gi^tenbahnatmosphäre verstrahlende Bühnenbüd, das von hohen Mauern eingegrenzt ist, aus denen Büsten, Steinblumen (am ehesten als Querschnitte durch Halbedelsteine zu identifizieren) hervorwuchern. Ein unruhiger, gebrochener Gegensatz zur glatten, intakten Form der Sprache.
Ähnlich unruhig, sprachliches Gleichmaß kontrapunkitnerend der Stil der Schauspieler: Fahrige Nervosität statt klassischen Schreitens, verhaltene, leicht verfremdete (nur leider um so hohler, inhaltsleerer wirkende) Deklamation.
Am schlüssigsten wird das noch bei Annemarie Düringer (Leonore von Este), die eher blaß und frustriert diese Massischerweise superstarke, überlegene Frau spielt: Ihre große Rede über die Bescheidung in der Konvention („erlaubt ist, was sich ziemt!“) wird deutlich als Kommentar zu eingelernter Unifreiheit. Aber schon bei Eva Rieck und der unfreiwilligen Verkrampfung, mit der sie sich hektisch von einer Pose in die nächste quält, dabei verzweifelt mit den Versen raufend, führt sich das ganze ad absurdum. Und ist vollends bei seiner Parodie angelangt, wenn Sebastian Fischer als Herzog mit gespreizter Eitelkeit durch seine Rolle stelzt und selbst seine schönsten Sätze als leere, hohle Phrasen drischt. Bloß Rolf Boysen bereitet sprachlich echten Genuß.
Schließlich Joachim Bissmeier als Tasso: Grämlich, unmutig, larmoyant in monotonem Klageton spielt er die Verkleinerung der Figur zum frustrierten Dichterling. Und ruiniert so endgültig eine Aufführung, die von der Einsamkeit des. Künstlers ebenso handeln sollte wie von geiner schmerzhaften Kontaktlosigkeit zur politischen Realität Und so unter anderem auch ein Kommentar zur aktuellen Situation des Burgtheaters hätte sein können.
Ibsens „Gespenster“ am Vortag im Akademietheater waren so, wie man es sich nach den Geburtswehen dieser Vorstellung erwartete. Von keiner Regievorstellung angehaucht, gerade eben irgendwie hingebracht, nach Tourneetheatermanier rund um den allmächtigen Star arrangiert. Ein Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn man Schauspielerehrgeiz, Schauspielereitelkeit freien Lauf läßt. Das tödliche Theater. Und bestimmt nicht das letzte Opfer hiesigen tiefverwurzelten Irrglaubens, daß die Schauspieler die Vorstellung notfalls auch allein schmeißen könnten.
Mangels gedanklicher Basis läßt sich die Aufführung auch bloß durch Schilderung dar einzelnen Schauspielsolos beschreiben. Dabei gibt es am Beginn noch Ansätze von Spannung: Sylvia Lukan als Regine, Erich Aberle als Tischler Entgstrand — in dieser stallen, beinahe im Flüsterton gehaltenen ersten Szene meint man noch ein Konzept zu erkennen: Die Verhaltenheit leiser Brutalität, die Automatik, mit der Gemeinheit zur Selbstverständlichkeit wird, sobald sich Konventionen finden, mit denen man sie absegnen kann. Erich Aberle spielt das großartig: Die unterspielte Betonung von Sätzen, die auf Kommendes verweisen, die Gefährlichkeit listiger Verschlagenheit. Leider bleibt er (zusamimen mit Sylvia LuJcan) die einzige genau umrissene Figur.
Denn schon Ewald Baisers erster Auftritt signalisiert den Untergang dieser Aufführung, das völlige Fehlen jeden Versuches, die Alleingänge der Schauspieler auf ihre Rollen zu beziehen. Wie er hereinkommt, gutmütig vergreist das Gespräch beginnt, von einer Texüücke zur nächsten sich schwindelnd, immer in der Nähe des Souffleurkastens mit Groß-vaterallüren einen Uralten, schon Haibsendlen spielt: Das hebt das Stück aus den Angeln. Denn „Gespenster“ sind doch wohl kein Endspiel zwischen Absterbenden. Mit der ans Licht gezerrten schmerzhaften Vergangenheit quält sich Manders ebenso wie Frau- Alwing. Denn zwischen Manders und Alving, die vor Jahren aus einer als unaushaltbar empfundenen Ehe zu ihm geflüchtet war, von ihm im Namen von Moral und Ordnung wieder zurückgeschickt wurde in die Dauerhölle, vibriert noch immer starke, erotisch getönte Spannung. Keine Spur davon in dieser Interpretation — und keine Spur von der Gefährlichkeit des Fanatismus, mit dem hier Konventionen verabsolutiert werden. Im Gegenteil: Baiser verharmlost sie zu gerabbel-ten Marotten eines ewig Gestrigen...
Und Dieter Witting als Oswald: Das ist die Verlängerung von klassischem Burgtheaterpathos in eine unabsehbare Zukunft. Klangvolle Stimme, irrer Bück, verwuschelte Haare: So unberührt, so sichtlich überfordert ist schon lange keiner in den Irrsinn gegangen. So dürfte nicht besetzt werden. So nützt das keinem. Außer eben der Eitelkeit der Beteiligten.
Bleibt Paula Wessely: Gewiß kann sie die Frau Alving spielen, sie hat es schließlich schon einmal getan (unter August Everdings Regie in Hamburg eine Aufführung, die im Burgtheater kurz auf Gastspiel war). Gewiß schafft sie berührende Momente, volle Augenblicke starker Emotionailität. Aber auch ihr fehlen Orientierung, Führung, Entwicklung. Obwohl es einem dann doch noch kalt den Rücken herunterläuft bei ihrem gepreßten, plötzlich von unendlich fern herklingenden Schrei, als sie merkt, daß ihr Sohn endgültig in den Wahnsinn dämmert. Da ist in einem Augenblick komprimiert die ganze Tragik dieses ungeheuer starken Stückes zu spüren. Aber die Fragen, die es in einer Aufführung zu beantworten aufgibt, wurden vorher nicht einmal angerissen. So sinnlos war in Wien schon lange keine Aufführung mehr.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!