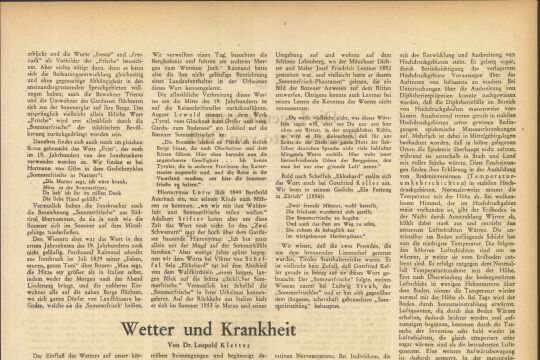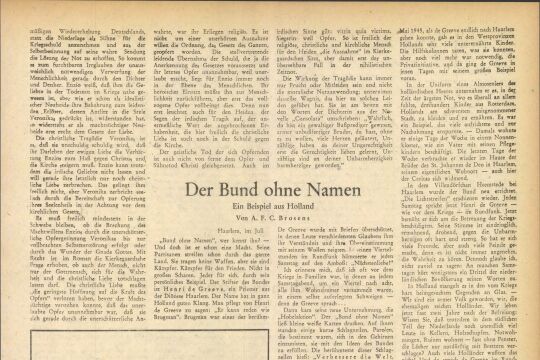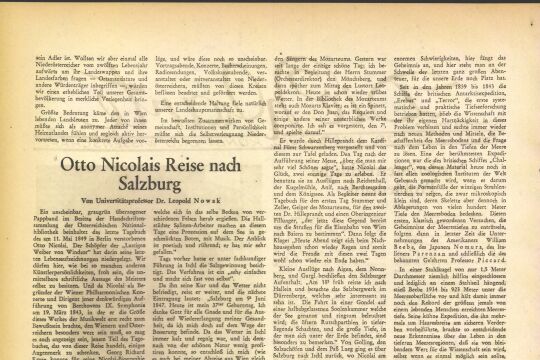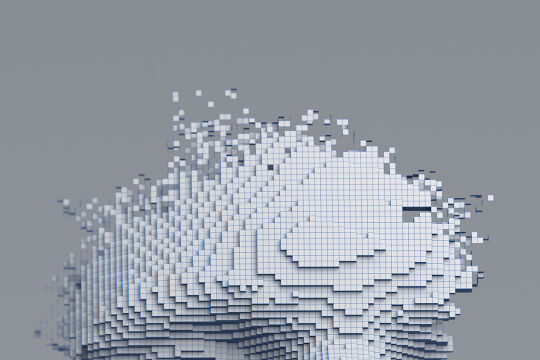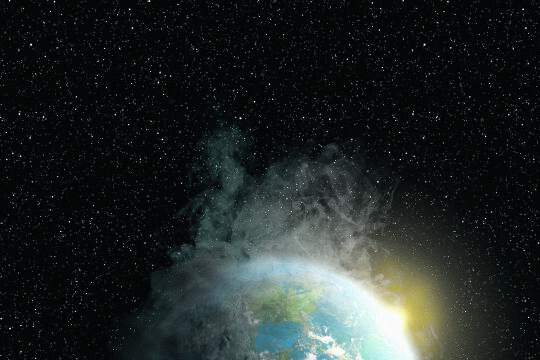Nahe der Jahrtausendwende begreifen wir mit Staunen, daß Wirklichkeit wird, wovor schon vor längerem gewarnt wurde, und unheilvolle Prozesse sich dramatisch beschleunigen.
So starb von den damals bekannten Vogelarten vor dem 18. Jahrhundert nur eine aus, im 19. Jahrhundert wurde bereits durchschnittlich alle 25 Jahre eine Vogelart unwiderruflich ausgerottet, zwischen 1900 und 1945 alle zehn Jahre, seither stirbt alle drei bis fünf Jahre ein Vogel aus.
1976 kamen 22 heimische Brutvögel in Österreich nicht mehr vor, 68 Arten galten nach den Roten Listen schon damals als gefährdet. Hält man sich die natürlichen Lebenskreisläufe und Nahrungsketten vor Augen, begreift man, warum die Vernichtung einer Art andere bedroht — oder zu deren unkontrollierter Vermehrung führt.
Im brasilianischen Städtchen Althino wurde, zum Beispiel, durch eine plötzliche verheerende Grillenplage enormer Schaden angerichtet. Die in der Umgebung lebenden Krötenarten waren dezimiert worden, da deren Haut für Handtaschen verwendet und gut bezahlt wurde. Da der natürliche Freßf eind der Grillen ausgerottet wurde, kippte das biologische Gleichgewicht, sie konnten sich ungehemmt vermehren.
Dieses Beispiel zeigt eine simple Verkettung von Ursache und Wirkung. Niemand kann aber voraussagen, was geschieht, wenn das Ökosystem an vielen Stellen zugleich angegriffen wird, kein Computer-Simulationsmodell die Folgen prognostizieren.
Die große Frage dabei ist, wie das durch ein vielfältiges Artensterben hervorgerufene Chaos auf die vom Menschen dominierte Natur wirken und wie sein eigenes Uberleben in einer sich radikal ändernden Umwelt möglich sein wird.
Einseitig wird immer nur gefragt, warum Tier- und Pf lanzen-arten verschwinden, aber selten und erst seit kurzer Zeit jene Art mit einbezogen, die, obwohl ja auch nur eine Organismengruppe im Systema naturae, diesen ganzen Strudel von Veränderungen in Bewegung gebracht hat. Wir müssen uns aber vor Augen halten, daß es, mit oder ohne Umweltzerstörung (aber natürlich vor allem unter deren Auspizien), auch für den Homo sapiens keine biologische Garantie geben kann, die ihn so auszeichnen würde, daß er als einziger das Recht auf ewige Existenz hat.
Wir hatten in unserem Jahrhundert bereits Gelegenheit, eine gewaltige, nicht wiedergutzumachende Einschränkung der subspezifischen Variation der Speeles Homo sapiens mitzuerleben: Die Ausrottung der Naturvölker.
Ishi, der letzte Yahi-Indianer, starb 1916 im Museum für Anthropologie in San Franzisko. Peter Färb, 1968: „Heute trauert Amerika dem Aussterben von Wandertauben, nordamerikanischem Kranich und Elfenbeinschnabel nach. Die Amerikaner spenden für Organisationen, die die Seeotter der Aleuten und die Eidechsen der Galapagosinseln schützen.
Und wer vergießt eine Träne über den Verlust der eingeborenen Kulturen? Uberall auf der Welt beginnen heute die primitiven Kulturen immer schneller zu verschwinden. Die Ureinwohner Tasmaniens sind bereits ausgestorben, die Yaghan auf Feuerland, denen Darwin begegnet ist, praktisch ausgerottet. Jedes Jahr gibt es weniger Arunta in Australien und weniger Negritos auf den Philippinen. Nicht anders ergeht es den Ainu in Japan, den Buschmännern in Südafrika und den Polynesiern in Hawaii... Wenn wir weiter so untätig sind, werden unsere Kinder keine Gelegenheit mehr haben, die herrliche Vielfalt der Menschheit kennenzulernen, weil wir jene dahinsterben ließen, die diese Vielfalt verkörpert haben.“
Nun liegt aber die biologische Uberlebensfähigkeit einer Art in ihrer genetischen Variabilität. Jede Einengung dieser Variabilität schwächt ihre biologische Fitneß.
Wilhelm Doerr beschreibt ein weiteres Phänomen, das er als Engpaß in der Zukunft des Menschen auffaßt, nämlich die besondere anatomische Situation der Plazenta, des Mutterkuchens. Bei den Säugetieren gibt es unterschiedliche Grade der Vollkommenheit, mit der die Evolution das Problem der Verbindung zwischen mütterlichem und embryonalem Gewebe gelöst hat. Für den Menschen typisch ist die sogenannte haemochoriale Plazenta, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Blutgefäße der Mutter offen liegen und das Chorion-Gewebe, die äußerste Gewebeschicht des Fruchtsackes des Embryo, frei im mütterlichen Blut schwimmen kann. Während das Gewebe der Mutter vergleichbar einer Wunde offen liegt, ist die Frucht durch die Zellschicht des Choriongewebes geschützt. Doerr führt Schwangerschaftskomplikationen wie Erbrechen, Nierenprobleme, blitzartig auftretende Krampfzustände, darauf zurück.
K. Goerttler drückte es bereits 1950 drastisch aus: „Festgefahren in einer Sackgasse, ist die Zukunft des menschlichen Geschlechtes allein gewährleistet bei äußerster Ausnutzung des mütterlichen Organismus - bis an die Grenzen seiner physischen Belastbarkeit. Alle Vorteile des menschlichen Plazentabaues liegen beim Kinde, alle Nachteile eindeutig bei der Mutter... Kein Wunder, daß erfahrene Kenner der Verhältnisse... aufgrund dieser Tatsachen das Aussterben des Menschengeschlechtes für künftige geologische Erdepochen voraussagen.“
Aber die anatomisch-physiologischen Gegebenheiten werden durch die heutige Lebensweise, im Gegensatz zu früheren Zeiten, zusätzlich negativ beeinflußt und verschärft.
Evolution bringt ja nicht nur morphologische Vielgestaltigkeit hervor, sondern auch arttypisches
Dauerstreß, der die Folge davon ist und in dem ein immer größerer Teil der Menschheit lebt, könnte sich über den Schwachpunkt der Plazenta auf lange Sicht verheerend auswirken. Dauerstreß wirkt auf Stoffwechsel und jegliches Organgeschehen negativ und verwandelt möglicherweise die Besonderheiten der Plazenta in eine (weitere) Gefahrenquelle.
Daß dies nicht ganz unwahrscheinlich ist, läßt sich indirekt aus einer wichtigen Studie von H. Kapaun und P. Lorant schließen („Frühgeburtlichkeit in Wien“, Wien 1983).
Die Autoren gingen von der verblüffenden und alarmierenden Tatsache aus, daß im großstädtischen Bereich die Zahl der Frühgeburten steigt.
Unter dem Aspekt, daß in Wien 1983 bereits 6,5 Prozent aller Neugeborenen Frühgeburten waren, untersuchten die Autoren die psychosozialen Faktoren, die Frühgeburten begünstigen. Die repräsentative Studie zeigt deutlich, in welch hohem Maß Lebensführung und Lebensqualität mit der Frühgeburtenzahl zusammenhängen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Frühgeburt ist um so geringer, je besser die werdende Mutter in ihre psychosoziale Umwelt eingebettet und je geringer ihre Streßbelastung ist.
Der hohe Prozentsatz an und arterhaltendes Verhalten. Ändern sich Verhaltensweisen derart, daß sie den Bedingungen, unter denen sie sich entwickelten, nicht mehr entsprechen, kann auch dies zur Gefahr für eine Art werden.
Dem Homo sapiens ermöglicht sein hochentwickeltes Nervensystem eine Kommunikation mit der Umwelt mit hoher Informationsdichte. Sein Sensorium reagiert endogen und exogen auf Reize und alle Arten von Umwelteinflüssen mit Lust- und Un-lustgefühlen, mit durch Adrenalinausschüttung ausgelösten Alarmzuständen auf Gefahrensituationen und so weiter. Es erwarb im Laufe von Millionen Jahren gewaltige Leistungsfähigkeit, selektiert aus einer InformationsSchwangerschaftskomplikatio-nen und Frühgeburten beweist, daß immer mehr Menschen unter Bedingungen leben, für die sie die Evolution nicht ausgerüstet hat und wir uns immer weiter von evolutionsbiologisch günstigen Lebensbedingungen entfernen.
Es gibt viele Hinweise darauf, daß solche Entwicklungen sehr plötzlich ein dramatisches Ausmaß annehmen können.
Abschließend soll noch ein Gedanke skizziert werden, der mir wichtig erscheint. In der Evolution der Organismen, die in Hunderten Millionen Jahren zum Menschen geführt hat, ist in der aufsteigenden Säugerreihe ein Trend zu beobachten, der schließlich beim Menschen seinen Höhepunkt erreichte und in der kulturellen Evolution andauert: Die charakteristische Verlängerung der Kindheit und Jugend als lange Periode absoluter und später relativer Hilflosigkeit.
Diese Entwicklungsphase ist durch intensive Beziehungen des Kindes zu seinen Bezugspersonen bestimmt.
Nur über diese stark emotional getönten Beziehungen ist es möglich, all das zu realisieren, was in den Genen als Disposition angelegt ist. Wenn in den frühen sensiblen Entwicklungsperioden jene sozialen Lernprozesse, die die Grundlage für spätere Verantwortungsfähigkeit und soziale Inzufuhr von rund einer Milliarde Bits pro Sekunde (das Bit ist die kleinste Informationseinheit der Elektronik) das Wesentliche, etwa 100 Bits pro Sekunde kann unser Gehirn bewußt verarbeiten.
Jedes Zuviel, Reizüberflutung, welche dieses System überfordert, kann, vor allem, Vrenn sie langfristig einwirkt, den ganzen Organismus nachhaltig beeinträchtigen. Die Evolution hat uns für ein Gleichgewicht zwischen Reizangebot und lebenserhaltenden Reizantworten optimiert. Die schnell ablaufende kulturelle Entwicklung ließ uns keine Zeit, uns über Mutation und Selektion den neuen Bedingungen anzupassen. Wir haben eine Umwelt geschaffen, zu deren Bewältigung unser Nervensystem nur noch bedingt fähig ist.teraktion darstellen, nicht oder nicht ausreichend stattfinden, werden aus Kindern Erwachsene, die nur bedingt in der Lage sind, in der Gemeinschaft ein erfülltes, verantwortungsbewußtes Leben im Sinne von Humanität und Toleranz zu führen und diese Grundhaltung an die nächste Generation weiterzugeben.
Auch eine Reduktion dieses alten, im Lauf der Evolution entstandenen Brutpflegeinstinktes durch Änderungen der Verhaltensweisen würde bedeuten, daß wir die Bedingungen ignorieren, unter denen wir zum Homo sapiens geworden sind, und unsere weitere Existenz in Frage stellen.
Carl Amery läßt Moby Dick, den letzten Bartenwal, als stillen Zuhörer an einer Friedenskonferenz von Christen und Marxisten teilnehmen. Er schwankt zwischen Hoffnung und üblen Ahnungen. Er reist ab, meditiert in den Polarmeeren und wird als letzter Wal von einem Forschungsschiff erlegt. Es trägt den Namen „Schönere Zukunft“ und wird nun für den Fang von Krill-krebsen umgerüstet. Seeleute, die dabei waren, behaupten später, Moby Dicks Antlitz habe ein unangenehmes Grinsen gezeigt, aber vielleicht behaupten sie dies nur aufgrund späterer, viel zu später Einsicht...
Oer Autor ist Vorstand des Instituts für Humanbiologie an der Universität Wien.