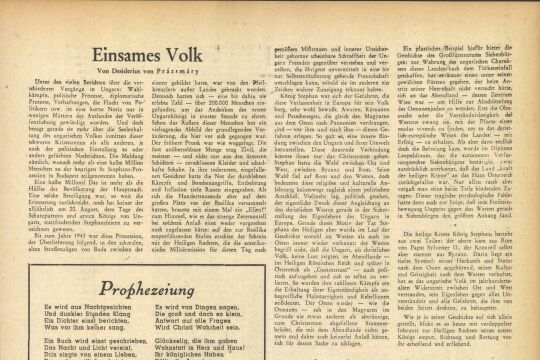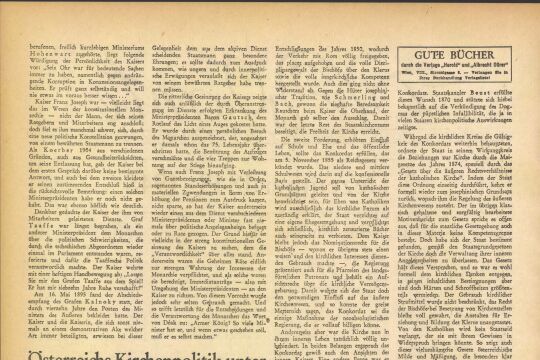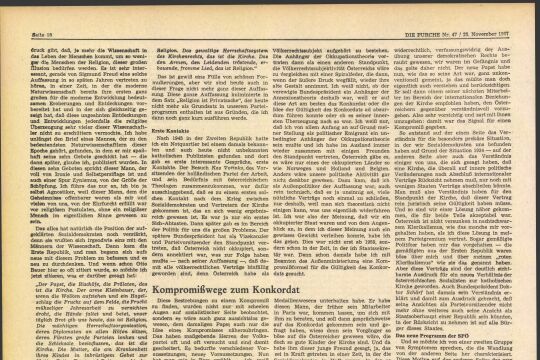Kein roter Kardinal
Kein anderer Wiener Erzbischof in diesem Jahrhundert amtierte so lange, hatte solche Bedeutung für die Weltkirche und repräsentierte Österreichs Kirche so lange gegenüber dem Staat wie Franz König.
Kein anderer Wiener Erzbischof in diesem Jahrhundert amtierte so lange, hatte solche Bedeutung für die Weltkirche und repräsentierte Österreichs Kirche so lange gegenüber dem Staat wie Franz König.
Die Zweite Republik ist eine parlamentarische Demokratie. Wer sich mit dem Staat Österreich auseinandersetzt, muß auch sein politisches System und dessen Träger, die politischen Parteien und Interessenvertretungen, miteinbeziehen. Das gilt auch für den höchsten Amtsträger der katholischen Kirche Franz König, Erzbischof von Wien 1956-1985.
Während seines Episkopats amtierten die Bundespräsidenten Theodor Körner, Adolf Schärf, Franz Jonas und Rudolf Kirchschläger. Obwohl Österreichs Innenpolitik seit 1945 von starker Stabilität gekennzeichnet ist, hatte es Kardinal König doch mit den Bundeskanzlern Julius Raab, Alfons Gorbach, Josef Klaus, Bruno Kreisky und Fred Sinowatz zu tun, mußte er sich bis 1966 auf die große Koalition, danach auf die Alleinregierungen Klaus und Kreisky und die derzeitige SPÖ-FPÖ-Koalition einstellen.
Wegen der Persönlichkeit des Kardinals war diese lange personale Kontinuität an der Spitze der österreichischen Hierarchie für Kirche und Staat ein nicht hoch genug einzuschätzender Vorteil. 1905 in Niederösterreich geboren, hat er schon bewußt das Ende der Habsburger-Monarchie erlebt; er war junger Priester zur Zeit der Ausschaltung des Parlaments 1933 und des Bürgerkriegs vom Februar 1934. Während des NS-Regimes hat er als Religionsprofessor in Krems seine Schüler gegen den Nationalsozialismus immunisiert. 1945 war der bald international bekannte Religionswissenschaftler König politisch unbelastet und ein überzeugter österreichischer Demokrat.
Überzeugter Demokrat ist König bis heute geblieben. Deswegen hat er auch in der Kulturpolitik bewußt jeden Kollisionskurs vermieden — Konfrontationen ist er allerdings nicht ausgewichen — und damit wesentlich zur Erhaltung des inneren Friedens der Republik beigetragen. Seine Persönlichkeit und Amtsdauer haben die einvernehmliche Lösung von viele Jahrzehnte offenen Fragen zwischen Kirche und Staat ermöglicht.
Voraussetzung dafür war die konsequente Beibehaltung der Absage an den politischen Katholizismus der Zwischenkriegszeit. Diese Absage war jedoch immer mit der Betonung der Notwendigkeit politischen Handelns jedes Katholiken und der Bedeutung der Kirche als „Gewissen“ der Gesellschaft verbunden.
Der österreichische Klerus war schon 1933 aus der aktiven Politik abberufen worden. 1945 blieb die Bischofskonferenz mit Kardinal Theodor Innitzer an der Spitze aus Uberzeugung bei diesem Beschluß. 1952 wurde bei der Vorbereitungstagung in Mariazell für den ersten österreichischen Nachkriegskatholikentag die von Richard Barta, dem nachmaligen „Kathpress“-Leiter und Berater von Kardinal König, formulierte Absage auch der Laienorganisationen an den politischen Katholizismus der Vergangenheit, das „Mariazeller Manifest“, angenommen.
Die Realisierung dieses Kurses, 1967 vom damaligen ÖVP-Gene-ralsekretär Hermann Withalm ausdrücklich auch für seine Partei anerkannt, ist das Verdienst Kardinal Königs. Sie hat ihm in manchen Kreisen den Ruf des „roten“ Kardinals eingetragen, der er nie war.
Er hat nur immer und überall auf die gesellschaftliche Aufgabe einer parteipolitisch nicht gebundenen Kirche hingewiesen, auch vor einem Gremium, zu dem bis dahin noch kein Erzbischof gesprochen hatte: vor dem Bundesvorstand des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Dort wiederholte er (1973), daß die Kirche nicht politisieren dürfe, aber politisch handeln und in Grundfragen des menschlichen Lebens, im besonderen auch des ungeborenen, reden müsse.
Die komplizierte Geschichte der Verträge der Zweiten Republik mit dem Vatikan 1960-1968 kann hier nur radikal verkürzt dargestellt werden: Das erste österreichische Konkordat von 1855 war 1870 von Österreich gekündigt worden. 1933 wurde ein neues vom damaligen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß am 5. Juni abgeschlossen, als das Parlament schon ausgeschaltet war. Die österreichische Ratifizierung erfolgte am 1. Mai 1934, also nach dem Verbot der Sozialdemokratischen Partei. Das NS-Regime hat dieses Konkordat nicht anerkannt, aber nach dem März 1938 auch das Reichskonkordat nicht auf die „Ostmark“ ausgedehnt.
Nach der Befreiung 1945 wünschten die Bischöfe und die österreichische Volkspartei eine Klärung dieser Frage, sei es durch Anerkennung des Konkordates von 1933 durch die Republik oder durch den Abschluß eines neuen Konkordates. Obwohl die durch die große Koalition an der Regierung beteiligte Sozialistische Partei in einigen prinzipiellen Fragen über ihren Schatten gesprungen war — wie übrigens auch die ÖVP —, war sie dazu damals nicht bereit. Da die Kirche der Regierung eines vierfach besetzten Landes nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten bereiten wollte, stellte sie ihre konkordatären Forderungen bis zum Abschluß des Staatsvertrages 1955 zurück.
1956 veröffentlichten die österreichischen Bischöfe einen von Bischof Paulus Rusch konzipierten Sozialhirtenbrief mit der Anerkennung der sozialen Leistungen der SPÖ, deren Vorsitzender Adolf Schärf im Frühjahr 1957 zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Schon am Tag nach seiner Angelobung signalisierte er seine Bereitschaft zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Kirche und Staat.
Im Dezember 1957 wurde dem Vatikan die Bitte der österreichischen Regierung um Aufnahme von Verhandlungen für ein neues Konkordat auf der Basis der prinzipiellen Anerkennung des Konkordates von 1933 vorgetragen. Papst Pius XII., Verfasser des alten Konkordates, lehnte ab. Man könne höchstens über kleine Änderungen dieses Konkordates verhandeln.
Die Verhandlungen kamen zum Stillstand. Erst im Pontifikat Johannes' XXIII. wurden sie wieder aufgenommen. 1960 wurden die Verträge zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zur Regelung von vermögensrechtlichen Beziehungen und über die Erhebung der Apostolischen Administratur Burgenland zur Diözese unterzeichnet. Am 12. Juli 1960 wurden beide Verträge von ÖVP und SPÖ angenommen. Nur die FPÖ verweigerte dem „Dollfußkonkordat“ ihre Zustimmung.
Bereits am 9. Juli 1962 wurde der Vertrag zur Regelung von mit dem Schulwesen zusammenhängenden Fragen abgeschlossen. Er erforderte die Annahme einer Verfassungsgesetznovelle über das Schulwesen durch das Parlament am 18. Juli 1962, die eine seit 1920 bestehende Lücke der österreichischen Verfassung schloß, sowie weitere acht Schulgesetze. Der unermüdliche Motor in diesem Bereich war Unterrichtsminister Heinrich Drimmel. Das Gesetz vom 9. Juli 1962 sicherte den konfessionellen Schulen zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte eine staatliche Subvention im Ausmaß von 60 Prozent der Lehrerpersonalkosten. 1971, zur Zeit der SPÖ-Minder-heitsregierung Kreisky I, wurde sie auf 100 Prozent angehoben.
Nach der Errichtung der Diözesen Innsbruck und Feldkirch aufgrund der Verträge mit dem Heiligen Stuhl 1964 und 1968 ist von den nach 1945 offenen Konkordatsmaterien nur mehr die Ehefrage zu regeln — die Einführung der fakultativen Zivilehe statt der seit 1938 vom NS-Regime eingeführten und bisher nicht außer Kraft gesetzten obligatorischen Zivilehe.
Die innerstaatlich zu regelnden Fragen erwiesen sich letztlich als schwieriger. Die Regierungsvorlage vom November 1971 für das neue Strafrecht enthielt, wie schon seinerzeit die Regierungsvorlage 1968, die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruches aus medizinischen (Gefährdung der Mutter), aber auch aus sozialen, ethischen und eugenischen Gründen (Indikationslösung).
Als sich diese Lösung bereits abzuzeichnen schien, gewann eine Gruppe junger sozialistischer Frauen die Frauenbewegung der SPÖ vor dem Villacher Parteitag 1972 für die Forderung der „Fristenlösung“ (Freigabe des Schwangerschaftsabbruches bis zum dritten Monat nach der Empfängnis). Der Parteitag schloß sich ihr an, und auch Justizminister Christian Broda machte sie sich schließlich — nicht aus taktischen Gründen, wie manche lange glaubten — zu eigen. Ein mäßigender Einfluß Bundeskanzler Krei-skys, der persönlich kein Anhänger der Fristenlösung war, aber vielleicht die Bedeutung dieser Frage für die Kirche unterschätzte, kam nicht zur Geltung.
Das folgende halbe Jahrzehnt ist sicher das schwierigste im Episkopat Königs gewesen. Einerseits intensiv und beharrlich, aber vergeblich, bemüht, die SPÖ zum Verzicht auf die Fristenlösung zu bewegen, stand er anderseits unter dem Druck von Priestern und Laien, die einen härteren Kampf von ihm verlangten, und wieder anderer, die, wenn schon nicht einen Kulturkampf, so doch den völligen Bruch zwischen Kirche und SPÖ fürchteten.
Der Nationalrat beschloß am 29. November 1974 mit den Stimmen aller Parteien — die Fristenlösung ausgenommen; diese wurde nur von den Abgeordneten der SPÖ akzeptiert — das neue Strafrecht. Der Nationalrat bestätigte 1977 den negativen Ausschußbericht über das Volksbegehren der „Aktion Leben“. Damit haben sich auch heute noch viele Katholiken nicht abgefunden.
Weitere Justizreformen bis 1983, zum Beispiel im Bereich des Familienrechtes, haben in einzelnen Fragen (Erleichterung der Ehescheidung, Situation der geschiedenen Frau) kirchliche Kritik hervorgerufen, die Kardinal König 1978 auch deutlich ausgedrückt hat. Teile dieser Kritik wurden auch in den Endfassungen der Gesetze berücksichtigt.
Mit Bundespräsident Rudolf Kirchschläger nahm erstmals in der Zweiten Republik der Präsident an der Wiener Fronleichnamsprozession teil. Der 1976 — von der „Jungen Generation“ der SPÖ und einigen alt- und neuliberalen Kreisen — in Frage gestellte Religionsunterricht an den Schulen wurde am Nationalfeiertag 1976 von Kardinal König als demokratisches Recht der Eltern und der Kirche entschlossen außer Streit gestellt:
„Was ist das für eine Freiheit, was ist das für ein Demokratieverständnis, die das Wirken der Kirche auf den Kirchenraum, auf die Sakristei beschränken will? Diese Art von Freiheit hat die Kirche auch in totalitären Staaten. Eine nur auf den Kirchenraum beschränkte Kultfreiheit gibt es auch im Kommunismus.“
Diese Rede hat ebenso wie der Protest katholischer Organisationen und die offizielle Distanzierung führender SPÖ-Politiker, an ihrer Spitze Bundeskanzler Kreisky, dazu geführt, daß diese Diskussion rasch erlosch.
Die archivarischen Quellen zu unserem Thema sind noch nicht zugänglich. Es sind jedoch so viele Predigten, Ansprachen, Vorträge und Interviews aus der langen Amtstätigkeit des Kardinals veröffentlicht, daß man allein aus diesem Material ein umfangreiches Buch schreiben könnte. Sein Inhalt könnte allerdings nichts anderes zeigen als diese Zeilen: die Unbeirrbarkeit, mit der Kardinal Franz König fast drei Jahrzehnte für die Zusammenarbeit einer freien Kirche mit einem freien Staat gewirkt und damit nach jahrhundertelangem Staatskirchentum und Jahrzehnten eines einseitigen politischen Katholizismus eine neue positive Ära zwischen Kirche und Staat eingeleitet und getragen hat. Er wird uns wie Bundespräsident Rudolf Kirchschläger fehlen.
Die Autorin ist Professorin für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Universität Wien.