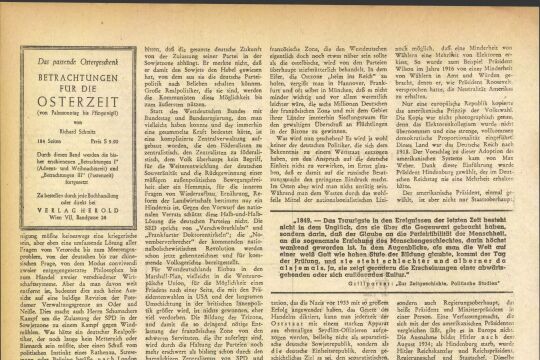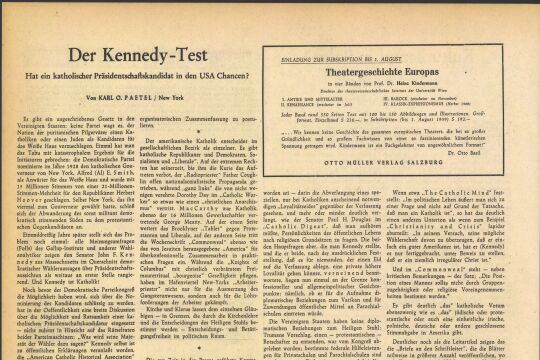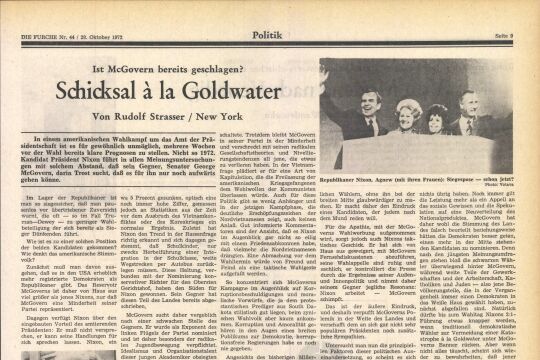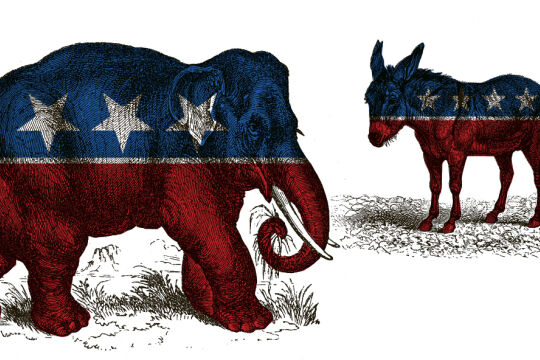Kennedy ex madiina?
Im heutigen Zeitpunkt einen nur einigermaßen akkuraten Vorausblick auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November 1976 zu geben, erscheint nahezu unmöglich und unseriös. Trotzdem ist eine analytische Untersuchung der Kandidaten und ihrer Aussichten wichtig, da sich Amerika eigentlich in einem permanenten Wahlkampf befindet, der jedes zweite Jahr zu den Kongreß wählen und jedes vierte Jahr, wenn das Weiße Haus neu besetzt oder bestätigt wird, seinen Höhepunkt erreicht. Ohne diesen Aspekt wäre die amerikanische Innen- und zuweilen auch Außenpolitik kaum verständlich.
Im heutigen Zeitpunkt einen nur einigermaßen akkuraten Vorausblick auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November 1976 zu geben, erscheint nahezu unmöglich und unseriös. Trotzdem ist eine analytische Untersuchung der Kandidaten und ihrer Aussichten wichtig, da sich Amerika eigentlich in einem permanenten Wahlkampf befindet, der jedes zweite Jahr zu den Kongreß wählen und jedes vierte Jahr, wenn das Weiße Haus neu besetzt oder bestätigt wird, seinen Höhepunkt erreicht. Ohne diesen Aspekt wäre die amerikanische Innen- und zuweilen auch Außenpolitik kaum verständlich.
Es ist für gewöhnlich bei jener Partei zu beginnen, die den Präsidenten stellt, in diesem Fall also bei den Republikanern. Denn einem amtierenden Präsidenten wurde noch nie von seiner Partei die Kandidatur vorenthalten. Somit müßte man auf republikanischer Seite im Jahr 1976 mit Sicherheit Präsident Ford als Kandidaten erwarten.
Nun, seine Aussichten, kandidieren
zu können, sind ausgezeichnet, aber seine' Kandidatur ist keine Selbstverständlichkeit. Denn Präsident Ford wurde nicht vom Volke gewählt, er wurde von Präsident Nixon zum Vizepräsidenten ernannt, weil sein Vorgänger Agnew dieses Amt niederlegen mußte — und er wurde überdies zu einem Zeitpunkt ernannt, da sich der Abgang Präsident Nixons selbst bereits abzeichnete. Er ist der erste Präsident, der nicht gewählt, sondern auf Grund des sogenannten 25. Amendments vom Kongreß bestätigt wurde.
Daß Präsident Ford noch von gewissen republikanischen Kreisen angefochten wird, jst verständlich, und daß in seiner eigenen Partei Politiker mit der Idee spielen, gegen den Präsidenten in Vorwahlgefechten anzutreten, ist erklärlich. Um das gleich vorwegzunehmen — die Opposition ist nicht bedeutend, aber man muß sie immerhin analysieren und beschreiben. Sie ist vor allem auf dem rechten Flügel der Republikanischen Partei konzentriert Hier gibt es in der Person des ehemaligen Gouverneurs von Kalifornien Reagan einen äußerst attraktiven und populären Kandidaten, einen Politiker, der trotz seiner konservativen Ansichten bewiesen hat, daß er in einem so volkreichen Bundesstaat wie Kalifornien immer wieder gewählt werden konnte.
Die konservativen Republikaner sind überdies von Präsident Fords Politik enttäuscht. Ursprünglich war er einer der ihren. Als Abgeordneter eines konservativen Wahlkreises in Michigan immer wieder gewählt, republikanischer Fraktionsführer des Repräsentantenhauses, galt Gerald Ford als Denkmal des Konservativismus. Meiner Meinung nach ist er als Präsident konservativ geblieben, doch hat er es jetzt mit einem überwiegend demokratischen Kongreß zu tun. Um regieren zu können, muß er Kompromisse schließen und wenn er mit fliegenden Fahnen unterliegt, haben die Konservativen auch nichts davon. Bis vor kurzem schien er jedoch für
konservative Augen das Bild einer schwankenden Persönlichkeit zu bieten, eines Politikers ohne Profil, der weder intellektuell noch charakterlich seinen Aufgaben gewachsen sei. Es war nicht einmal sicher, ob er auch wirklich kandidieren würde. Zunächst hüllte er seine politischen Pläne in alle möglichen Kautelen, die er von der Gesundheit seiner an Krebs operierten Frau abhängig machen wollte. Erst später erklärte er sich an der Präsidentschaft 1976 interessiert, vor allem als es klar wurde, daß er sonst keinerlei politisches Gewicht in die Waagschale zu legen habe. Doch irgendwie glaubte man ihm seine Ambitionen noch immer nicht und ein Bodensatz dieses Zweifels ist heute noch vorhanden, obwohl sich sein Image grundlegend geändert hat und er jetzt immer wieder seine Kandidatur herausstellt.
Wendepunkt war der Zwischenfall um das gekaperte Frachtschiff Maya-guez, für dessen militärische Befreiung die Presse Präsident Ford erstmals Kredit einräumte. Seither geht es mit Ford aufwärts, nicht zuletzt auch, weil der Kongreß — trotz gewaltiger demokratischer Mehrheiten — bis jetzt unfähig war, positive Maßnahmen zu beschließen und das Bild einer unfruchtbaren, in ein paar Dutzend Fraktionen zerfallenen „Quatschbude“ vermittelt — wie das Parlament in Frankreich vor der „Machtergreifung“ durch de Gaulle. Den Offenbarungseid mußte der Kongreß kürzlich leisten, als er unfähig war, sich auf ein Energiespar-programm zu einigen, während er die Vorschläge Fords ablehnte. Die daraus resultierende Optik: der Kongreß streitet, der Präsident arbeitet zumindest. Aber viele kleine Erfolge formen sich zu einem positiven Bild, so daß Fords Popularität wieder auf annähernd 50 Prozent von bisher 40 Prozent gestiegen ist.
Wer aber wird Fords Gegner sein? Auf demokratischer Seite ist nicht nur alles offen, es bieten sich nicht einmal mehrere Alternativen an. Wohl gibt es bereits etwa ein halbes Dutzend Kandidaten. Darunter die Senatoren Jackson und Muskie oder den Abgeordneten Udall — aber abgesehen von den beiden erstgenannten sind die Namen derer, die ihren „Hut in den Ring“ geworfen haben, in der weiteren amerikanischen Öffentlichkeit ebenso unbekannt wie in Europa.
Man kann sich daher bei dieser Analyse auf drei Kandidaten beschränken — vielleicht auf drei ganze und zwei halbe.
Um die beiden Halben durch Eliminierung aibzutun: der eine ist der bereits einmal gescheiterte Senator von Maine, Muskie, der ander« der wie ein Stehaufmännchen immer wieder emporschnellende Humphrey, beides Politiker der Vergangenheit, die kaum noch ein Echo bei den Wählern auslösen. Ein politisches Comeback ist in Amerika immer schwierig, diesmal wird es noch schwieriger, denn die Demokraten wollen einen Sieger. Eine Siegfriedfigur, die allein durch ihr Auftreten schon alles zum Rückzug zwingt. Daß dieses Bild weniger als gar nicht auf den von Nixon geschlagenen, unter Johnson als Vietnam-vizepräsidenli belasteten Humphrey paßt, dürfte einleuchten, auch wenn man eben diesem Humphrey persönliches Stehvermögen nicht absprechen kann — war er doch noch vor-
einem Jahr ein vom Krebs gezeichneter Schwerkranker. Muskie hat sich schon im letzten Wahlkampf als zu weich erwiesen, er verfiel unter der Wirkung eines politischen Tiefschlages bei den letzten Vorwahlen in öffentliches Schluchzen, und einen larmoyanten Präsidenten kann man hier nicht sehen. So dürfte das Rennen zwischen den drei „ganzen Kandidaten“ liegen, von denen bis jetzt erst Senator Jackson offiziell kandidiert hat.
Es ist schwer zu begründen, warum man sich Jackson nicht als demokratischen Kandidaten vorstellen kann. Auf dem Papier spricht nämlich vieles für ihn. Er genießt starke Unterstützung durch die Gewerkschaften und betont, wann immer er kann, seine Sympathien für Israel; Somit sollte er zwei der stärksten Wählergruppen hinter sich haben, große Teile der Arbeiterschaft und des Judentums in den für eine Präsident-schaftswahl so wichtigen Großstädten. Und trotzdem kommt er im Popularitätsrennen nicht weiter. Denn Jackson ist ein trockener, humorloser Patron, ein Mann ohne äußere Brillanz, der außenpolitisch immer wieder ausrutscht und, trotz heiligem Eifer, die Anliegen, die er fördern will, nicht weiterbringt. Sehr typisch war seine ans tölpelhafte grenzende Haltung in der Frage der jüdischen Emigration aus der Sowjetunion, mit der er schließlich soviel Porzellan zerschlug, daß heute kaum mehr Juden aus der Sowjetunion auswandern können.
Senator Jackson ist einer der letzten kalten Krieger, ein unermüdlicher Kritiker der Detente gegenüber Rußland. Aber gerade die Kreise, die er durch seine proisraelische Haltung anzieht, stößt er wieder durch seine antisowjetischen Kreuzzüge ab.
Eine mächtige Gestalt dagegen — bei verkrüppeltem Äußeren — ist der Gouverneur von Georgia, George Wallace. Wäre er im Wahlkampf 1972 nicht einem Anschlag zum Opfer gefallen, der ihn fürs Leben an den Roll stuhl fesselt, hätte sein Eingreifen schon 1972 die politische Landschaft verändert. Denn Walllace besitzt einen starken, seit Jahren sich langsam ausbreitenden Anhang im unteren Mittelstand und kontrolliert damit eine der Schlüsselpositionen jedes Wahlkampfes. Er vereinigt eine antikommunistische Außenpolitik („im Zweiten Weltkrieg bekämpften wir den falschen Gegner“) mit Antimonopolparolen, er vertritt die Interessen der von den Negern zur Seite gedrückten Masse der „kleinen Weißen“ und repräsentiert republikanisches Gedankengut, wenn er gegen Machtkonzentration und Geldvergeudung der Regierung auftritt. Er spricht eine einfache, aber kräftige Sprache und hat das Charisma eines kleinen Demagogen, das vor allem im Süden des Landes große Wirkungen erzielt Aber es wäre falsch, deswegen Wallace einen nur regionalen Kandidaten zu nennen. Sein Anhang wächst in den kleinen Agrargemeinden des Mitteliwestens ebenso wie in den Industriezentren
des Ostens, wo er der Exponent der gehobenen Arbeiterklasse ist, die bereits etwas an erarbeiteter Substanz zu verlieren hat. Wallace ist ein Politiker, der sein natürliches Reservoir immer ausschöpft und langsam an den Rändern gewinnt, weil ihm immer wieder der Durchbruch nach oben verwehrt wird. Immer mehr Wähler sagen sich, nach immer neuer Enttäuschung über den Kandidaten, den Sie schließlich wählten: „Vielleicht wäre Wallace doch der richtige Mann gewesen.“ Wurde ihm der Durchbruch 1972 durch die Kugel eines Attentäters verwehrt, so stößt er heute nicht bloß gegen seine Rollstuhlexistenz (auch Roosevelt wurde im Rollstuhl gewählt), sondern gegen die unversöhnliche Ablehnung des liberalen Elemente in der Demokratischen Partei, das vielleicht zahlenmäßig leicht dominiert, aber die Führung und den Kader der Partei stellt.
So wendet sich die Aufmerksamkeit, der Wunsch und die Hoffnung der Demokraten einer Kandidatur Senator Ted Kennedys zu, des letzten überlebenden Bruders der merkurischen Dynastie, der die Geschichte bisher die Erfüllung ungezügelter Hoffnungen und Erwartungen vorenthalten hat. In Kennedy sehen die Demokraten den sicheren Sieger, eine hehre Rittergestalt des Fortschritts und der Versöhnung und endlich wieder einen demokratischen Präsidenten, in dem seit Eisehhower von Republikanern besetzten Weißen Haus. Ob Kennedy als Präsident alle diese Hoffnungen erfüllen kann, ist zunächst unwichtig. Wichtig ist vielmehr, daß er sich bis jetzt beharrlich geweigert hat, zu kandidieren. Er begründet seine Zurückhaltung mit der Rücksicht auf seine Familie (Frau Alkoholikerin, Sohn mit krefosampu-tiertem Bein). Aber die wahre Ursache dürfte doch in dem noch immer in Dunkel gehüllten Unfall von Chappaquidick liegen, bei dem eine Sekretärin nach einer fröhlichen Party mit ihm in seinem Beisein ertrunken ist. Der Unfall warf Fragen über sein charakterliches Verhalten und seine Reaktionen unter Krisenbedingungen auf, die in einem Wahlkampf, vor allem mit einem so inte-
gren Kandidaten wie Ford, sicher eine Rolle spielen würden. Die Mehrzahl der Demokraten meinte, dies sei schon alles vergessen und wenn ein nationaler Appell an ihn erginge, werde Kennedy trotz aller Bedenken kandidieren und gewinnen. Diese Prognose ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Kennedy würde wahrscheinlich einem solchen Appell auch Folge leisten, wenn seine Aussichten, gewählt zu werden, tatsächlich sehr günstig stünden. Er müßte dann aber auch Wallace als Vizepräsidenten gewinnen, was er bereits einmal versucht hat, bevor seine Chancen in den Fluten von Chappaquiddick versanken. Meiner Ansicht nach beruht aber Kennedys Stärke lediglieh in der Schwäche anderer demokratischer Kandidaten und setzt daher voraus, daß sich keiner unter ihnen in den langwierigen Vorwahlgefechten klar durchsetzt. Es ist fast mit Sicherheit auszuschließen, daß Kennedy ein aktiver Bewerber um die demokratische Kandidatur wird, es ist aber durchaus möglich, daß er einem Appell des nominierenden demokratischen Parteikongresses im Sommer 1976 nachkommt und als Deus ex machina um die Präsidentschaft — aller Wahrscheinlichkeit gegen Ford — ringen wird.