
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kennedy und die Roosevelt-Legende
Unsere schnellebige Zeit stürzt ihre Idole ebenso schnell wie sie diese aufrichtet. Auch dem Idol Kennedy widerfährt das nun, wohlgemerkt dem Idol, nicht dem Menschen Kennedy, dessen Andenken die Ikonoklasten besser schonen sollten.
John F. Kennedy war zweifellos ein intelligenter, ja brillanter, ein lauterer und letztlich idealistischer Mann, der sich selbst nichts schenkte, unermüdlich an sich arbeitete und von seiner Sendung, Amerika zu neuer Größe zu führen und der Welt einen dauerhaften Frieden zu sichern, überzeugt war. Es ist seine Tragik, gerade dadurch zum eigentlichen Vater des Vietnamkrieges geworden zu sein, dieser blutig-sinnlosen, Amerika zutiefst demütigenden Verstrickung; es ist die Ironie der Geschichte, daß Kennedys Gegenspieler Richard Nixon nunmehr die Aufgabe zufällt, den verfahrenen Karren der amerikanischen Politik wieder aus dem Schlamme zu ziehen.
War Kennedy nicht nur brillant, sondern auch eine Persönlichkeit?
Was an ihm faszinierte, war nicht, was er leistete, sondern was er verkörperte. Kennedy war ganz und gar Verkörperung; das erklärt die welt weite Bewunderung, die ihm trotz dem Fehlen greifbarer Erfolge zuteil wurde, das führte aber auch zu jener Ideolisierung, die heute umschlägt und auch das Andenken des Menschen in Frage stellt.
Er war die Verkörperung einer Haltung, die anfangs der sechziger Jahre als zukunftsweisend schlechthin galt, die Verkörperung einer Politik, die damals schier unbeschränkte Hoffnungen weckte; und diese Haltung, diese Politik sind es, die gescheitert sind.
Der Kennedy-Mythos, von dem jetzt soviel gesprochen wird, ist eigentlich nur eine Linse, worin sich in einer für die Pupille des Menschen von heute gemäßen Weise das Bild einer älteren politischen Wirkkraft bricht: der Roosevelt-Legende. Sie war es, die Kennedys Handeln bestimmte.
Franklin D. Roosevelt erfüllte (um seine Legende hier auf ihre außenpolitische Seite zu beschränken) scheinbar den großen Traum der amerikanischen Linken: die Aussöhnung mit der Sowjetunion; während der Endphase des zweiten Weltkrieges schien die Verwirklichung der befriedeten „einen Welt“, der pax russo-americana, der gemeinsamen
Weltherrschaft zweier verbündeter Supermächte, greifbar nahe.
Nur erlittene Unbill und Mißtrauen, so nahm man im Westen an, haben die Sowjetunion bewogen, sich aus der demokratischen Völkerfamilie auszuschließen; durch Roosevelt sei aber Stalin von den ehrlichen Absichten Amerikas überzeugt worden, habe sich zum „good old uncle Joe“ gewandelt, mit dem es sich reden lasse.
Knapp vor Kriegsende starb Roosevelt, bald danach kam die große Enttäuschung: die Gemein samkeit mit der Sowjetunion wurde nicht gefunden, Spannung, Feindseligkeit, kurzum der Kalte Krieg mit seinen heißlaufenden (Französischindochina, Korea) und feuergefährlichen (Berlin) Gefahrenpunkten waren die Folge.
Verpaßte Chance zum Weltfrieden?
Hatte sich Roosevelt in Rußland getäuscht, wäre auch ihm der kalte Krieg nicht erspart geblieben, hätte er diese traurige Notwendigkeit nur noch später als seine Nachfolger erkannt und noch mehr Stellungen eingebüßt als diese? Oder hat Truman, der „kleine Haberdasher aus dem Mittelwesten“, der sich nach und nach der außenpolitischen Berater Roosevelts entledigte und das State Department dem Antikommunisten Acheson übergab, das Erbe Roosevelts vertan, die große Chance für den Weltfrieden verpaßt?
Für die Rooseveltianer, übrigens durchaus nicht lauter lupenreine Linke, war die Sache von Anfang an klar: der Kriegspräsident hätte die dauernde Aussöhnung mit Rußland zustande gebracht, nur seine Nachfolger haben die große Stunde ungenützt verstreichen lassen. Die Roosevelt-Legende war entstanden.
Der gemeinsame Feind als einigendes Band; die ewige Waffenbrüderschaft als Gewähr für Frieden und Vertrauen: das waren und sind die außenpolitischen Fixsterne des Rooseveltianismus.
Die Roosevelt-Legende wuchs sich zur Kyffhäuser-Sage aus. Als schließlich Stalin starb und, nach dem Malenkow-Zwischenspiele, in Chruschtschow einen „liberalen“ Nachfolger fand, schien den Roose- veltianern die versäumte glückhafte Stunde wiederzukehren; nur der Kyffhäuser mußte sich noch auftun.
Die Zurück-zu-Roosevelt-Politik war nicht erst von Kennedy erfunden worden. Schon Adlai S. Stevenson, zweimaliger Gegenkandidat Eisenhowers bei den Präsidentschaftswahlen, hatte sich zu ihr bekannt. Aber erst Kennedy vertrat sie überzeugend und unter dem Einsatz des publikumwirksamen Pompes eines intellektuellen Expertenapparates; er war es, der gleichsam aus dem Kyffhäuser trat.
Kennedy stellte seine Präsidentschaft ganz bewußt und betont als Roosevėlt-Renaiss an c e dar, besonders nachdrücklich war das in der Außenpolitik der Fall: um aber das Versäumte nachholen zu können, mußte die Ausgangslage, wie sie beim Tode Roosevelts herrschte, wiederhergestellt, die „Waffenbrüderschaft“ erneuert werden.
Nun war mit der deutschen Gefahr kein rechter Staat mehr zu machen: sie eignere sich zwar (und eignet sich noch immer) vortrefflich für Sonntagsreden kommunistischer Funktionäre, die ihren aufmuckenden Untertanen das Gruseln lehren wollen, doch die kühlen Rechner im Kreml wissen genau, daß die deutsche Gefahr für Rußland heute ebenso der Vergangenheit angehört wie die türkische für Mitteleuropa. Für die Waffenbrüderschaft bedurfte es daher eines neuen Feindes, eines Ersatzdeutschlands.
Hier hatte Kennedy eine für seine Zeit noch neue und fast kühne Erkenntnis: im kommunistischen
China, das sich immer mehr von
Rußland lossagte, ja gegen den roten Seniorpartner Stellung bezog, wuchs der Sowjetunion ein neuer, gefährlicher Feind heran, viel gefährlicher, weil aggressiver als das außenpolitisch konservative, ausgleich-
suchende Amerika.
Unter der Last der Roosevelt-
Legende zog aber Kennedy aus dieser richtigen Erkenntnis eine be- stürzend falsche Schlußfolgerung. Er, der den Pragmatismus zum Leitfaden seiner Politik gemacht hatte, den seine Gegner oft eines planlosen Opportunismus in Tagesfragen ziehen, war bei den Grundgedanken seiner Politik erstaunlich doktrinär.
Statt den Zwiespalt zwischen Rußland und China reifen zu lassen und sich selbst freie Hand zu bewahren, griff er den Ereignissen in allzu visionärer Weise vor und legte sich im krampfhaften Bemühen, die Roosevelt’sche Ausgangslage gewaltsam wieder herzustellen, einseitig auf die Sowjetunion fest; er betrieb die Einkreisung Chinas als Vorleistung, ging deshalb daran, Südvietnam als Aufmarschstellung für eine mögliche zweite Front gegen China auszubauen, ohne mit der Sowjetunion die geringsten Abmachungen getroffen, geschweige denn Zusagen von ihr erhalten zu haben. Er schickte sich an, den Sowjets die Kastanien aus dem Feuer zu holen.
Amerika hatte sein Vietnamschlamassel, aber die große Gemeinsamkeit mit der Sowjetunion war ferner denn je. Eine kühn angelegte und gewiß auch ehrlich gemeinte Friedenspolitik wurde paradoxerweise zur Ursache eines blutigen Krieges — eine Warnung für alle, die Entspannungspolitik mit untauglichen Mitteln zu treiben versuchen.
Diese Ursachenverkettung wurde freilich infolge der Ermordung Kennedys jahrelang erfolgreich verschleiert: dessen Brüdern und Anhängern gelang es, dem amerikanischen Kyffhäuser einen zweiten Bewohner zu geben, die Roosevelt- Legende durch den Kennedy-Mythos zu ergänzen.
Um die Kennedy-Politik nachträglich zum Antivietnamkriegkonzept „umfunktionieren“ zu können, wurde Johnson zum neuen Truman gestempelt: sehr zu Unrecht, denn, was immer für Fehler ihm persönlich zur Last zu legen sind, er riß nicht wie Truman das Steuer herum, sondern setzte die Politik seines Vorgängers unverändert fort. Die Ergebnisse seiner Politik unterscheiden sich von jenen, die Kennedy erzielt hätte, möglicherweise nur um Nuancen.
Die jüngsten Presseenthüllungen, wiewohl anscheinend zunächst als Ehrenrettung Kennedys gedacht, haben den Kennedy-Mythos aber arg zerzaust. Viele Anzeichen deuten darauf hin, daß sich die amerikanische Linke daher heute anschickt, Kennedy fallen zu lassen: nicht er sei der zweite Roosevelt gewesen, der eigentliche linke Messias Amerikas müsse erst kommen (an Anwärtern für diese Funktion wimmelt es schon).
In Vietnam, das sei ausdrücklich festgehalten, ist aber nicht der Politiker Kennedy, sondern dessen Politik gescheitert; Kennedy war nicht der Schöpfer dieser Politik, sondern ihr Opfer, das Opfer jener Roosevelt-Legende, der er sich allzu unbedingt verschrieben hatte.
Nicht mit dem Menschen, sondern mit dem Idole Kennedy ist eine kritische Auseinandersetzung vonnöten; das ist ausdrücklich festzuhalten, damit nicht Kennedy nun zum Sündenbocke gemacht werde und die verfehlte Politik bei einem neuen Idole Unterschlupf finde. Ob die Mythentransfusion verhindert werden kann, hängt letztlich allerdings nicht so sehr von noch so überzeugenden Enthüllungen, sondern vom Erfolge der Alternativpolitik ab, die heute Nixon in die Wege lpitet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!
















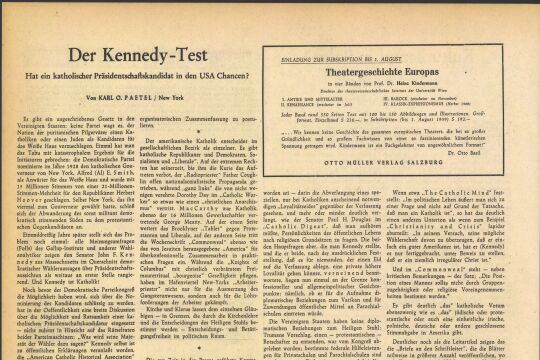





















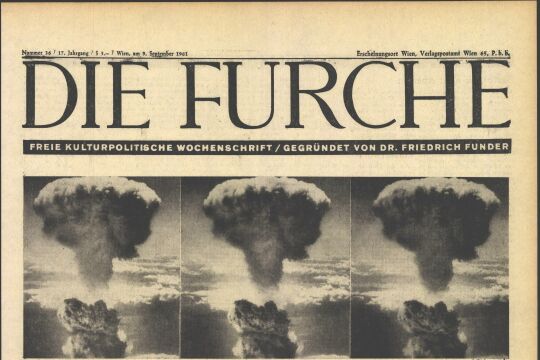






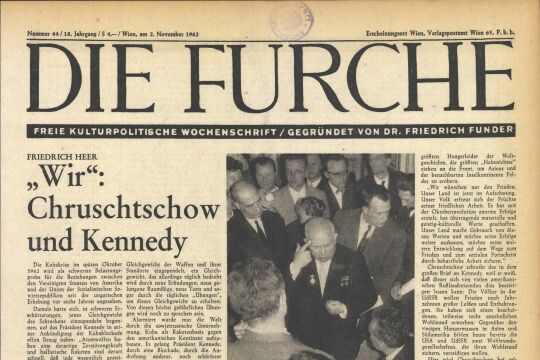






.jpg)












































