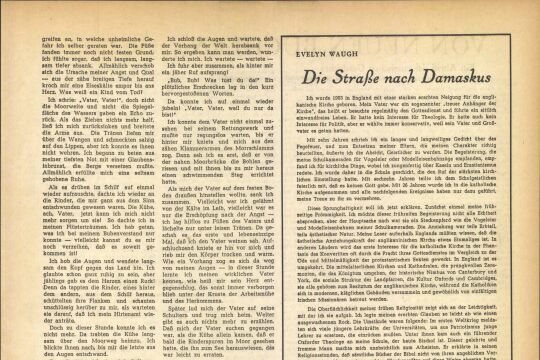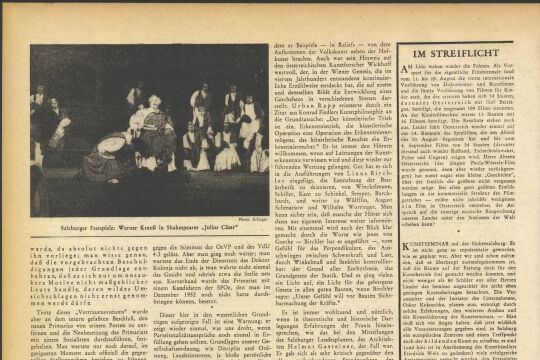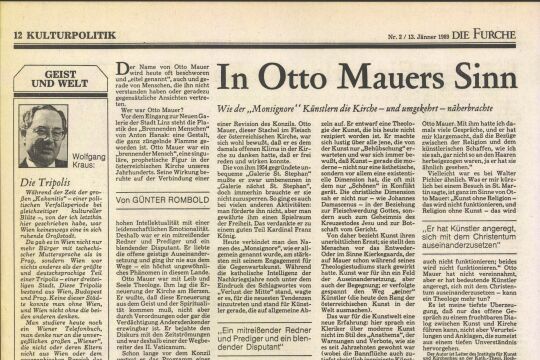Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kirche und Kunst
Als Eugene Delacroix um 1830 das große Erinnerungsbild an die Französische Revolution gemalt hatte - „Die Freiheit führt das Volk“ —, war unter anderem auch klar geworden, daß die alte Verwandtschaft von Kunst und Kirche zu Ende gegangen ist. Wie in Tiepolos Kirchenfresken steigt ein hübsches Mädchen auf die Barrikaden, weist über die Toten auf vermeintliche Gegner, die auf seiten der Betrachter stehen müßten; ihr folgt ein pistolenschwingender Knabe, ein Cupido der Revolution, während zur anderen Seite ein eleganter Bürger verdutzt zuschaut, im Gebrauch der Flinte noch unerfahren. Dahinter drängt ein aufgebrachter, anarchischer Haufen nach, Säbel schwingend wie Piraten. Am Horizont ist Notre Dame zu erkennen.
Die Komposition ist wie eine bewegte Auferstehungsszene,
doch die Allegorie säkularisiert Erlösung, Lossprechung und Heilserwartung durch das Motiv: Revolution ist immer. Das Christentum ist imitiert und verdrängt. Vermutlich schuf Anselm Feuerbach später das letzte Bild im Geist der alten Beziehung zwischen Kirche und Kunst: ein einsames Wegkreuz in menschenleerer Landschaft. Delacroix kündigte an, ab nun ist die Korrespondenz der Kunst mit der Kirche unterbunden, wie überhaupt die Bezeichnung „christliche Kunst“ — nimmt man Georges Roualt aus - gegenstandslos wurde. Alles, was künftig in engerer Beziehung mit Kirche steht, ist entweder geschmacklose Devo- tionalie (eine direkte Linie läßt sich von den Nazarenern zu den jämmerlichen „Kultgeräten“ für den Kirchengebrauch in Geschäften rund um Kathedralen verfolgen) oder die versuchte Okkupation der Kirche durch Kunst.
Der Künstler denkt nicht mehr daran, sich einem Konzept der Kirche unterzuordenen oder in seinem Werk eine Widmung anzuerkennen. Als Priester seiner selbst steht ihm zwar die Kirche zu, jedoch färbt sie sich im Werk nicht mehr ab. Denkt man in Wien an die „Wotruba“-Kirche, ist bereits eine Bezeichnung gewählt worden, die sich zuvor nur ein Heiliger oder Märtyrer verdient hatte. Le Corbusier war beschei-
dener, seine Kirche in Rochamps bleibt beim Ortsnamen, doch die sakrale Bestimmung leitet sich erst von der Funktion ab — sonntags.
Obwohl die Kirche grandiose Kunstschätze beherbergt, besitzt ihr Klerus eine erstaunliche Unbildung in Kunstgeschichte, was ihn fast in den Vorteil versetzt, nahezu unvoreingenommen der Kunst der Gegenwart gegenüberzustehen. Wegen der Unvoreingenommenheit ist weder die Kenntnis des Bruches zwischen Kirche und Kunst zu erwarten, noch wird der Verfall der Kunst im kirchlichen Rahmen bemerkt. Einerseits sind das Ergebnisse des bornierten Desinteresses, andererseits der Mangel an historischem Bewußtsein. Beide Positionen scheinen den innerkirchlichen Hang zur künstlerischen und kunsthandwerklichen Infantilität zu erklären. Im aufgeschlossenen Teil der Kirche sieht man sich zu einem Nachholverfahren in Sachen Kunst veranlaßt, der oft in gesinnungslosem Opportunismus verläuft, der größere Teil läßt es bei der bis zum Kitsch denaturierten „Deutschen Messe“ bleiben.
Die Heizbarkeit der Kirchen oder die Errichtung eines Liftes im gotischen Seitenschiff in eine Domherrengruft—etwa in St. Stephan - sind die Attitüden, die ei nerseits den Umgang mit der Geschichte charakterisieren, andererseits einen unbemerkten „Bildersturm“ inszenieren, dessen Wirkung vergleichbare historische Ereignisse nicht zu scheuen braucht. Die Kirche entsakrali- siert sich einmal selbst, obwohl sie gleichzeitig über den Verlust ihrer Rolle in der Kunst klagt.
Diese Schlaglichter sollen nur knapp die unverfrorene Hilflosigkeit der Kirche in Kunstfragen beleuchten. Diese Krise hatte aber wirklich der Zusammenbruch des Ancien regime vor 200 Jahren herbeigeführt.
Der Mangel an Kreativität im Katholischen, die Abirrung des Milieus in die sogenannte Volkskunst, was auch immer darunter zu verstehen ist und in den Strohstemen der Pfarrhelferstunden noch heute erhalten ist, das nahezu gänzliche Verschwinden der Theologie als seriöses Wissen im Vergleich zu der reformatori- schen (Bultmann, Bonhoeffer oder Schweitzer) und die Innovationsschwäche der Katholiken in der Politik nach 1918 bis 1933/34, 1938,1939 bis 1945 haben naturgemäß in der Kunst keine andere Wirkung ermöglicht als jene zum privaten Kitsch als heiler Welt inmitten einer unheilen.
Diese gewaltige Tragödie wur de erst in den fünfziger Jahren als Defizit erkannt. Die Bemühungen um die Kunst, um Rückstände aufzuholen, waren nicht problemlos. In Österreich hatte man begonnen, in der Art der Germanenmission die Kunst zu „taufen“, soweit sie sich nur in die Nähe kirchlicher Grundstücke wagte — so etwa die Galerie nächst Sankt Stephan. Da der Berg nicht zum Propheten kam, rückte Monsignore Otto Mauer vor. Er hatte der Kunst wohl alles wie einem ungezogenen Kind erlaubt und war der Initiator eines besonderen Verhältnisses zur Kunst, das über Jahrzehnte die kulturelle Entwicklung des Landes bestimmte, da er ja auch die katholischen Studenten nachhaltig beeinflußt hatte. Also agierten die Künste von kirchlichen Organisationen aus gegen ein Publikum, das sich noch katholisch bezeichnete.
Die Avantgarde hatte somit ein festes Kirchendach überm Kopf bekommen. Die weitere, vor allem aktionistische Entwicklung dominierte den auch staatlich anerkannten Stil. Schließlich, so es die Kirnst wünschte, geriet sogar die christliche Symbolik, die Gestaltungstradition ins Hintertreffen, wobei man darauf verweisen konnte, daß schon im Barock Kirchenräume in Theatersäle umfunktioniert worden waren. Die ser provokanten Liberalität stand das katholische Milieu fassungslos gegenüber. Dieses Milieu war für die Künstler das beste Betrachtungsobjekt für die tiefe Animosität des Reaktionären gegen das Modeme, wie auch der Grad der Ablehnung ein Maßstab für die Fortschrittlichkeit der Kunst wurde.
Daraus entwickelte sich die Vorstellung der sechziger Jahre, allein schon das Vergießen von Lammblut über Kasein und Mädchen erfüllte in mystischer Weise erneut alte religiöse Praktiken. Bald war auch die „Kirche“ nicht allzuweit von der Überzeugung entfernt, die neuen Kulte und Kunstszenen seien kein uninteressanter Antagonismus zum Erlösungswerk, dem man nicht ganz glaubte, für immer das Opfer in sich aufgenommen und transformiert zu haben. Die Missionierung der Kunst hatte eine merkwürdige Paganisierung in Teilen der Kirche hervorgerufen. Im Spiel des Heidentums mischte die Kirche bald professionell mit, und viele Priester merkten nicht, wie sich der Kelch in einen geschmacklosen plumpen Messinggral wandelte. Auf den Kasein verschwand auch die traditionelle Symbolik zugunsten „freier“ Gestaltungen.
Mit der Einrichtung eines Bischofsamtes für „Kunst und Wissenschaft“ imitierte schließlich die Kirche nicht nur den Staat, sondern es wurde auch diese Würde selbst sonderbar transformiert. Der Bischof ist nicht mehr Hirt für Menschen, sondern quasi Vorsitzender einer Behördenstruktur. Das Besondere daran ist, daß bei dem unausgesetzten Vorwurf gegen die „neuen“ Bischöfe, den Rückschritt zu symbolisieren, die Kritik sich der Terminologie aus der Kunst bediente, deren Funktionszuteilung aber strikt in einer sonderbaren Erneuerung eines „Kirchenjosefinismus“ gefordert wird. Und wirklich wurde im Kunstbereich für die Vergabe der zahlreichen Preise, Förderungen und Stipendien eine .josefinische“ Konstellation geschaffen, die in Selbständigkeit und Selbstherrlichkeit der Studienhofkommission in nichts nachsteht.
Mit diesen Verwechslungen verlor die Kirche einerseits ihren historischen Scharfsinn für Kunst, andererseits sieht sie sich mehr und mehr der Bösartigkeit in der Kunst ausgeliefert, gegen die sie aber keine Einwände mehr geltend machen kann. Das jüngste Beispiel hiefür ist die römische Stellungnahme zu den „Satanischen Versen“, in der man zwi-
sehen der Zustimmung für beide Seiten schwankt. Nun ist bekanntlich die Vermischung von Gut und Böse das Böse schlechthin. Anstatt die Absage der Kunst an die Kirche als Signal zu werten, das die Kirche rechtzeitig gewarnt hatte, wurde diese Trennung noch immer nicht verstanden.
Die Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen Kirche und
Kunst werden zwar eingeebnet, jedoch enthüllen sie eine weitere Paradoxie: Die Kirche entsinnt sich immer weniger ihrer eigenen „Kunstformen“, ja sie meidet sie sogar: Wo werden noch Psalmen gebetet, die Lieder Davids? Sie läßt Kulturzentren errichten, die noch dürftiger sind als schmuddelige Warteräume von Bahnhöfen.
Die Kirche denkt hingegen eifrig in medialen Strukturen. „Lebendige“ Kirchen werden von charismatischen Kohorten besessen, die keinen Fremden zulassen und ihre eigenen Riten bilden. Gesucht wird eine Kirche, in der noch gebetet wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!