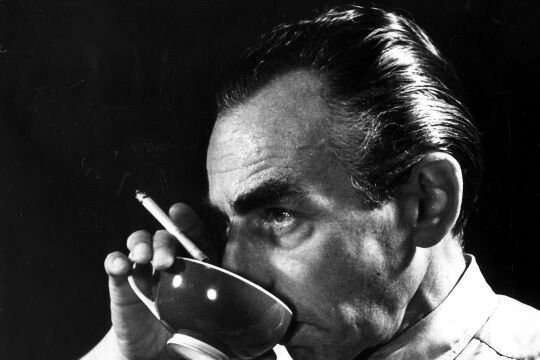Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Klassiker der Neuen Sachlichkeit
Er war unwesenitldch älter als unser Jahrhundert und sehr wesentlich mit seinem Jahrhundert verbunden.
Die deutsche Literatur wäre ohne ihn anders geworden als sie ist. (Ich schreibe bewußt „geworden“, nicht „gewesen“, denn das Gesicht der deutschen Literatur hat heute noch Züge, die sie Erich Kästner dankt.) Auch ohne die Welle modischer Wiederkehr angeblich goldener Vergangenheit reicht Kästners Lyrik in unsere Gegenwart.
Wie durchaus nicht golden seine Zeit gewesen äst, hat er in seinem lyrischen Oeuvre (und in seinem Fabdan-Roman) aufgezeichnet.
Ich erinnere mich noch präzise meiner ersten Begegnung mit seinen Versen. Es war im Winter 1926/27. In der Berliner Wochenschrift „Tagebuch“ las ich die Zustandsschilde-rung der Stenotypistinnen: Wir sitzen hinter Schreibmaschinen... Und mir wurde klar, daß man in diesem Augenblick so und nicht anders dichten mußte. (Wieder setzte ich ein Wort bewußt; und ich setzte das Wort nicht in Anführungszeichen: Kästner dichtete. Er hat den Ton und den Geist seiner Zeit im Gedicht, iim legitimen lyrischen Kunstwerk, kondensiert.)
Wenn Heinrich Heines beste Gedichte von den Ratten und von den Webern lyrische Kunstwerke sind (niemand bezweifelt es), war auch Kästner Lyriker. Auch er war um den Schlaf gebracht, wenn er an Deutschland dachte. Ihm gelang die erstaunliche deutsche Formulierung: Wenn wir den Krieg gewonnen hätten — zum Glück gewannen wir ihn nicht.
Man neigt zu vereinfachenden, sehr ungerechten Koppelungen, man sagt Schiller und Goethe, Sme-tana und Dvofäk, Raimund und Nestroy und vereint solcherart Unvereinbares. Und man begeht auch Unrecht, wenn man Kästner mit Tucholsky und Mehring (gelegentlich auch Ringelnatz) in einen Topf wirft. Tucholsky war ein Journalist höchster Ordnung, der auch Verse schrieb, Mehring ist ein Autor von Texten, die der 'Musik bedürfen. Kästner ist Lyriker, lyrischer Satiriker gewesen. Er holte das deutsche Gedicht, das sich vielfach verstiegen hatte, aus klassizistischen, neuromantischen, expressiven, dadaistischen Regionen herunter, herauf, zurück in den Tag der deutschen Wirklichkeit. Er erfand eine Sprache, die erfunden werden mußte, aber in ihrer scheinbaren Unabsichtlichkeit, ihrem lockeren Pariaado so selbstverständlich wirkte, daß man — indem man sie zur Kenntnis nahm — zu meinen geneigt war: dies wäre keine Kunst.
Am Montag fing die nächste Strophe an.
Und war doch immer nur dasselbe Lied.
Ein Jahr starb ab, ein andres Jahr begann.
Und was auch kam, nie kam ein Unterschied.
Er sang nicht kleine Lieder von großen Schmerzen, er besang nicht das große Weh, die große Not, er prokollierte mit liebevoller Wehmut und resignierendem Aufbegehren den tristen Zustand der Menschen deutscher Nation im trüben Zwielicht der Weimarer Republik.
Vieles, was uns neben und nach Kästner bis heute an zeitbezogenen Versen zugewachsen ist, bleibt ihm verpflichtet. Es ist ein Kompliment höherer Ordnung, daß man, auch wenn man stich dessen nicht bewußt wird, genötigt ist, seinen Ton, seine Reime, seine Strophen zu verwenden.
Er hat neben seiner „kleinen Versfabrik“ vieles andere produziert, einige der wenigen diskutablen Kinderromane in deutscher Sprache („Emil und die Detektive“, „Pünktchen und Anton“), er hat für das Theater, für den Film gearbeitet. Er mußte erleben, daß seine Bücher 1933 verbrannt wurden. Er war 1945 ein Mann der Stunde null, denn an seiner politischen Lauterkeit zweifelte niemand. Er hat dann unermüdlich die Obliegenheiten des kulturellen Alltags wahrgenommen, er hat mitgeholfen, Deutschland aus der Nachkriegszeit zur Selbstbesinnung zu führen.
Nach dem Ersten Weltkrieg, an dem er als fast noch Halbwüchsiger hatte teilnehmen müssen, war sein poetisches Ingenium dem Alltag gerecht geworden; nach dem Zweiten Weltkrieg stellte er seine literarischpublizistisch-politische Aktivität in den Dienst des Alltags.
Als er in den frühen fünfziger Jahren erstmals wieder nach Wien kam und der Presse begegnete, applaudierten die Wiener Journalisten bei seinem Erscheinen. Es gibt kaum eine gewichtigere und rarere Ehrenbezeigung als solchen Applaus.
Er war über alles, was er geschrieben hat, hinaus eine Institution, ein Begriff, ein Wahrzeichen geworden: der gute Deutsche dieses Jahrhunderts.
Der gute Deutsche ohne Anführungszeichen, der gute. Deutsche im guten Sinne dieses Etiketts, war immer ein Deutscher in Opposition gegen Deutschland. Durch das Trauma des ersten Kriegserlebnisses war die Einstellung für Erich Kästner vorgegeben. Und die Ratlosigkeit der Weimarer Ära legte die scheinbar „vatarlandsilose“ Haltung nahe: eine Untergangsstimmung, die damit rechnete, daß man, wie Kästner dichtete, „im Osten den Sarg zimmerte“, um die bürgerliche Gesellschaft zu Grab zu tragen.
Dann aber wurde im eigenen Land ein Sarg gezimmert, und Kästner stand vor der großen Entscheidung: gehen oder bleiben. Sein Bleiben wurde von den Zeitgenossen vielfach mißdeutet und mißverstanden, erscheint aber heute in neuem Licht, und dies nicht nur durch den Rückblick von 1945 her, sondern auch in Anerkennung des Entschlusses von Pavel Kohout, Ludwig Waculik und anderen, denen unsere Hochachtung für das Ausharren unter einem feindseligen Regime gebührt.
Kästner war durch das Trauma zweier „Reiche“ fixiert und geprägt, er war — wie viele seiner Generation — bedingungsloser Pazifist und Antimiliitarist alten Stils und als solcher, leider, dem bundesdeutschen Alltag, der ihm doch so viel Stoff für neue Verse gegeben hätte, ein wenig entfremdet. So blieb vieles, was. er.noch meisterhaft und dichterisch hätte sagen können, dem Establishment der gerissenen Protestsänger überlassen und der reineren lyrischen Sphäre vorenthalten.
Das Bedauern, daß Erich Kästners Fach verwaist war, obwohl in Erich Kästner selbst eine erste Besetzung dieses Fachs zur Verfügung stand, kann nur unzureichend ausgeglichen werden durch die Erkenntnis, daß Erich Kästners Gedichte und Epgramme ein rundes halbes Jahrhundert mit uns gelebt, bis heute keine Patina angesetzt haben, oft nachempfunden und nachgeahmt, nie erreicht wurden.
Er war in diesen seinen neu aufgelegten Büchern ganz stark, sonst aber nur noch rein physisch gegenwärtig;
Schon sein letzter erfolgreicher Kinderroman „Das doppelte Lott-chen“ erwies für seine Freunde schmerzlich das Nachlassen seiner schöpferischen Kräfte.
In einer Fernsehsendung zu seinem 75. Geburtstag im Februar 1974 (sie wurde heftig kritisiert, schien mir aber durchaus wohlgelungen) konnte der Jubilar nicht mehr in gebührender Gegenwärtigkeit gezeigt werden.
Er erlitt ein tragisches Geschick: Vom Angebinn seines Wirkens an war er auf die kommenden besseren Zeiten hin gerichtet. Und als sie dann da waren, konnte er nicht mehr weiter. Er scheiterte an der Erfüllung. Der neue Anfang, ' von dem er zeitlebens geträumt hatte, brachte ihm das Ende.
Er hatte seine Kräfte in zwei Kriegen und zwei Nachkriegszeiten verbraucht und war einer von gestern geworden, als der Friede kam.
Er ruhe in Frieden!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!