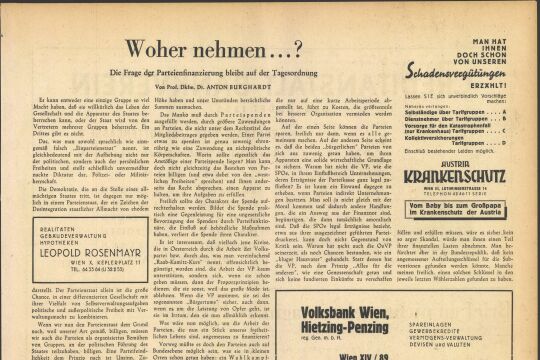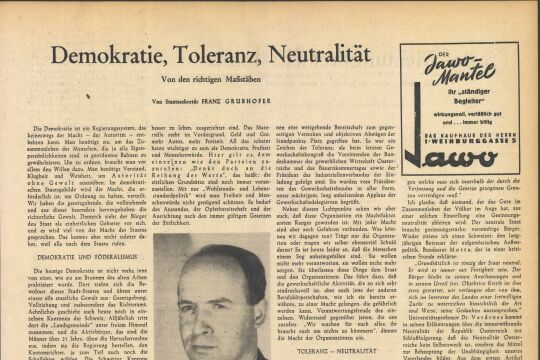Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Konflikt ist unerwünscht
Der Begriff „politische Kultur" bezieht sich nicht - wie man vielleicht meinen möchte - auf die Art und Qualität der politischen Institutionen eines Landes (z. B. auf das Funktionieren des parlamentarischen Systems, den Mechanismus der Sozialpartnerschaft, das Wahlrecht etc.), sondern vor allem auf Einstellungen der Bevölkerung zu diversen Elementen des politischen Systems, auf Werthaltungen, auf das innere Verhältnis der Bürger zu den Einrichtungen ihres Staates.
„Politische Kultur" wird analog zum Begriff „Eßkultur" gebraucht. Ihre Qualität ist nicht durch den Umstand bestimmt, daß es Messer und Gabeln gibt, sondern wie man mit diesen umgeht ...
Politische Kultur ist zweifellos auch an der Haltung der Bevölkerung gegenüber Staat und staatlicher Bürokratie abzulesen. Derzeit kann man den Ruf nach dem Staat und die Seufzer ob der steuerlichen und bürokratischen Omnipräsenz des Staates hören. Der aktuelle Ruf nach staatlicher Einmischung entspringt dem Wunsch nach Sicherheit, gepaart mit dem Glauben, daß staatliche Lösungen sichere Lösungen seien.
Es ist anzunehmen, daß bei Auftauchen relativ neuer Probleme (Umwelt, neue Technologien etc.) dieser geistige Reflex in Richtung Staatsinterventionismus noch einige Zeit weiterwirkt. Das hat dazu geführt, daß einer der blühendsten Produktionszweige die Gesetzesproduktion wurde.
Begrenzt wird der Glaube durch die limitierte Effizienz bzw. die Kosten staatlicher Leistungen. Verwaschene Information (mangelndes feedback) läßt die notwendigen Lernprozesse allerdings langsam ausfallen.
Steigender Problemdruck (z. B. Stadterneuerung) führt nicht zur Einsicht, daß eine gesetzliche Regelung nichts bringt, sondern zunächst zu einem neuen Gesetz, ohne daß das alte erprobt worden wäre.
Rascher begrenzt wird dieses „Sicherheitsstreben via Staat" durch die wahrgenommene Steuer- bzw. Gebührenbelastung, die ihrerseits die Wahrnehmung für die „Notwendigkeit" bzw. Uberflüssigkeit staatlicher Leistungen und ihrer Qualität schärft.
„Mehr desselben" im Bereich unseres Wohlfahrtsstaates führt somit unter Umständen zu mehr Diskussion über die Qualität öffentlicher Versorgung und gegebenenfalls zu einer „Staatskritik" aus Konsumgesichtspunkten.
Die Notwendigkeit einer Begrenzung staatlich produzierter Sicherheit wird aber auch Selbstorganisationsleistungen (und die dazugehörigen Werte, Tugenden und Kenntnisse) wieder stärker in den Vordergrund treten lassen.
Gemessen an der Bevölkerung anderer Staaten (BRD, Niederlande, Dänemark) ist das politische Verhalten der Österreicher bislang als eher orthodox zu beschreiben. Es zentriert sich auf den Wahlakt und die Mitgliedschaft in einer politischen Partei (letzteres oft nicht aus politischem Interesse, sondern aus utilitaristischen Überlegungen).
Unkonventionelle oder unreglemen-tierte politische Aktivitäten kommen deutlich seltener vor. Sie beinhalten oft eine Konfliktmöglichkeit. Konflikt will man nun weder auf individueller, noch auf Parteiebene.
In Kritik und Konflikt sieht man kein konstruktives Prinzip, sondern eine latente Gefahr. Man wünscht Harmonisierung und politische Zusammenarbeit und verkennt dabei das Unheil, das mit schlampig ausgetragenen oder verdrängten Konflikten einhergehen kann.
Mit zunehmender Frequenz von Bürgerinitiativen könnte sich die individuelle Konfliktbereitschaft im politischen Bereich etwas heben. Längerfristig ist dadurch auch mit mehr Konflikttoleranz auf globaler Ebene zu rechnen.
Dabei ist allerdings zu bedenken, daß Mehrheitsparteien Kritik noch längere Zeit als destruktiv kritisieren werden, die Opposition als „Nein-Sager" abzustempeln versuchen werden und sie in die Rolle des „Unruhestifters" und „Unsicherheitsfaktors" drängen wollen. Das wird die Entwicklung in Richtung auf eine positivere Neubewertung von Kritik und vernünftigem Konflikt sicher verzögern.
Als Kennzeichen politischer Kultur gilt auch das Ausmaß des Vertrauens in die Wirksamkeit eigener politischer Aktivität. Damit ist es derzeit nicht sehr gut bestellt (zurückhaltend ausgedrückt).
Man glaubt meistenteils, daß die politischen Entscheidungen „oben" von einigen wenigen getroffen würden. Die eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten stuft man als gering ein.
Beteiligung an Bürgerinitiativen. Briefe an den Ombudsmann einer Zeitung halten mehr Menschen für einen effizienten Ausdruck des eigenen politischen Wollens als die Beteiligung an Wahlen.
Trotz der Kleinräumigkeit des Landes und vieler sozialer Strukturen kann man in vielen Bevölkerungskreisen so etwas wie politische Entfremdung diagnostizieren. Und es ist fast unmöglich, etwas zur weiteren Entwicklung dieses Phänomens zu sagen.
Abnehmende politische Identität mit herkömmlichen Parteien müßte diese Formen von Anomie noch stärker hervortreten lassen. Wachsende politische Kompetenz in Einzelfragen (via Initiativen, kleineren Aktionsgruppen etc.) könnte dem entgegenwirken.
All dies geschieht nicht automatisch. Es ist Ergebnis vieler - in der Wirkung oft nicht abschätzbarer - Handlungen; aber auch Ergebnis unterlassener Handlungen. Demokratisierung zu predigen, aber nicht fühlbar werden zu lassen, soziale Gerechtigkeit zu postulieren, aber „Rolls-Royce-Sozialismus" zu praktizieren, Selbständigkeit zu verlangen und Staatssubventionen möglichst umfassend zu nehmen - all das verstärkt „politische Entfremdung" -und bedeutet unnütze Schwierigkeiten beim Erlernen politischer Kultur.
Diese aber ist nie für immer gegeben, sondern muß ständig neu gelernt, modifiziert und geübt werden - auf daß man sich sehr schmerzliche Lernvorgänge erspare...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!