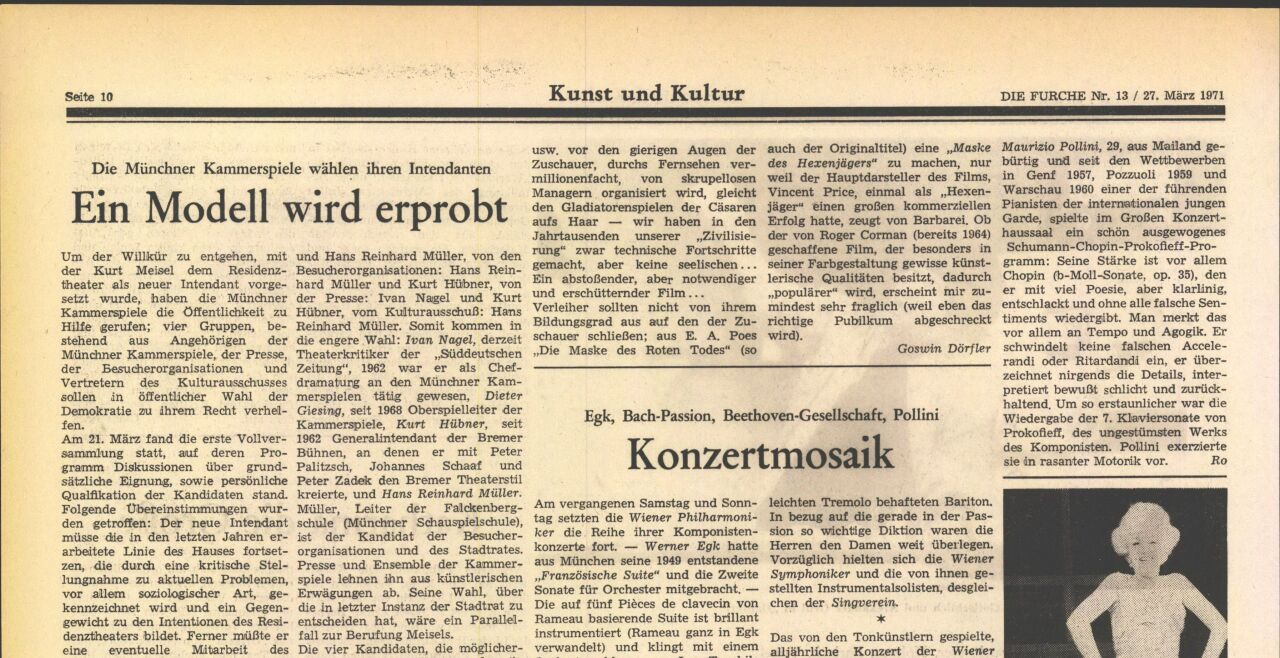
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Konzertmosaik
Am vergangenen Samstag und Sonntag setzten die Wiener Philharmoniker die Reihe ihrer Komponistenkonzerte fort. — Werner Egk hatte aus München seine 1949 entstandene „Französische Suite” und die Zweite Sonate für Orchester mitgebracht. — Die auf fünf Pieces de clavecin von Rameau basierende Suite ist brillant instrumentiert (Rameau ganz in Egk verwandelt) und klingt mit einem Orchesterschlager — „Les Tourbil- lons” — aus. Die zwanzig Jahre später entstandene, etwa 20 Minuten dauernde Orchestersonate schlägt andere Töne an: dissonantere, emo- tionellere, besonders in dem von zwei raschen Teilen flankierten lyrischen Adagio, das symphonisch-rhapsodischen Charakter hat und in seinem expressiven Chromatismus zuweilen an Skrjabin oder Alban Berg erinnert. Als kultivierter Musiker und versierter Orchesterleiter, der keine überflüssige Geste macht, zeigte sich Egk, der früher als Dirigent eigener Werke häufig am Pult stand, bei der Wiedergabe von Joseph Haydns Londoner Symphonie in D-Dur und als Begleiter von Ludwig Streicher, der das Konzert für Kontrabaß von Johann B. Vanhal spielte. Der heute fast vergessene böhmische Komponist, der mehr als 100 Symphonien und mehrere Opern geschrieben hat, wurde 1739 in Nehanice geboren, von einer Gräfin Schaffgotsch nach Wien gebracht, von Baron Rietsch für zwei Jahre nach Italien geschickt und starb auf den ungarischen Gütern des Grafen Erdödy… So sehr das technische Können, die musikalische Intelligenz und die künstlerischen Anstrengungen des philharmonischen Kontrabassisten Streicher zu rühmen und anzuerkennen sind, so bleibt der Ton des solistisch verwendeten ungefügen Instruments in den oberen Lagen doch eine prekäre Sache und ist ä la longue schwer erträglich. Aber das Publikum amüsiert sich, wie wenn Grock auf seiner Kindergeige spielt. Ein wenig kurios in einem philharmonischen Konzert. Aber halt mal was anderes
H. .A. F.
Die Leitung der Matthäuspassion im Großen Musikvereinssaal hatte an Stelle des erkrankten Karl Richter der als Bach-Dirigent bekannte Hanns-Martin Schneidt übernommen und ist durch den kontemplativen Charakter seiner Wiedergabe von der Aufführungspraxis seines Vorgängers etwas abgewichen. Trotz der Herausarbeitung der Dramatik der oft sehr zügig genommenen Chöre schwächt er deren Wirkung zugunsten der Bedeutung der betrachtenden Arien der Solisten ab, so daß diese zum Mittelpunkt der Aufführung werden. Zugegeben, daß Schneidt dadurch dem Charakter der Passion in der Sicht Bachs näher kommt als Richter, da er dessen stellenweise zu romantische, auf exzessive Wirkung eingestellte Auslegung meidet, so möchten wir doch der Auffassung Richters in ihrer erschütternden Eindringlichkeit den Vorzug geben. — Mit Hilfe guter Solisten kam eine eindrucksvolle Aufführung zustande. Allen voran ist Peter Schreier als Evangelist von höchster Ausdruckskraft zu nennen, sehr gut Werner Hollweg in den Tenorarien, die tiefen Partien sang Siegmund Nimsgem mit beweglichem Baß, und die Damen Elisabeth Speiser und Norma Procter waren die kultivierten Vertreterinnen des Sopran- bzw. Altfaches; den Christusworten lieh Ernst Schramm seinen vornehmen, leider mit einem leichten Tremolo behafteten Bariton. In bezug auf die gerade in der Passion so wichtige Diktion waren die Herren den Damen weit überlegen. Vorzüglich hielten sich die Wiener Symphoniker und die von ihnen gestellten Instrumentalsolisten, desgleichen der Singverein.
Das von den Tonkünstlern gespielte, alljährliche Konzert der Wiener Beethoven-Gesellschaft zum Todestag des Komponisten begann mit der Ouvertüre zu Glucks Reformoper „Iphigenie in Aulis”. Kam der heroische Zug im gewaltigen Unisono der Allegro-Einleitung unter Carl Melles zu wenig zum Ausdruck, so zeigte sich der Dirigent als ein um so sensiblerer Begleiter und Führer des Solisten in Mozarts Violinkonzert A-Dur. Dem für den Philharmoniker-Konzertmeister Rainer Küchl einspringenden jungen Nachwuchsgeiger Emst Kovacic verdankte man eine technisch ausgezeichnete, mit prachtvoller Legatokantilene ausgestattete Wiedergabe, die über den virtuos gespielten Kadenzen ein paar kleine Intonationstrübungen vergessen ließ. In das übermütige Scherzo der das Konzert beschließenden „Vierten” Beethovens kniete sich Melles mit sichtbarer Musizierfreude hinein und ließ es daran auch im Finale nicht fehlen. Der überaus starke Applaus des Publikums im Großen Musikvereinssaal galt in erster Linie dem Solisten.
Mit einem Programm von Schubert-, Schumann- und Sibelius-Liedem stellte sich Walton Grönroos, in Helsinki auch als Organist ausgebildet, im schlechtbesuchten Brahms-Saal dem Publikum als Konzertsänger vor. Sein kleiner, heller, oft tenoral klingender Bariton spricht am besten in der höheren Mittellage an, es gelingen ihm trotz viel zu hoher Schulteratmung oft gute Legatobögen, die dann wieder von Stellen abgehackter Tongebung unterbrochen werden. Gute musikalische Anlagen und eine saubere Diktion sind Positiva des Sängers. Doch sollte er sich sowohl auf Grund der ihm zur Verfügung stehenden rein lyrischen Stimmmittel als auch des fehlenden Ausdrucks bewußt sein, daß ihm dramatische Gesänge wie die „Gruppe aus dem Tartarus” nicht liegen. Erfreulich war die Bekanntschaft mit fünf zumeist schwermütigen Sibelius- Liedem. Am Flügel waltete mit einem Übermaß an Korrektheit, aber besonders bei Schumann recht trocken, Dagobert Buchholz. P. L.
Jean Guillou, einer der letzten Vertreter großen, romantischen Virtuosentums, sprang für den erkrankten Karl Richter im Orgelzyklus im Musikverein ein: Manual- und Pedaltechnik, Registrierung, klare Artikulation und Phrasierung beherrscht er mit schlafwandlerischer Sicherheit. Ereignis des Abends: die Wiedergabe von Mozarts f-MoU-Fantasie (KV. 608), die er in weich fließenden Konturen und dennoch sehr kontrastreich nachzeichnete. Brillanz entfesselte er bei Scarlattis Sonaten. Cėsar Francks mystisch versponnener Choral und vor allem eigene Kompositionen, Saga Nr. 2, 3 und 4, liegen ihm natürlich besonders nah. In seinen eigenen Werken schwebt ihm die Ausweitung des Orgeklanges in neue Bereiche vor, manches nähert sich da strukturell schon Ligetis „Volumina”, anderes ist geistig in Messiaens mystischem Klangerieben verwurzelt.
Maurizio Pollini, 29, aus Mailand ge- biirtig und seiit den Wettbewerben in Genf 1957, Pozzuoli 1959 und Warschau 1960 einer der führenden Pianisten der intemationalen jungen Garde, spielte im Großen Konzert- haussaal ein schön ausgewogenes Schumann-Chopin-Prokofleff-Pro- gramm: Seine Starke ist vor allem Chopin (b-Moll-Sonate, op. 35), den er mit viel Poesie, aber klarlinig, entschlackt und ohne alle falsche Sentiments wiedergibt. Man merkt das vor allem an Tempo und Agogik. Er schwindelt keine falschen Accele- randi Oder Ritardandi ein, er über- zeichnet nirgends die Details, inter- pretiert bewußt schlicht und zuriick- haltend. Um so erstaunlicher war die Wiedergabe der 7. Klaviersonate von Prokofleff, des ungestümsten Werks des Komponisten. Pollini exerzierte sie in rasanter Motonik vor.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































