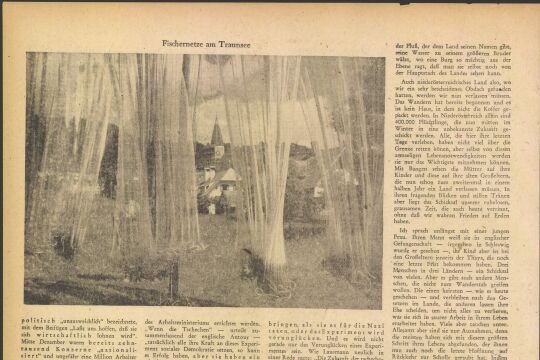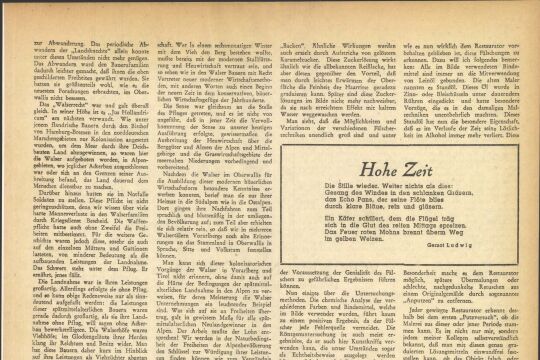Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Krankheit und Zuversicht
Über meine Wiese stolziert eine Bachstelze, den Kopf wie ein Pagodenbuddha nach vorne stoßend mit steifen flinken Beinen. Ja, sie stelzt richtig! Die Tage sind so trüb und kühl, daß selbst die Vögel ihr Gezwitscher eingestellt haben. Mein lieber weißer Hund steht ruhelos herum, er findet scheinbar keinen Platz, wo es ihm gefiele, sich hinzulegen. Unruhe, Gereiztheit, Nervosität, der Nachrichtenbrei, der nur von Blut, Tränen, Krieg und Terror berichtet. Beirut, Frankfurt, San Salvador, Nikaragua, Tripoli, Afghanistan und wieder Sabra und Shatila. Oh nein, dies ist alles nahezu unerträglich, und meine -unsere — Unruhe und Verzweiflung scheint schon Dimensionen angenommen zu haben, die sich zwangsläufig auf alles Lebende übertragen, das in meiner Nähe ist — sogar auf den Hund und die Vögel in meinem Garten.
Die eineinhalb Wochen im Spital haben mich in erster Linie an mich und meine Schmerzen denken lassen, aber jetzt, da die Wunde heilt, die Beschwerden nachzulassen beginnen, jetzt tauchen die Blutspuren der Geißelschläge, mit denen das Schicksal die Menschheit zur Zeit striemt, in all ihrer Grauenhaftigkeit wieder vor mir auf. Ich kann und will auch nicht so abschalten wie mein Bekannter, der Colonel Augier in Roque-Brussane, der nach Dien Bien Phu in Pension ging, genug von Krieg und Gestöhne hatte, sich zurückzog in sein Haus, seinen Garten und den kleinen Weinberg, und nie mehr eine Zeitung las, kein Radio hörte und kein Fernsehen zur Kenntnis nahm. Er will einfach nicht mehr! Musik von Platten und Band genügen ihm, und Bücher schildern höchstens, was gestern geschah. Er hat sich abgekapselt, eingepuppt in den Kokon der Erinnerung und des Heute, und nimmt einfach nicht zur Kenntnis, daß das Grauen auch dann existent ist, wenn er nicht hinsieht.
Was er da tut, hat Methode, aber ist doch keine Therapie. Ich will so nicht leben, will sehen und hören, will mir berichten lassen vom Hunger in Afrika, den wüsten Methoden am Kap, das längst alle guten Hoffnungen hat fahren lassen müssen, will mitleiden in Indien und wegen Polen. Es war schon immer mein Fehler, dabei sein, wissen und miterleben zu wollen, und für diese Neugier, Ohnmacht, Leidbereitschaft oder wie immer wir es nennen wollen, mußte und muß ich bezahlen. Oft komme ich mir vor wie der berühmte Monsie-ru Verdoux, der das Glas Bromwasser vor seiner Hinrichtung zurückwies mit den Worten—danke, ich bin zu neugierig.
Nun weiß ich aber selber, daß dieses Wissen-wollen und dann Begreifen-müssen auch seine Vorteile hat. Man mobilisiert unbewußt Abwehrkräfte in sich und in den Menschen seiner Umgebung, macht sie leidempfindlicher, sensibel und abwehr-, also hilfsbereit; und wenn die Menschen dann begriffen haben, daß sie - außer durch Mitgefühl und Geld—kaum helfen können, wenn die Geschundenen sich Zigtausend Kilometer entfernt befinden, dann öffnen sie wenigstens die Augen und manchmal sogar die Herzen für das Leid und Elend, das in ihrer unmittelbaren Nähe und Umgebung zu finden ist. Zu finden, ohne lange suchen zu müssen: Der kranke Nachbar, der verschämte Arme, der einsame Mensch, der hilfslose, von seiner kargen Rente kaum leben könnende Pensionist.
Rudolf Kirchschläger hat das schöne Wort „Der Friede beginnt im eigenen Haus” geprägt. Man kann es dahingehend abwandeln, daß man sagt: Helfen beginnt in der eigenen Sphäre.
Was nützen Mitleid, Wut und Gedanken an Flugzeugentführungen, Geiselqual und Massenmord, wenn sie nicht dazu führen, mir den Blick zu schärfen für das Elend meines Nachbarn?
Ich selbst habe erlebt, wie gut Zuneigung tut, wie heilsam ein gutes Wort, ein kurzer Besuch, ein Telefonat sein können.
Ich lag, nach einer Nierenoperation, mit aufgeschnittener Hüfte hilflos im Spital, wußte, schwach wie ich war, von Schmerzen gepeinigt, nicht einmal Tag und Stunde. Aber ein bekanntes Gesicht, das sich über mich beugte, eine vertraute Stimme im Ohr, ein Lächeln und ein zarter Händedruck haben mir geholfen. Und was war mein Leiden, was meine Schmerzen gegen Hunger, Tod, Angst und Terror?
Jetzt sitze ich wieder in meinem Garten, bin zurückgekehrt in diese Welt voll Blut und Tränen, in eine Welt, in der Sattheit, Hochmut und verzweifeltes Elend so eng nebeneinander liegen. Zurückgekehrt mit dem Wissen, daß Schmerzen bekämpfbar sind, Schicksale zwar nicht geändert, aber erträglicher gemacht werden können. Zurückgekehrt nicht ohne Hoffnung. Das ist viel.
Ich muß meine Nervosität, meine Niedergeschlagenheit bekämpfen, muß wieder Licht suchen und Zuversicht, um sie weitergeben zu können. Ich werde erst wieder ruhige Nächte haben, wenn ich weiß, daß ich helfen konnte — dem Bruder, den ich nicht kenne, von dem ich nichts weiß, nichts als das eine, daß er leidet
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!