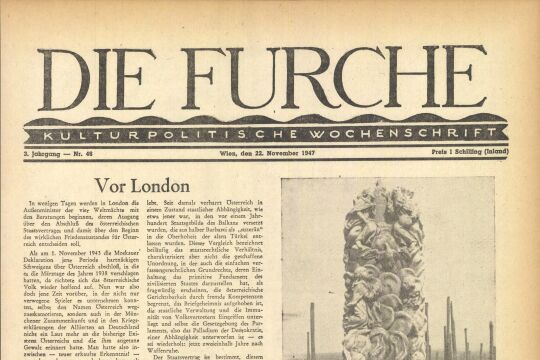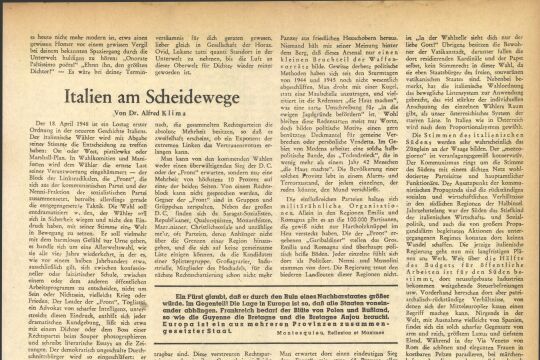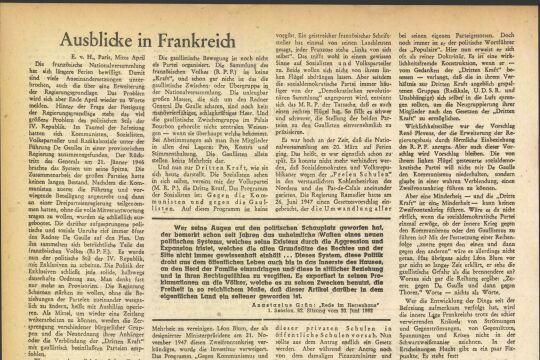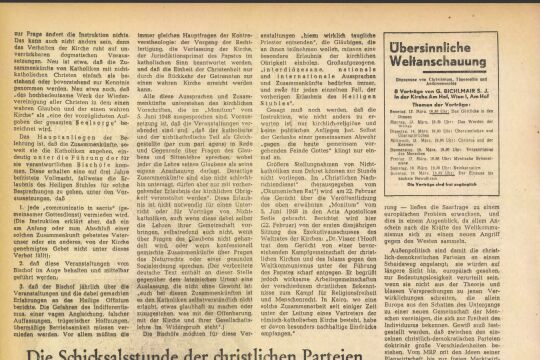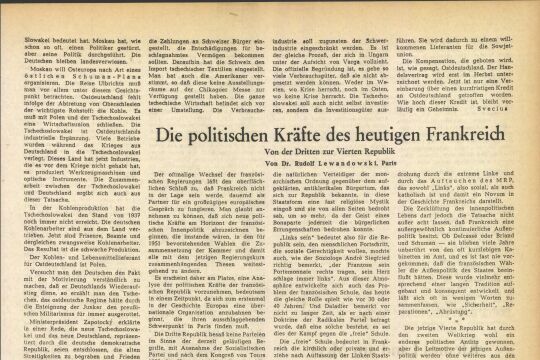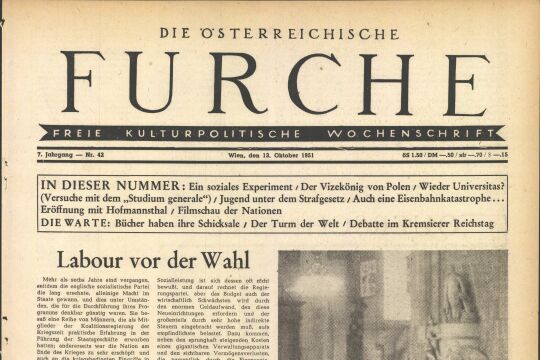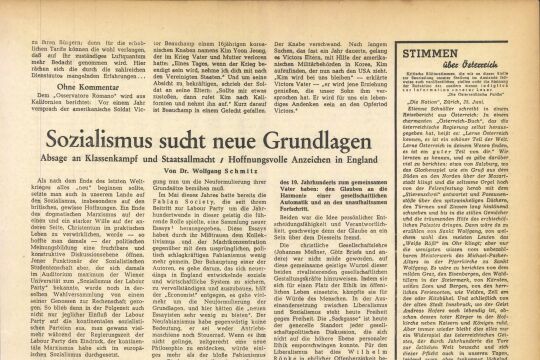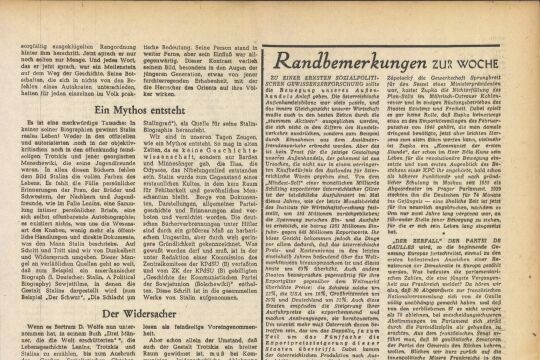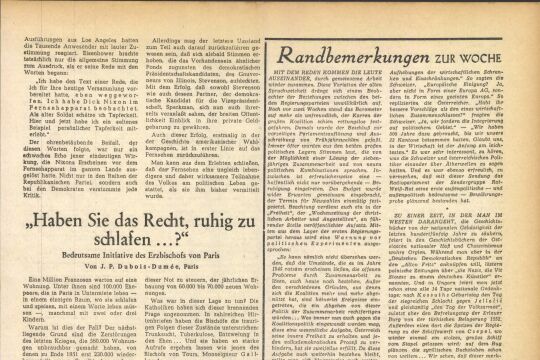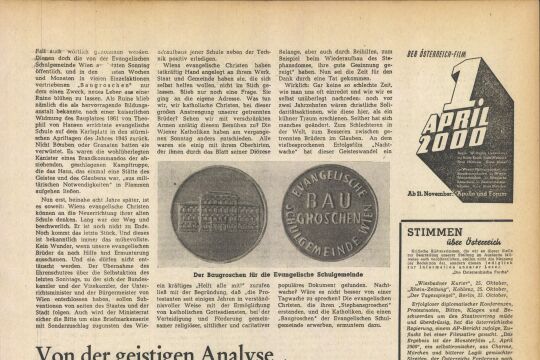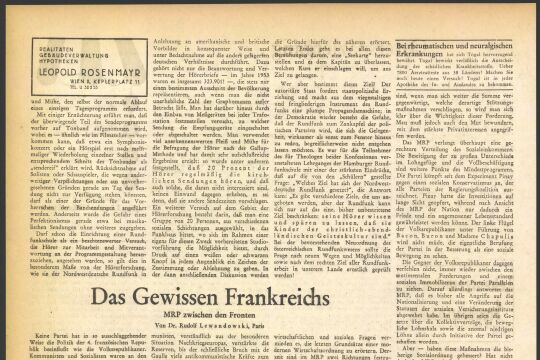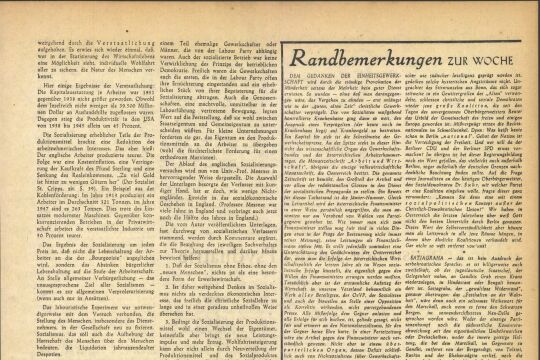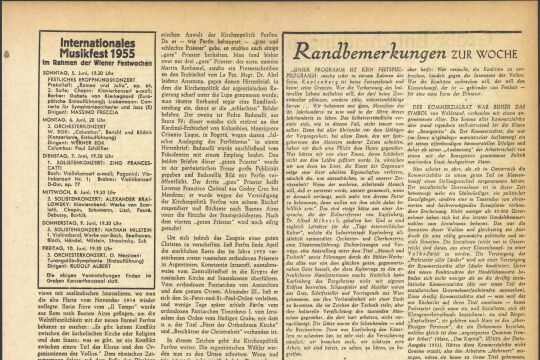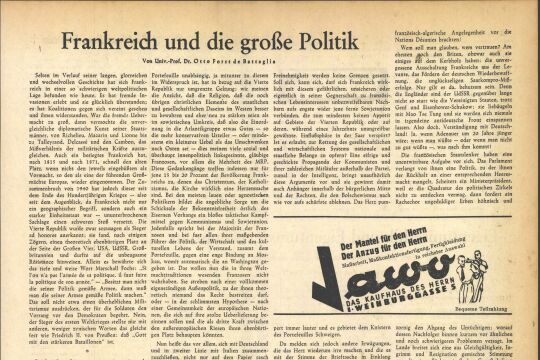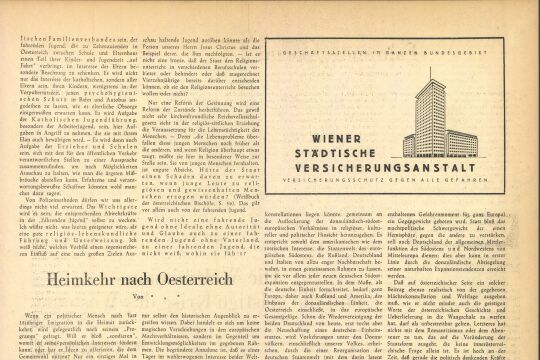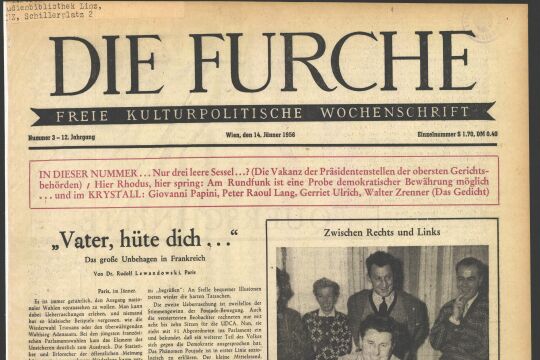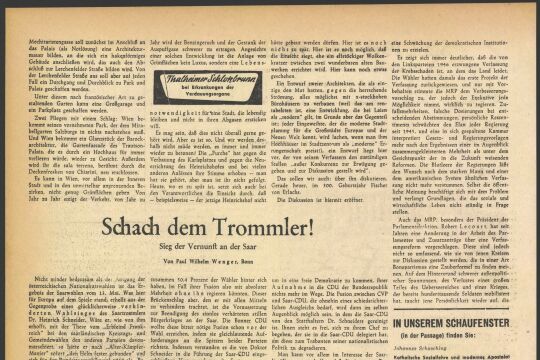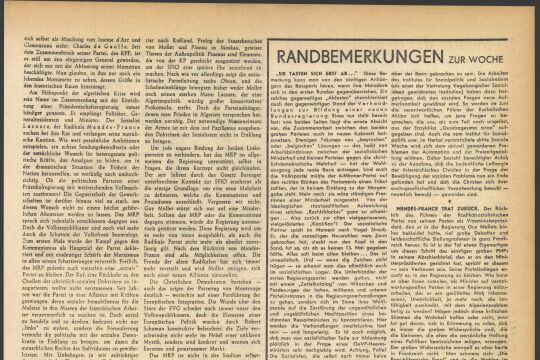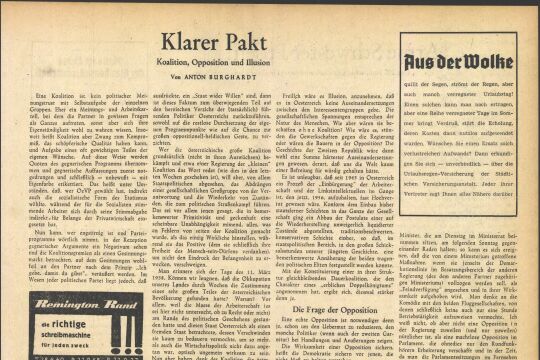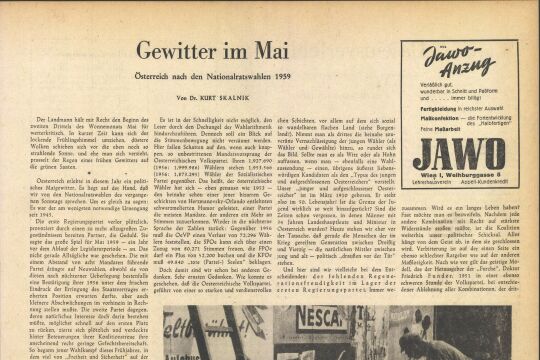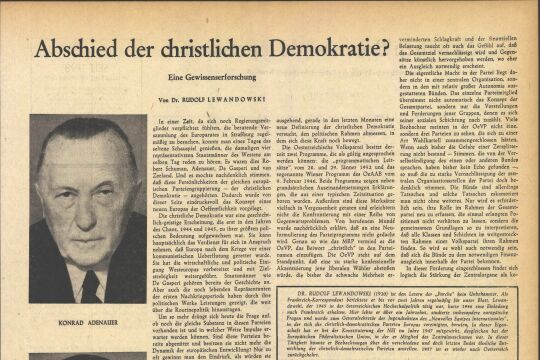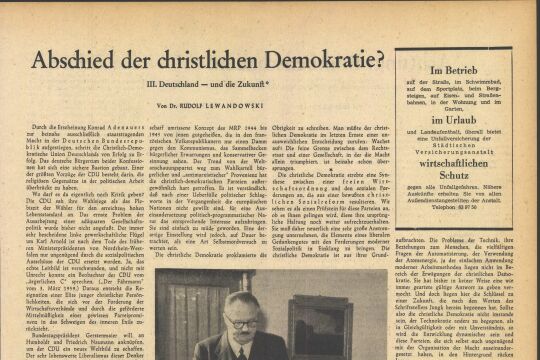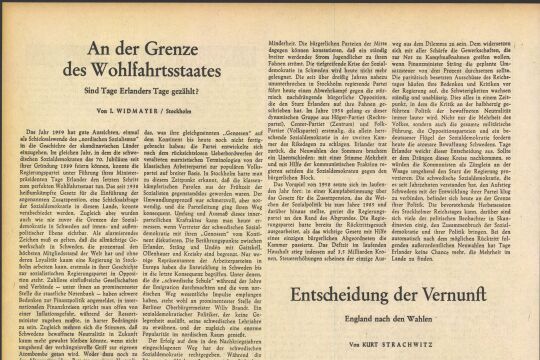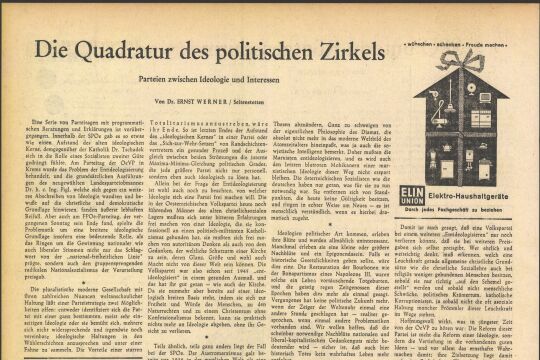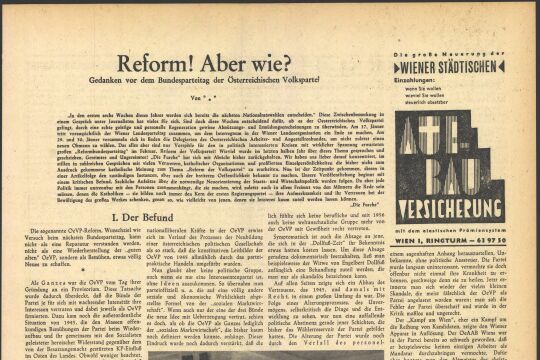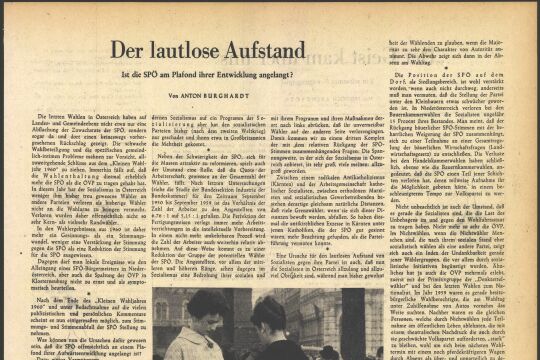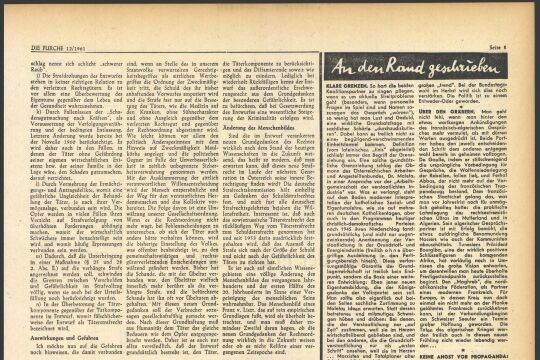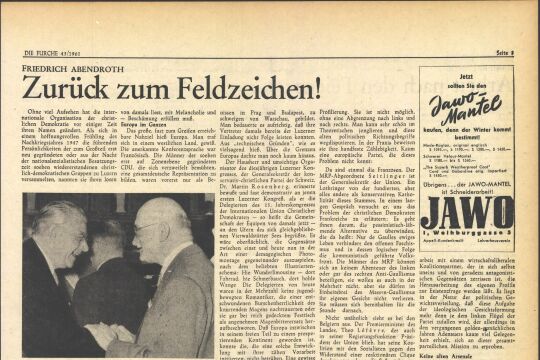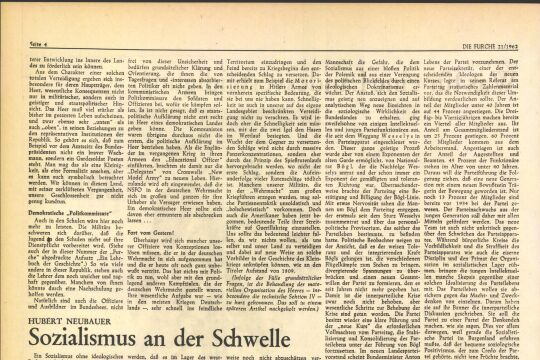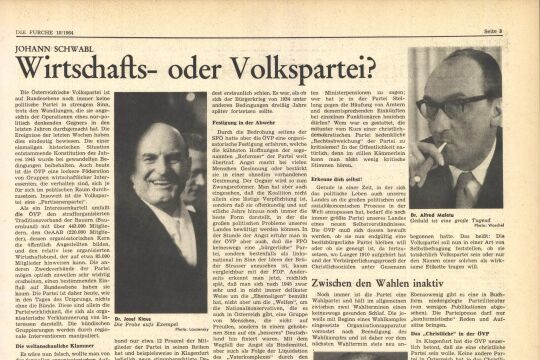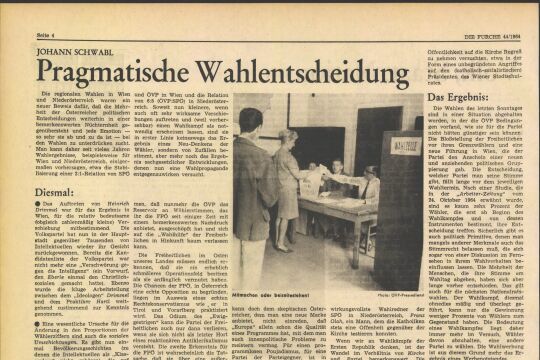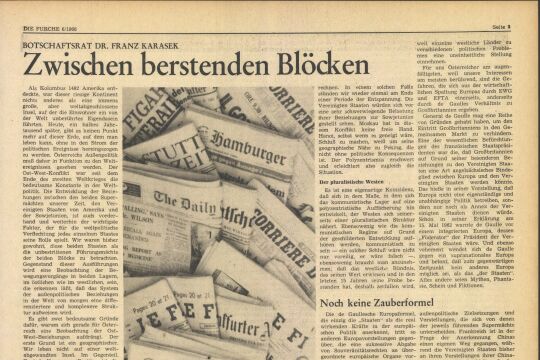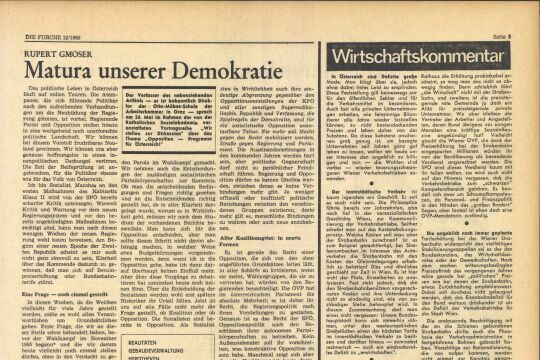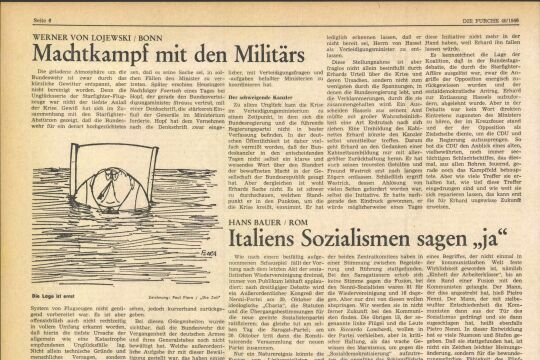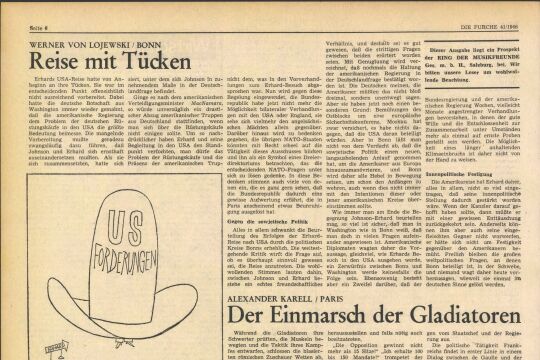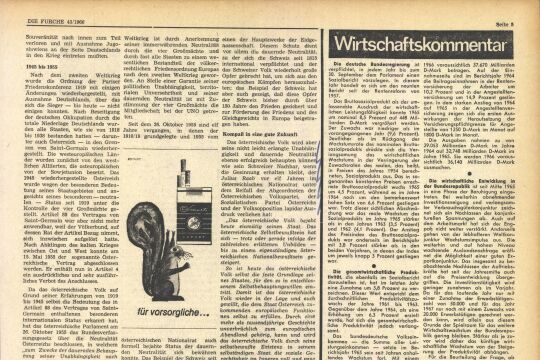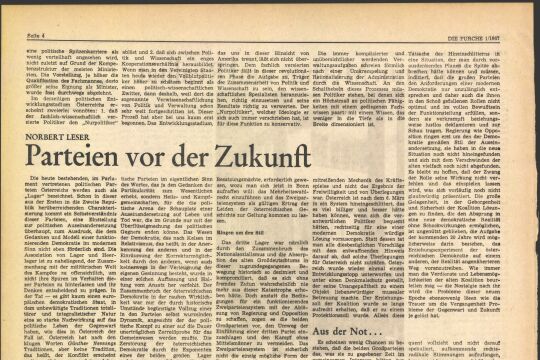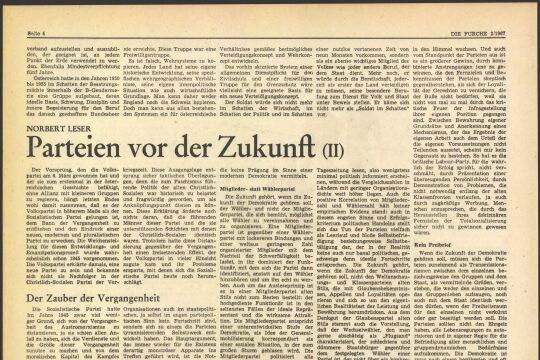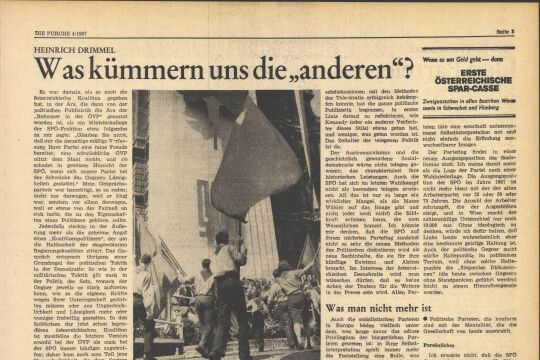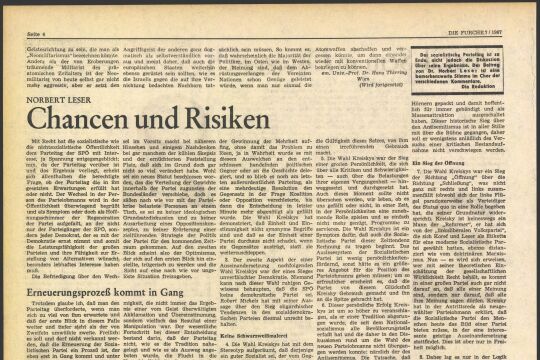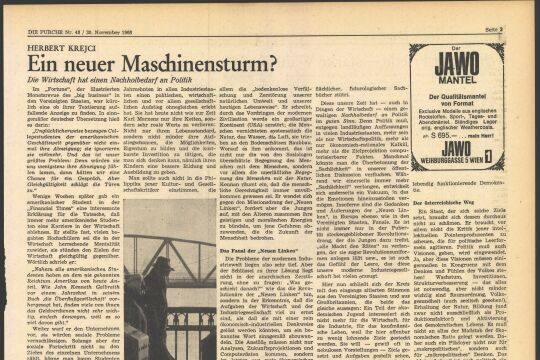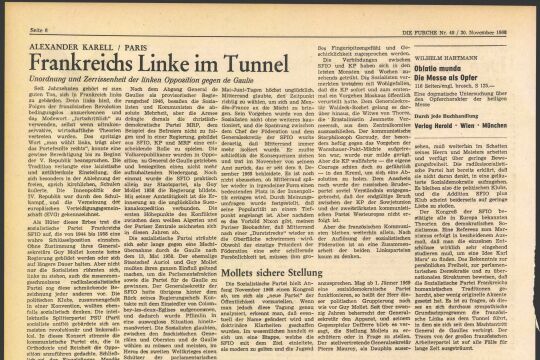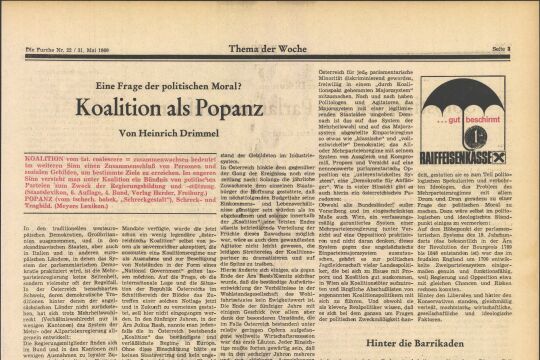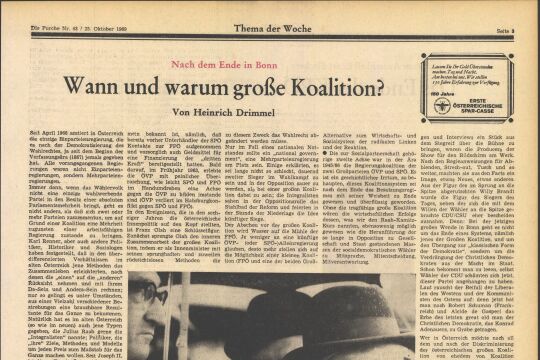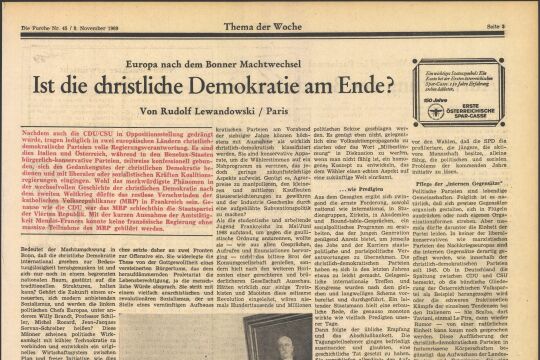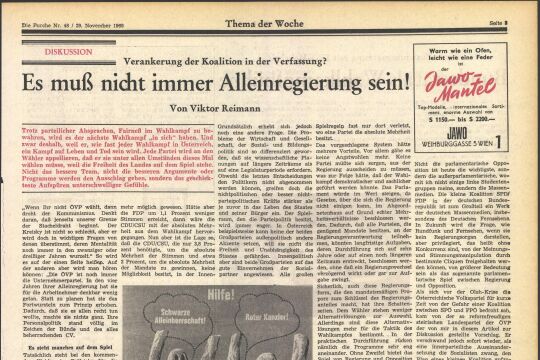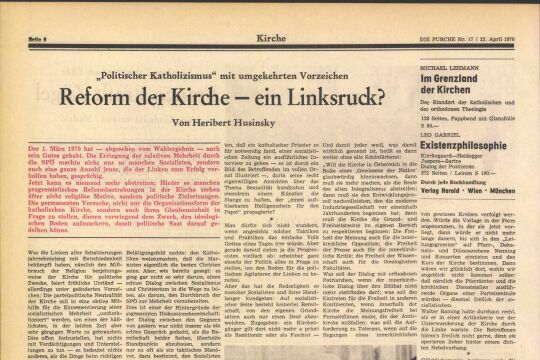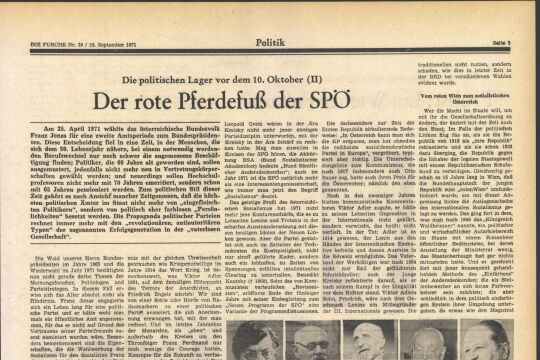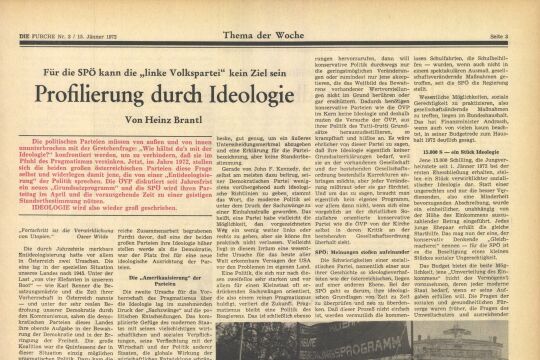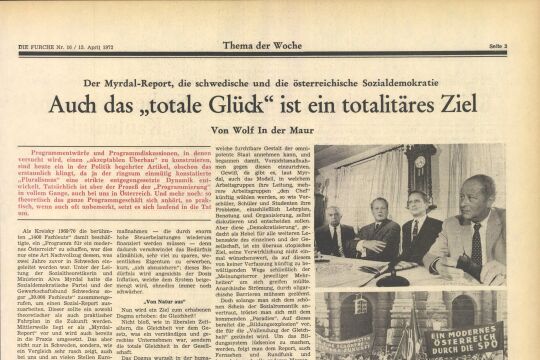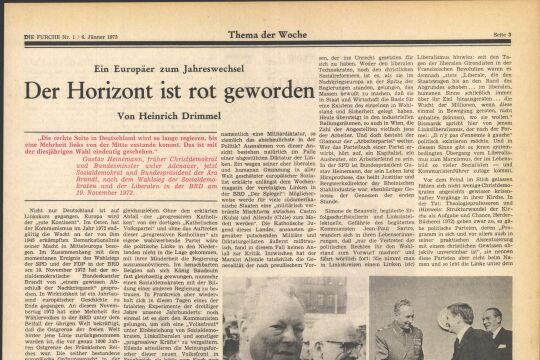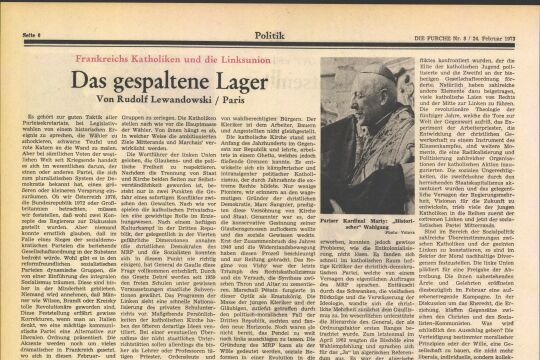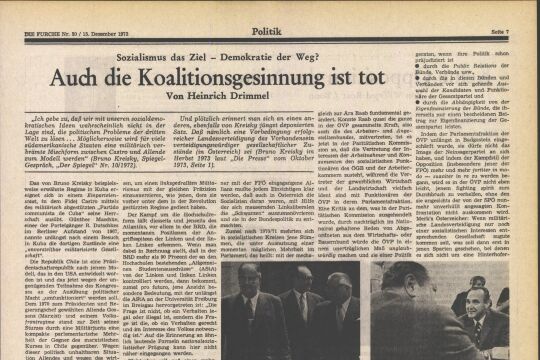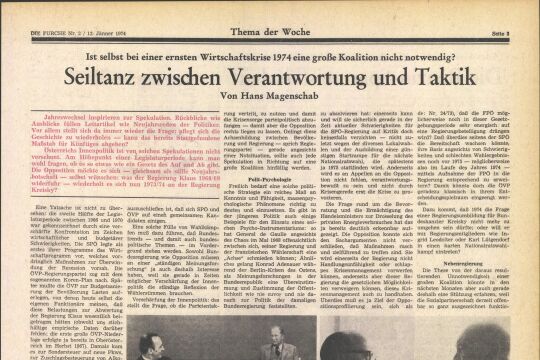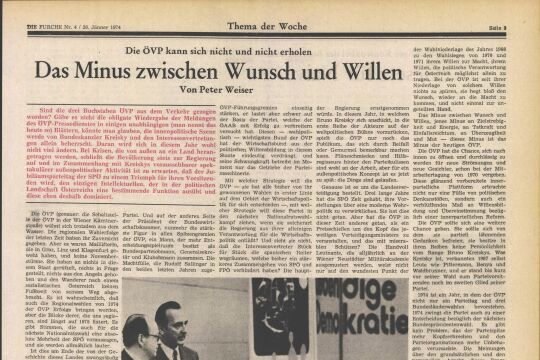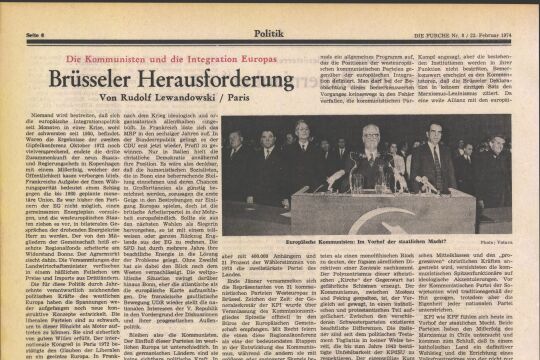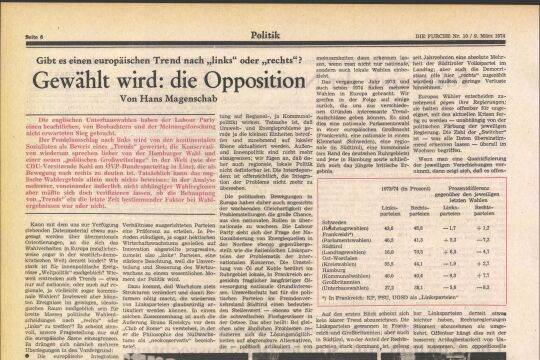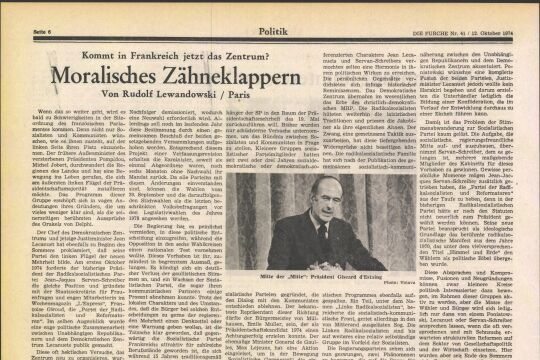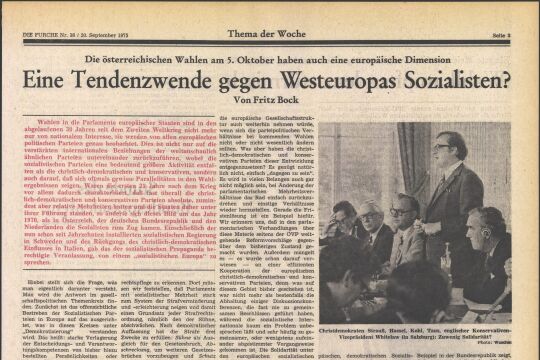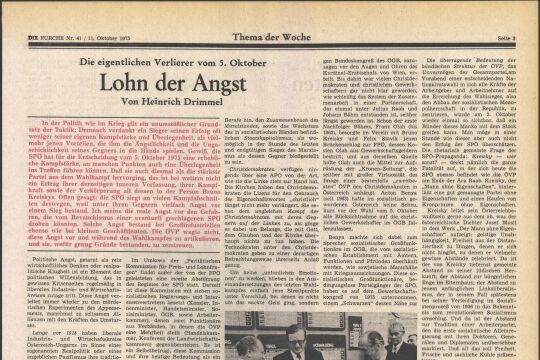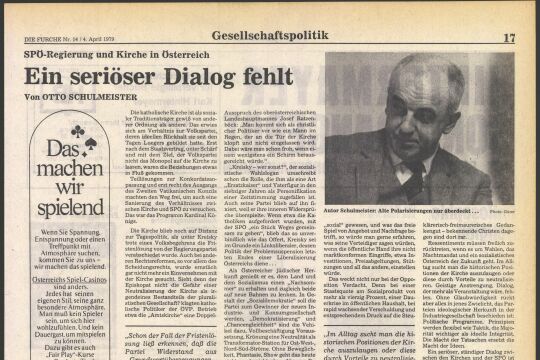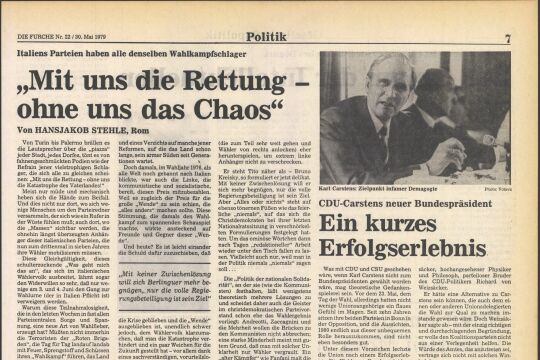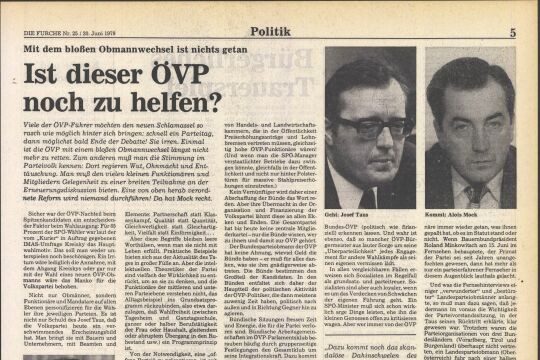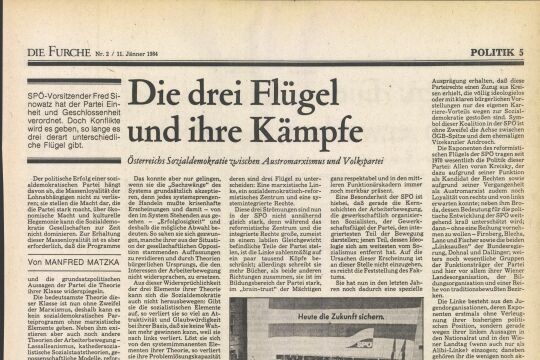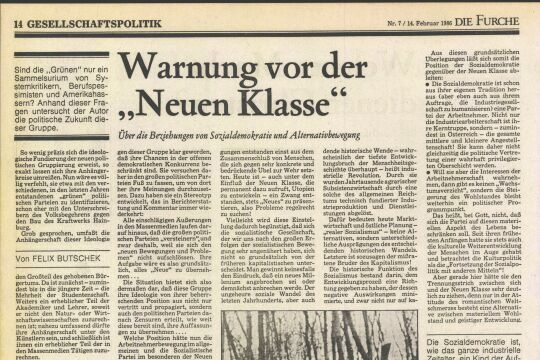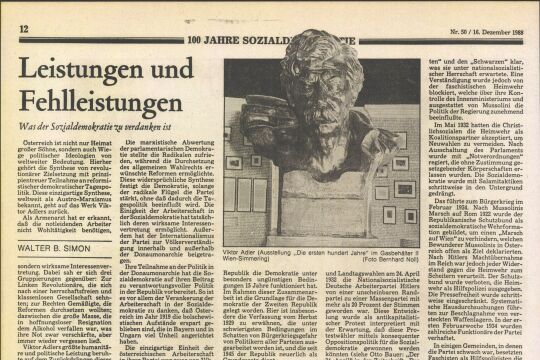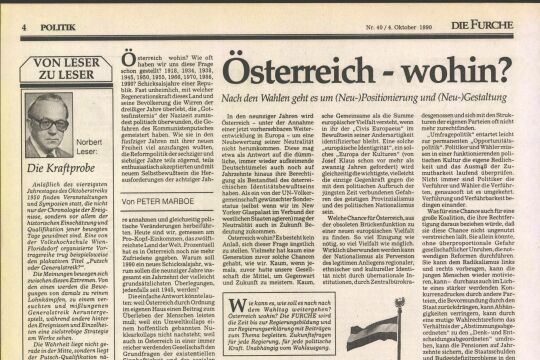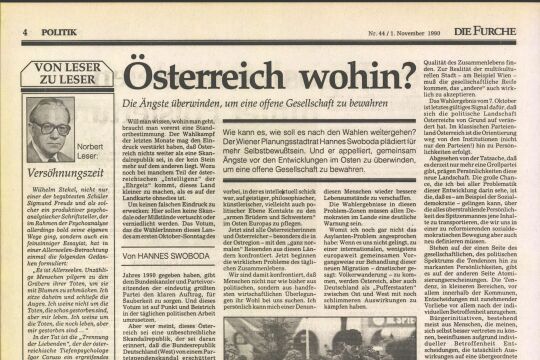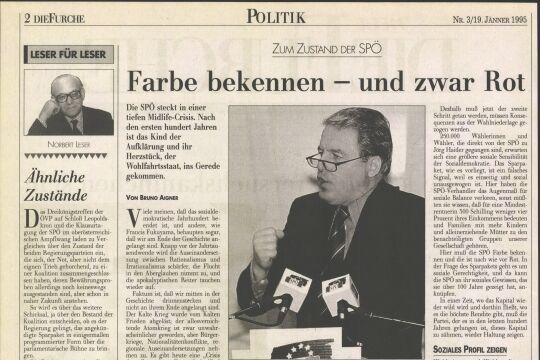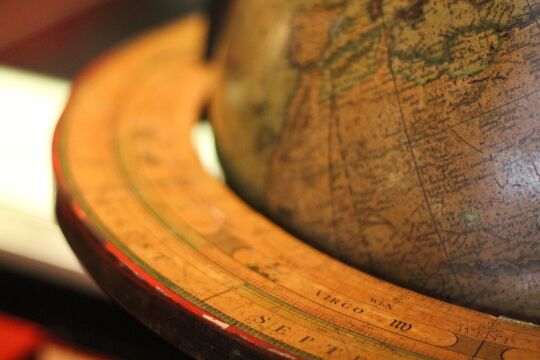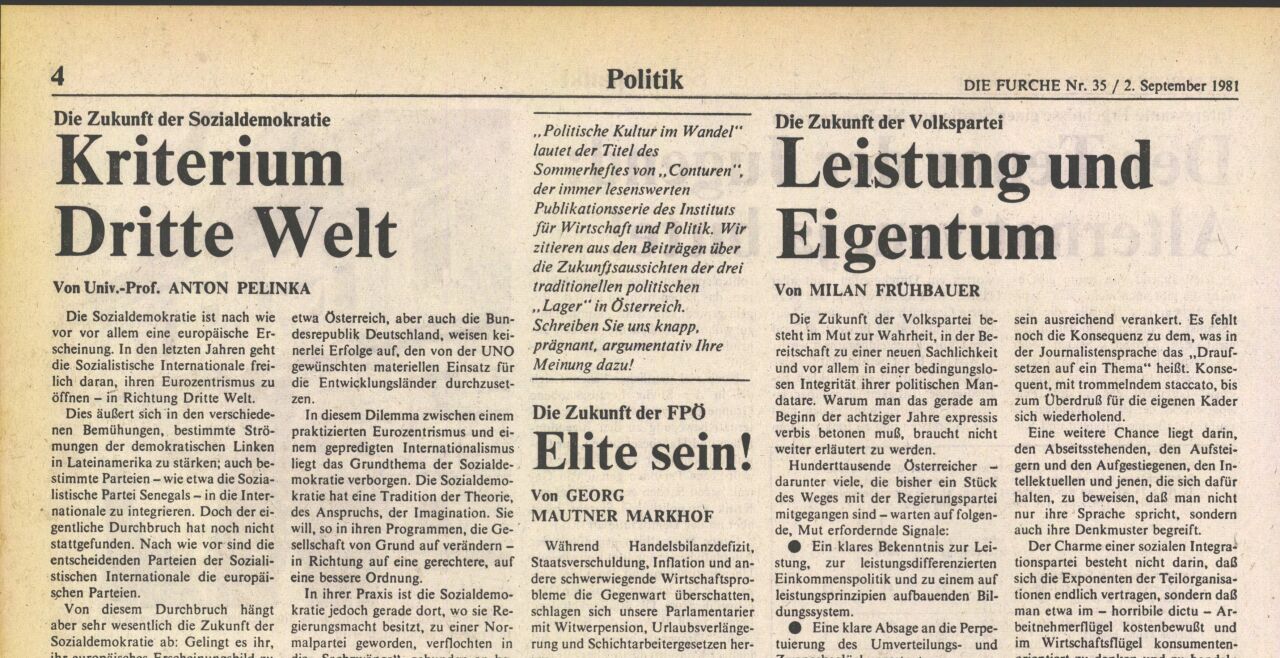
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kriterium Dritte Welt
Die Sozialdemokratie ist nach wie vor vor allem eine europäische Erscheinung. In den letzten Jahren geht die Sozialistische Internationale freilich daran, ihren Eurozentrismus zu öffnen - in Richtung Dritte Welt.
Dies äußert sich in den verschiedenen Bemühungen, bestimmte Strömungen der demokratischen Linken in Lateinamerika zu stärken; auch bestimmte Parteien - wie etwa die Sozialistische Partei Senegals - in die Inter- • nationale zu integrieren. Doch der eigentliche Durchbruch hat noch nicht stattgefunden. Nach wie vor sind die entscheidenden Parteien der Sozialistischen Internationale die europäischen Parteien.
Von diesem Durchbruch hängt aber sehr wesentlich die Zukunft der Sozialdemokratie ab: Gelingt es ihr, ihr europäisches Erscheinungsbild zu relativieren; gelingt es ihr, tatsächlich zu einem internationalen Dachverband zu werden - dann könnte sie, trotz ihrer inneren Vielfalt, ja Widersprüchlichkeit, doch ein Faktor- der Weltpolitik werden.
Wenn die Sozialdemokratie nicht mehr die Normalpartei der gemäßigten Linken der wohlhabenden Industriestaaten ist, sondern eine gestaltende Kraft auch in den Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens, dann hat die Sozialdemokratie eine wesentliche, eine neue, auch eine neu zu definierende Zukunft.
Doch angesichts der konkreten Problemstellungen ist Skepsis angebracht. Die Sozialdemokratie in den wohlhabenden Staaten ist dann erfolgreich, wenn sie nationale Wahlen gewinnt; wenn sie auf die Wünsche, auf die Bedürfnisse, auf das Bewußtsein solcher Wähler Rücksicht nimmt, die - im internationalen Vergleich - zu den Reichen zählen.
Wenn das Engagement der Sozialdemokratie für eine „neue Weltwirtschaftsordnung“, für eine Umverteilung des Reichtums zugunsten der armen Länder über schöne Worte hinausgehen soll, dann trifft diese welt
weite Umverteilungspolitik auch diejenigen Wähler, die die Sozialdemokratie braucht, um überhaupt erst an die Schalthebel nationaler Macht zu kommen.
Die Sozialdemokratie muß also, um ihren internationalen Worten auch internationale Taten folgen zu lassen, ihre Wähler zu einer Umverteilungspolitik bringen, die gegen deren kurzfristig und mittelfristig interpretierten Interessen gerichtet ist. Und dafür gibt es keinerlei Anzeichen:
• Die SPÖ betreibt, ohne Rücksicht auf internationale Solidarität, eine Politik des Rüstungsexportes, die durchwegs solchen Systemen zugute kommt, die die Sozialdemokratie, die die Demokratie überhaupt unterdrük- ken; die SPÖ steht hier nur stellvertretend für eine Politik, die, wegen des unmittelbaren materiellen Vorteils - genannt Arbeitsplatzsicherung - der sozialdemokratischen Anhänger, die internationale Solidarität zum Stehsatz von Sonntagsreden verkommen läßt.
• Alle Parteien der Sozialistischen Internationale erreichen in der materiellen Entwicklungspolitik zugunsten der Dritten Welt keineswegs signifikant höhere Umverteilungserfolge als etwa christlich-demokratische oder liberale oder konservative Parteien; sozialdemokratisch regierte Länder wie etwa Österreich, aber auch die Bundesrepublik Deutschland, weisen keinerlei Erfolge auf, den von der UNO gewünschten materiellen Einsatz für die Entwicklungsländer durchzusetzen.
In diesem Dilemma zwischen einem praktizierten Eurozentrismus und einem gepredigten Internationalismus liegt das Grundthema der Sozialdemokratie verborgen. Die Sozialdemokratie hat eine Tradition der Theorie, des Anspruchs, der Imagination. Sie will, so in ihren Programmen, die Gesellschaft von Grund auf verändern - in Richtung auf eine gerechtere, auf eine bessere Ordnung.
In ihrer Praxis ist die Sozialdemokratie jedoch gerade dort, wo sie Regierungsmacht besitzt, zu einer Normalpartei geworden, verflochten in die „Sachzwänge“, gebunden an be
stehende Interessen, abhängig von Kräften der Beharrung!
Überall dort, wo die Sozialdemokratie lange genug die - theoretische - Möglichkeit gehabt hätte, ihre Ansprüche in eine Wirklichkeit umzusetzen, überall dort bricht dieses Dilemma auf. Der Glaubwürdigkeitsverlust der Sozialdemokratie ist eine Folge ihrer Regierungsmacht.
Dieser Glaubwürdigkeitsverlust ist unvermeidbar - als Folge der Spannung zwischen einem hohen Anspruch, einem Anspruch, der jedenfalls weiter gespannt ist als der Anspruch „bürgerlicher“ Parteien und einer Wirklichkeit, die nicht oder nicht mehr von der Wirklichkeit eben dieser „bürgerlichen“ Parteien entfernt ist.
Die Sozialdemokratie unterscheidet sich von ihren Konkurrenten eben dadurch, daß sie sich diesem Spannungsfeld von Theorie und Praxis verstärkt aussetzt. Dadurch bringt sie eine Dynamik in die Entwicklung.
Aber sie kann diese Rolle nicht unbeschränkt durchhalten. Sie wird immer wieder in die Reserve geschickt werden, sobald ihre Veränderungsdynamik erschöpft ist. Sie wird aber immer die Chance vorfinden, aus dieser Reserve herauszukommen.
Die Sozialistische Partei Frankreichs ist das Beispiel eines solchen Ausbruchs aus der Reserve prinzipieller Opposition in eine Regierungsmacht, die zunächst noch die Phantasie beflügelt. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist das Beispiel einer Sozialdemokratie, die - abgeschliffen in der Regierungsmacht - ihre Veränderungsdynamik und damit einen Gutteil ihrer Glaubwürdigkeit eingebüßt hat; die offenkundig danach drängt, in die Oppositionsreserve zu kommen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!