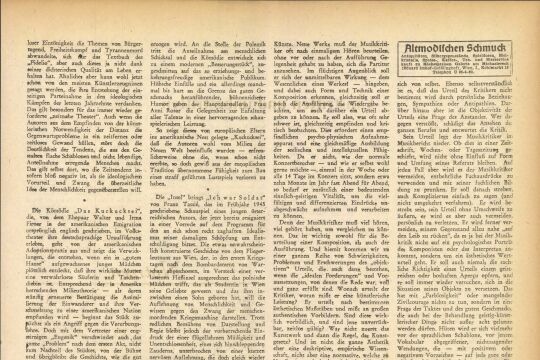Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kritiker im Kreuzfeuer
„Laba mich, lobe mich soviel du kannst”, erklärte Hans von Bülow einem Freund gegenüber, „ich habe ein positives Bedürfnis, angeräuchert zu werden.” Ist das lediglich spaßhaft gesagt? Aber wollen nicht alle Dramatiker, Schriftsteller, Bildkünstler, Komponisten, Theaterleute stets nur .gelobt werden? Hätte der Kritiker, wenn es nach ihren Wünschen ginge, nicht einzig die Aufgabe, für sie zu werben, ihr Schaffen zu rühmen?
Da sich die Kritiker aber erfahrungsgemäß nach diesen Wünschen richten, werden sie von vielen geschmäht. Schon Grillparzer schrieb, er habe nie auf Kritiken geantwortet, „nicht aus Ängstlichkeit, sondern aus Verachtung”. In unseren Tagen stellte der achtzigjährige Sommerset Maughaum fest, er habe all sein Talent verloren, deshalb sei er jetzt unter die Kritiker gegangen. Das wertet ihre Tätigkeit arg ab, danach benötigen sie kein Talent. Aus dem Ärger über abträgliche Beurteilung kann Spott entstehen. So meinte Wilhelm Busch, die Kritiker seien „wie Sperlinge auf der Dorfstraße, wenn der Reiter vorübergeritten ist”. Der italienische Schriftsteller Giovanni Guareschi drückte dies etwas anders aus: „Ein Kritiker ist eine Henne, die gackert, wenn andere legen.” Was diese Leute schreiben, ist also nicht anders als aufgeplusterte Wichtigmacherei.
Am abträglichsten äußerte sich Charlie Chaplin; er nannte die Kritiker verdummte Idioten, die keine Vorstellungskraft und keine Phantasie haben. Besitzen sie aber, wenn sie schon Idioten sind, wenigstens Charakter? Keineswegs, höchstens einen besonders schlechten. Das ist die Meinung von Edward Albee, der vorschlägt, die Kritiker aufzukaufen, da ihr Einfluß auf das amerikanische Theaterleben geschmackstyrannisch und schädlich sei. Aber auch Dürrenmatt ist mit den Kritikern nicht einverstanden; er erklärte, niemand köpfe leichter als jene, die keine Köpfe haben. Haben sie recht, haben sie nicht recht? Wie dem sei, man kann Sascha Guitry nicht widersprechen, der behauptete, er habe noch kein Denkmal für einen Kritiker gesehen.
Erste Voraussetzung für den Kritiker ist Gerechtigkeit. Ungerechte Urteile verletzen mehr als falsche. Nur wenn die Kritik gerecht ist, übt sie Macht aus, meinte Zola. Allerdings setzt das innere Weite voraus, um gegensätzliche seelische Welten erfassen zu können. Aber Bernard Shaw widerspricht: Gerechtigkeit sei überhaupt nicht Sache des Kritikers, es gebe in der Kritik keine unerträglichere Heuchelei als ein unpersönliches, abstraktes, autoratives unparteiisches Gebaren. Ein Kritiker, der das Publikum nicht für seine Person zu interessieren verstehe, habe seinen Beruf verfehlt. Aber wodurch interessiert der Kritiker das Publikum? Oscar Fritz Schuh gibt darauf Antwort: „Wenn ich eine Kritik lese, will ich unter anderem eine Fülle brillanter Formulierungen genießen. Mehr von ihr zu verlangen wäre unsinnig, denn eine beweisbare Wahrheit gibt es auf dem Gebiet der Kunst nicht.” Gewiß, beweisen kann man in der Kunst nichts, aber der Kritiker kann und muß versuchen, den Leser von seiner Interpretation, von seiner Beurteilung zu überzeugen. Davon spricht Julius Hart: „Das Urteil ist nichts — die Begründung alles.” Vielleicht ist es richtiger zu sagen: „Das Urteil ist nichts ohne Begründung.” Auf die Begründung des Urteils kommt es tatsächlich entscheidend an. Doch wäre es ein schwerer Fehler, das Wie gegenüber dem Was zu überschätzen. Die Qualität der Kritik bedingt das Was des Gesagten, nicht das Wie, sonst entsteht eitlers Wortgefunkel. Das durch das Was bedingte Wie versteht sich von selbst.
Nun erklärte Hegel, daß es viel leichter sei, das Mangelhafte aufzu- flnden als das Substantielle. Er wertet es als Zeichen größter Oberflächlichkeit, überall das Schlechte zu finden, nichts von dem Affirmativen, Echten daran zu sehen. Und auch Christopher Fry behauptet: „Ein Kritiker bekrittelt mitunter lieber die Oberfläche als daß er auf den Grund geht.” Das ist sehr oft richtig, nur wenige Kritiker stoßen bis zum Grund vor, sie lassen sich im- pressionieren, sozusagen anwehen und urteilen daraufhin. Es ist bequemer. Hegel und Fry setzen voraus, daß der Grund intakt ist, es kann aber auch die Oberfläche gelobt werden, weil der faule Grund nicht gesehen wird. Oberfläche und Grund kann man nicht trennen.
Das negative Urteil fürchten die Kritisierten um so mehr, je angesehener der Kritiker ist. Die Leser dagegen kennzeichnet eine’ andere Einstellung. Gerhart Hauptmann formuliert sie: „Das Publikum verlangt die positiven Eigenschaften vom Tageskritiker nicht so sehr als die negativen. Negative Eigenschaften sind allgemein verbreitet und werden leider allgemein verstanden. Positive Eigenschaften sind selten und werden nur von der Minderzahl gewürdigt.” Und Hans Weigel stellt fest: „Der Leser verzeiht dem Kritiker viel eher eine unberechtigte Ablehnung als ein unberechtigtes Lob.” Man kann auch sagen: Wer seine Kritiken mit der Pistole schreibt, hat das Publikum für sich. Dennoch entwertet das grundsätzliche Fehlen jeder negativen Kritik völlig die positive. Denn der Kritiker ist so etwas wie ein Arzt, und von einem Arzt erwartet man keine Komplimente. Das heißt Kritik soll auch im Negativen positiv wirken.
Es gibt Kritiker, bei denen man den Eindruck hat, daß sie Dargebotenes, das ihnen mißfällt, als persönliche Beleidigung auffassen und dies dann sauer oder durch Spott abreagieren. Spott aber dürfte nie in Kritiken vorkommen, persönliche Ressentiments werden dabei spürbar. Die
Frage der Anständigkeit berührt Pirandello. Er sagt im ersten Zwischenspiel des Stücks „Jeder auf seine Weise” über den Theaterkritiker: „Soviel ist gewiß: eines ist der Beruf, ein anderes der Mensch, der ihn seines Vorteils willen ausübt und gezwungen wird, seine eigene Anständigkeit zu opfern.” Opfern? Wo das Urteil vom persönlichen Vorteil beeinflußt wird, beginnt die Korruption. Aber auch der Kritiker wird kritisiert, niemand strenger als er, behauptet Joseph Marx. Man kann auch sagen, niemand kritisiere strenger als die eigenen Kollegen des Kritisierten. Beides geschieht freilich nur im Gespräch. Wären aber die
Schaffenden selber bessere Kritiker? Man denke an die abträglichen Urteile von Goethe über Kleist, von Schiller über Haydn, von Grabbe über „Faust”, von Otto Ludwig über „Wallenstein”, von Tolstoi über Shakespeare, man wird dies kaum befürworten. Und die Kleinen sollten richtiger urteilen? Von ihnen kann man es noch weniger verlangen.
Immer wieder wird behauptet, der Kritiker sei nicht berechtigt, diesen Beruf auszuüben, wenn er nicht selbst auf dem Gebiet des Kritisierten tätig war. Erstaunlicherweise ist auch Strindberg dieser Meinung. Er fordert: „Wer selber kein Drama geschrieben hat, sollte über Shakespeare nicht mitsprechen! Heute verlangt man in jedem Fall, daß man ein Handwerk kann, ehe man zum Richter berufen wird.” Da sei abermals Hans Weigel zitiert. Er nimmt auf die Behauptung vieler Leute Bezug; die erklären, nur wer etwas besser zu machen vermöge, habe das Recht zu kritisieren und verweist ironisierend auf das Wort eines Schneiders zu seinem Kunden: „Sind Sie Mitglied der Schneiderinnung? Nein? Dann dürfen Sie meine Arbeit nicht kritisieren.”
Die ablehnende Einstellung gegenüber der Kritik wird keineswegs allgemein geteilt. Es gibt Gegenstimmen. Benedetto Croce stellte fest, eine „Tätigkeit, die urteilt, ist wesentlich identisch mit der Tätigkeit, die hervoťbringt”. Nun könnte man entgegnen, Croce war weder Dichter noch Maler oder Komponist. Aber auch Albert P. Gütersloh, der Vater der Wiener Schule des phantastischen Realismus, sprach in einer seiner akademischen Reden über „die übliche und üble Meinung, es bestünde ein wesentlicher Unterschied zwischen der schöpferischen Tätigkeit des Kunstschriftstellers und der des Künstlers, welches Faches immer”. Und Heimito von Doderer, der über Gütersloh schon vor 40 Jahren eine Biographie veröffentlichte, ordnete dem schöpferischen Schaffen und der nacherschaffenden Kritik gleichwertigen Rang zu. Der Essay sei die Kunstform des Kritikers.
Eine Kritik zu schreiben, erklärte Max Frisch, halte er für eine sehr schwierige Aufgabe, er habe Respekt vor Männern und Frauen, die das können. Wäre es möglich, auf Kritik zu verzichten? Thornton Wilder meint, das Theater wäre unvorstellbar ohne den Kritiker. Und Grischa Barfuß, Intendant der Deutschen Oper am Rhein, bezeichnete die Theaterkritik als einen schönen und wichtigen Beruf, sie sei die Fortsetzung der Theaterkunst mit anderen Mitteln. Man darf hinzufügen, jede künstlerische Leistung finde erst ihre Erfüllung in der Resonanz. Die geprägteste bietet die Kritik.
Und nun die Behauptung eines Kritikers: Alfred Kerr dekretierte, der wahre Kritiker sei ein Dichter, ein Gestalter, Wert habe nur Kritik, die in sich ein Kunstwerk gebe, so daß sie noch auf Menschen wirken könne, wenn ihre Inhalte falsch geworden sind. Kerr spricht freilich für seinen eigenen Beruf oder in diesem Fall für seine Berufung. Um so gewichtiger wirkt daher das Urteil von Ionesco, der meint, er glaube, daß man begabt sein müsse, um Schriftsteller zu sein, aber um Kritiker zu sein, müsse man genial sein. Gleicher Aufassung war schon Oscar Wilde. Er stellte fest, daß der Kritiker dem Kunstwerk so gegenüberstehe wie der Künstler der sichtbaren Welt der Form und der Farbe oder der unsichtbaren Welt der Leidenschaft und des Gedankens. Die Kritik, erklärte er, erfordere viel mehr Kultur als das Schaffen, die Kritik sei schöpferisch im höchsten Sinn des Wortes. Haben nun die Verächter der Kritik recht oder die Verteidiger, die ihr einen außerordentlich hohen Rang zuerkennen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!