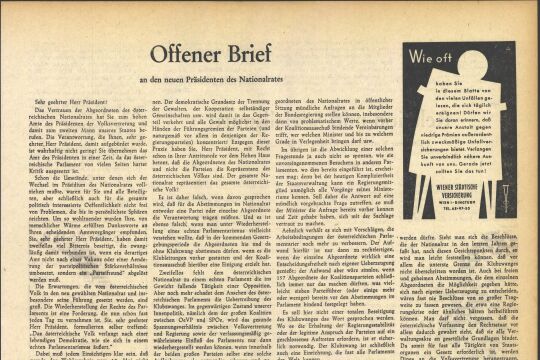Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ladenhüter aus der Parteien-Steinzeit
Wie frei sind die freien Mandatare wirklich? Rein rechtlich sind sie nur ihrem Gewissen verantwortlich. Die parlamentarische Wirklichkeit sieht indes ganz anders aus.
Wie frei sind die freien Mandatare wirklich? Rein rechtlich sind sie nur ihrem Gewissen verantwortlich. Die parlamentarische Wirklichkeit sieht indes ganz anders aus.
Gibt es das freie Mandat, gibt es überhaupt einen freien Auftrag? Aus geschichtlicher Sicht war das freie Mandat ein Sieg über das ständische Mandat und die Abwehr eines drohenden plebiszitä-ren Mandats.
Die Stände hatten ihren Vertretern Weisungen erteilt. Sie waren die Herren der Ständeversammlung, ihre Repräsentanten waren ihre Diener. Die Auflösung des ständischen Mandats erfolgt in einem langen Prozeß, der in England schon im 13. Jahrhundert begann und im 16. zum Abschluß kam, in Frankreich zwischen 1789 und 1791, in Deutschland im 19. Jahrhundert.
Ein neues Mandat drängte zur Verwirklichung: die Bindung an Aufträge des Wahlkreises, das plebiszitäre Mandat. In England kämpfte im 18. Jahrhundert vor allem Edmund Burke gegen solche Aufträge der Wählerschaft des Wahlkreises. Ein solches ple-biszitäres Mandat wurde auch in der Französischen Revolution verlangt, aber ebenfalls abgewehrt.
So entwickelte sich der Parlamentarismus, indem er gewissermaßen alte und neue Bindungen und damit eine Zersplitterung des politischen Willensbildungsprozesses überwand. Als Vertreter des ganzen Volkes seien die Abgeordneten verpflichtet, auf der Suche nach dem Gemeinwohl zu sein. Daher könnten sie an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen werden.
So oder so ähnlich wurde die parlamentarische Repräsentation legitimiert. Sie verlangte von den Abgeordneten, im Parlament durch Rede und Gegenrede sachliche Argumente miteinander auszutauschen, um eine freie, der jeweiligen Frage angemessene Entscheidung treffen zu können.
Dieses Ideal wurde in den Parlamenten bestenfalls in bestimmten Situationen verwirklicht. Aber das ist bei anderen Idealen ähnlich. Jedenfalls blieb die rechtliche Folie des freien Mandats bestehen, wenn es auch schon vor vielen Jahrzehnten „ein fossiles Petrefakt (Versteinerung, Anm.) aus der verfassungsgeschichtlichen Steinzeit” genannt wurde.
Nach dem Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung, Hans Kelsen, war freilich, die Festlegung des Prinzips des freien Mandats gesetzestechnisch überflüssig, weil es ja einer positivrechtlichen Bestimmung bedürfte, um die Mitglieder der Volksvertretung überhaupt an Aufträge von irgendwelcher Seite, insbesondere von Seiten ihrer Wähler, zu binden.
Wenn man dieses Prinzip als der parlamentarischen Demokratie innewohnend ansieht und keines ihrer Elemente dagegen spricht, wären die entsprechenden Regelungen in den Verfas-
„Das freie Mandat hat gerade im Konfliktfall seinen Sinn.” sungen des Bundes und der Länder einfach abzuschaffen. Vielleicht würde dann manches Mißverständnis nicht aufkommen.
Aber das Verfassungsrecht ist auch ein historisches Museum. Man sollte aus der Geschichte nicht aussteigen, weil sie einen ohnehin immer einholt. Die ausdrückliche Normierung des freien Mandats hat im übrigen gerade im Konfliktfall einen Sinn.
Die Abgeordneten allgemeiner Vertretungskörper dürfen nicht an ein imperatives Mandat gebunden werden. Die Verfassung verbietet also auch Aufträge und Weisungen von Wählern an Abgeordnete. Der Parlamentarismus hat das imperative ständische Mandat überwunden und das imperative plebiszitäre Mandat abwehren können. Parlamentarismus — das wurden in der politischen Realität die politischen Parteien.
Der Grazer Verfassungsrechtler und Politikwissenschafter Wolfgang Mantl stellt fest: „Das freie Mandat der Parlamentsdemokratie des 19. Jahrhunderts, in der politischen Wirklichkeit von Anfang an durch inner- und dann immer mehr auch durch außerparlamentarische Gruppenbildung faktisch modifiziert, wurde schließlich in der Parteiendemokratie des 20. Jahrhunderts gleichsam auf die Parteien erstreckt, die im politischen Alltag zu den wahren Nutznießern der Freiheit und des Repräsentativsystems wurden, während der Abgeordnete sich der Fraktion-und Parteidisziplin einfügte.”
In der Parteiendemokratie, insbesondere österreichischer Prägung, verdankt der Abgeordnete sein Mandat der Partei, die ihn aufgestellt hat.
Dementsprechend hat Kelsen schon in den zwanziger Jahren die Kontrolle der Abgeordneten durch die zur politischen Partei organisierte Wählergruppe als moderne Form des imperativen Mandats, aber auch den Mandatsverlust für den Fall des Ausscheidens (Austritts und Ausschlusses) des Abgeordneten aus seiner Partei und die Abberufung des Abgeordneten durch seine Partei rechtspolitisch erwogen.
In der Demokratisierungsdiskussion der sechziger und siebziger Jahre wurde das Mißtrauen gegen das Repräsentativsystem auch in Forderungen nach dem imperativen Mandat und Abbe-rufbarkeit von Abgeordneten laut. Die Parteibasis oder die Aktivbürgerschaft im Wahlkreis sollten zu diesem Recht kommen, um die Identitätsdemokratie zu stärken und die Repräsentativdemokratie zu schwächen.
Karl Loewenstein nannte das freie Mandat einen „vermotteten Ladenhüter der Französischen Revolutionsverfassung von 1791”, der „völlig sinnlos”, geworden sei. Aber gerade in Konfliktfällen entfaltete dieses Prinzip normative Kraft.
Auf die Stellung der Abgeordneten eingehend hat der Verfassungsgerichtshof mehrmals festgestellt: Aus dem Wesen der repräsentativen Demokratie ergibt sich die Notwendigkeit der Sicherung einer durch Wahl vermittelten Funktion. Der Abgeordnete des Volkes muß in seinem Amt so gesichert sein, daß er dieses ausüben kann.
Dies wird besonders deutlich, wenn die Gesetzgebung eine Funktionsdauer festlegt. Die Ausübung des Amtes muß während der ganzen Funktionsdauer gesichert sein. Auf diese Ordnung haben die Gewählten ein subjektives Recht.
Wenn die Verfassung den Abgeordneten sichert, daß sie bei Ausübung ihres Berufes an keinen Auftrag gebunden sind, muß umso mehr angenommen werden, daß ihnen die Ausübung ihres Mandats überhaupt gewährleistet ist.
Die Verfassung setzt die Mitwirkung der Parteien an der Berufung der Repräsentanten des Volkes voraus. In Ausübung ihrer Funktion sind aber die Abgeordneten ausschließlich Repräsentanten der Wähler, auch wenn sie auf einer Parteiliste gewählt worden sind.
Dieser Grundregel widerspricht es, wenn die Abberufung eines Abgeordneten in die Hand einer Parteiinstanz gegeben ist, umso mehr, als diese ihn auch aus Gründen, die überhaupt nicht mit seiner Funktion als Abgeordneter zusammenhängen, und in aller Regel kontrollos, aus seiner Funktion entfernen könnte.
Der Verfassungsgerichtshof hat für Mitglieder allgemeiner Vertretungskörper Jegliche Möglichkeit einer Bindung des Verhaltens”, auch „einer Bindung an die Rechtsanschauung des Verfassungsgerichtshofes” ausgeschlossen.
In den Parteiorganisationen liegen trotz dieser Rechtslage und Rechtsprechung ' unterfertigte Blankoverzichtserklärungen vor, gewissermaßen als Denk- und Dankzettel. Im Konfliktfall durch eine Gegenerklärung nichtig (Präjudizien wie etwa der Fall Franz Olah machten Geschichte), haben diese Blankoverzichtserklärungen nur symbolische Wirkung. Man sollte von diesem Ritual abgehen.
Wenn aber der Innsbrucker Politikwissenschafter Anton Pelin-ka meint, das freie Mandat sei „zur bloßen Formel, zur historisch erklärbaren, heute jedoch nur ideologisch wirksamen Fassade geworden”, so trifft das für den Alltag weitgehend zu. Aber aus gerade entgegengesetzten Motiven, als vielleicht Pelinka meint.
Im Alltag halten sich die Abgeordneten erfahrungsgemäß in aller Regel freiwillig an die Parteilinie. Die Ein- und Unterordnung des Abgeordneten in die Partei und Fraktion vollzieht sich durch
,,Man hält Fraktionsdisziplin im Hinblick auf den politischen Gegner.”
Zustimmung, die freilich unterschiedlich und verschieden motiviert ist.
Die rechtspolitischen Vorschläge des Salzburger Verfassungsrechtlers Friedrich Koja, welche auf eine Bindung des Abgeordneten an Fraktionsbeschlüsse zielen, an deren Zustandekommen er nach ausreichender Debatte und geheimer Abstimmung mitgewirkt hat, erheben das zur Norm, was in der politischen Praxis der Regelfall ist.
Man hält Fraktionsdisziplin vor allem im Hinblick auf den politischen Gegner, der Fraktionsdisziplin vor allem im Hinblick auf den politischen Gegner hält. Die Gruppendynamik ist eben auch kompliziert. Alle diese komplexen psychologischen Prozesse werden in der Öffentlichkeit zum Klubzwang vereinfacht, der ohne Rechtsverbindlichkeit ist, aber freiwillig praktiziert wird.
Schon der Staatsrechtslehrer Gerhard Anschütz hat für die Weimarer Republik immer wieder hervorgehoben, daß die Erteilung von Aufträgen an Abgeordnete nicht verboten ist, daß auch die Befolgung derselben nicht schlechthin untersagt ist. Die Frage, ob die Befolgung eines Auftrages verantwortet werden darf, sei vielmehr dem Gewissen des Abgeordneten anheimgestellt. Der Auftrag entbehre aber jeder rechtlichen Wirksamkeit und Verbindlichkeit.
Wenn Aufträge sehr oft nicht nur erteilt, sondern auch befolgt werden, beweise diese Tatsache nur, daß der folgsame Abgeordnete sein Verhalten vor der Instanz „Gewissen” verantworten zu können glaube, nicht aber eine rechtliche Bindung.
Klubzwang, Fraktionsdisziplin, Parteidisziplin im Parlament sind faktische, nicht rechtliche Bindungen. Sie sind kein Rechtsinstitut, sondern Konventionalregel. Es stellt sich aber die Frage, ob diese Konventionen von den Parteien nicht in aller Form aufgehoben und aufgegeben werden sollen. Nicht das freie Mandat, sondern diese Konventionairegeln wirken heute wie fossile Petref ak-te aus der Steinzeit der Parteien.
Eine offene Gesellschaft braucht offene Parteien. Eine offene Partei aber braucht weder .Blankoverzichtserklärungen noch den Klubzwang. Wer freiwillig Disziplin hält, wird sie auch dann halten.
Der Autor ist Professor für Rechtslehre an der Universität für Bodenkultur und ÖVP-Landtagsabgeordneter und Gemeinderat in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!