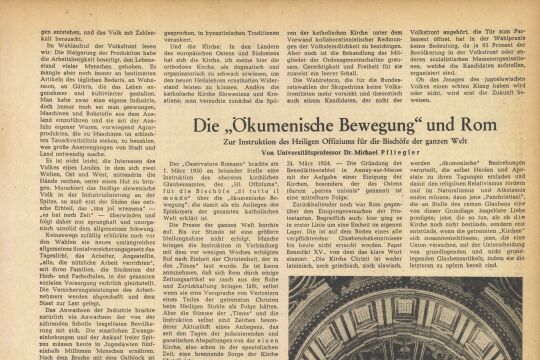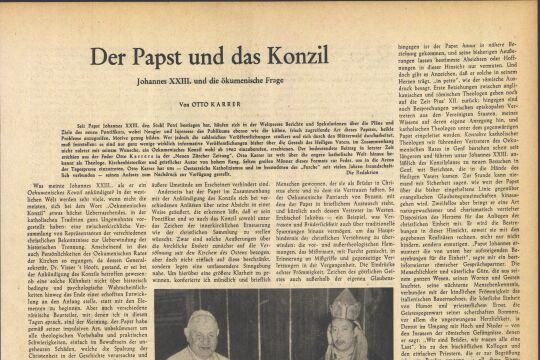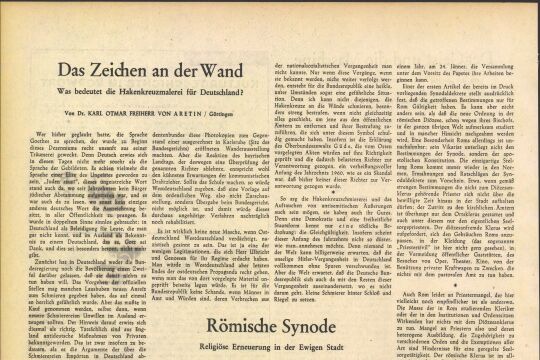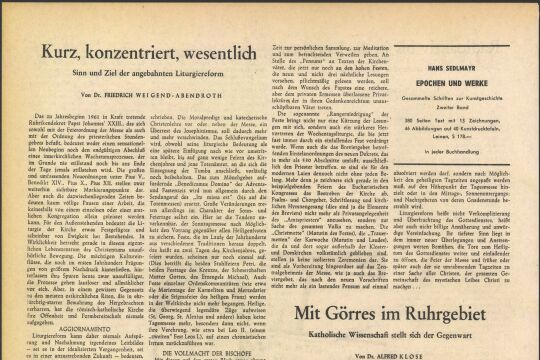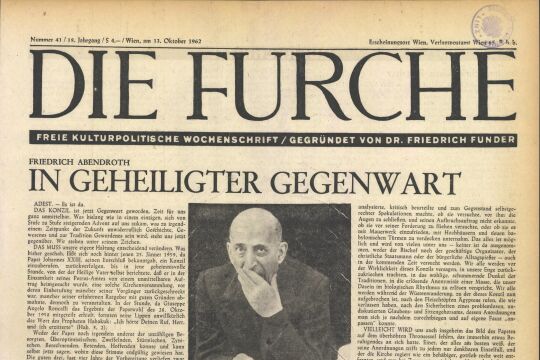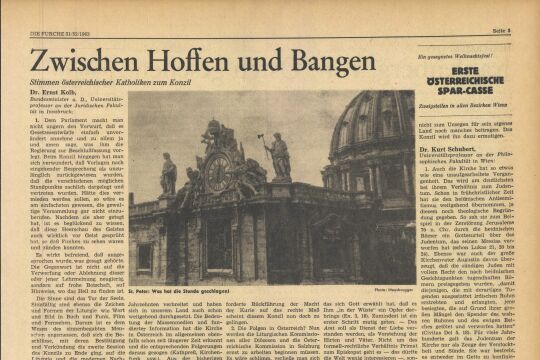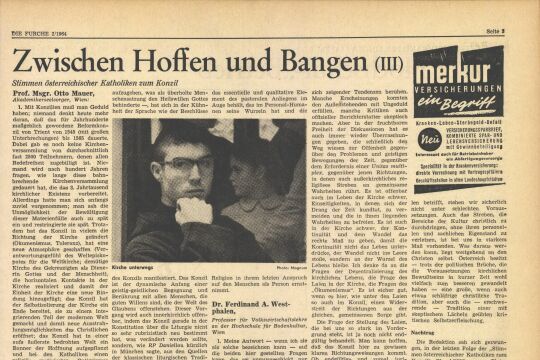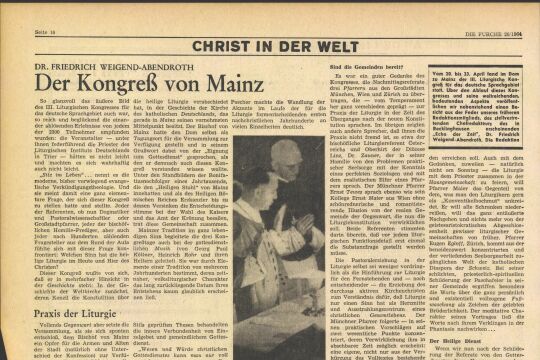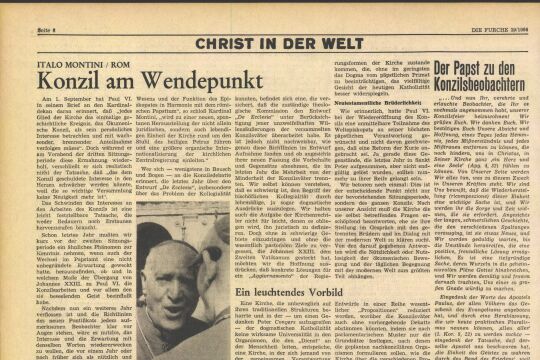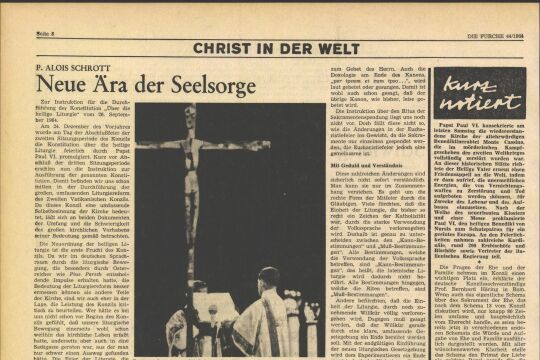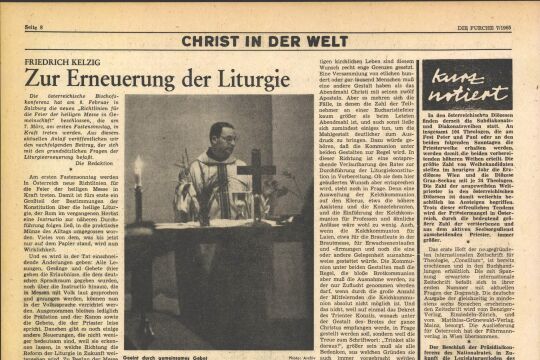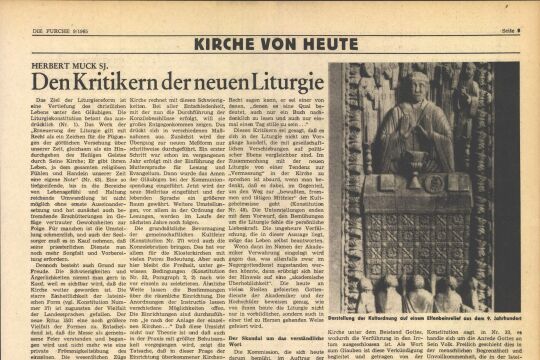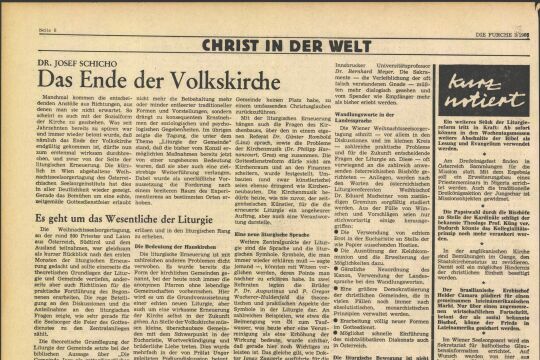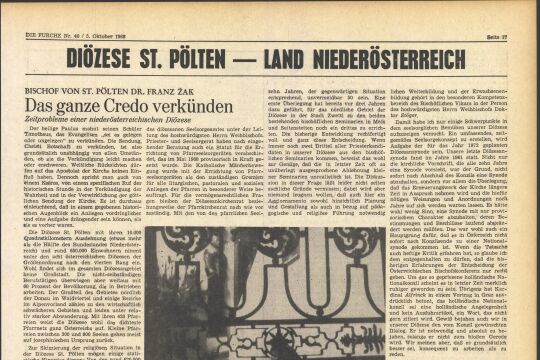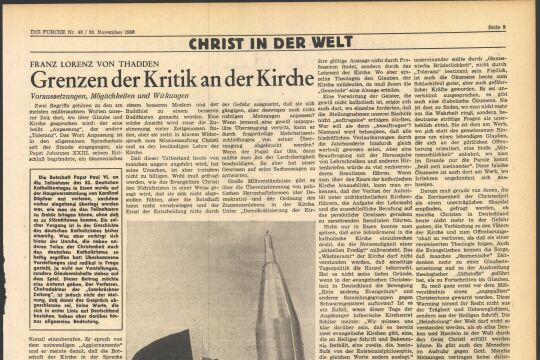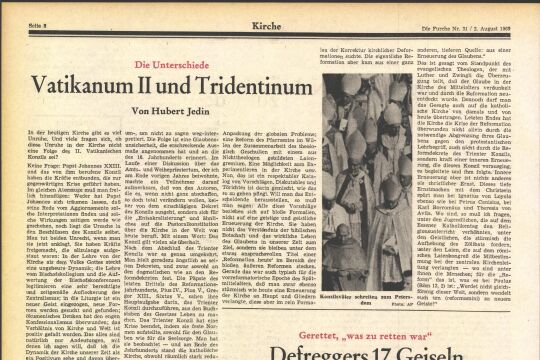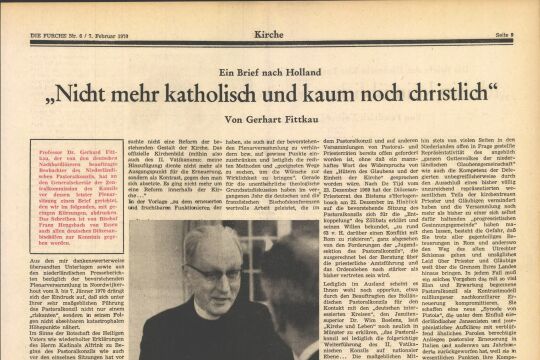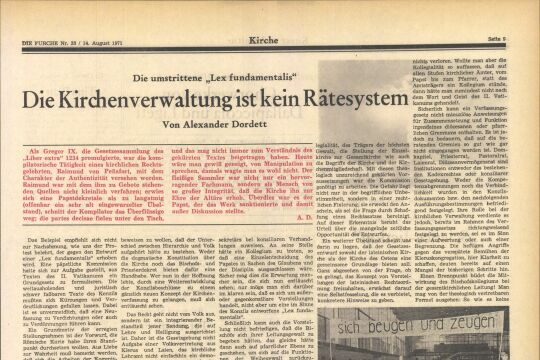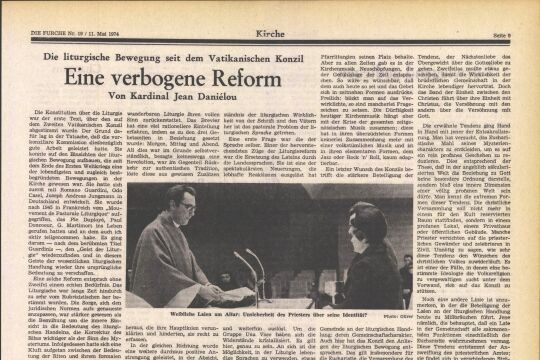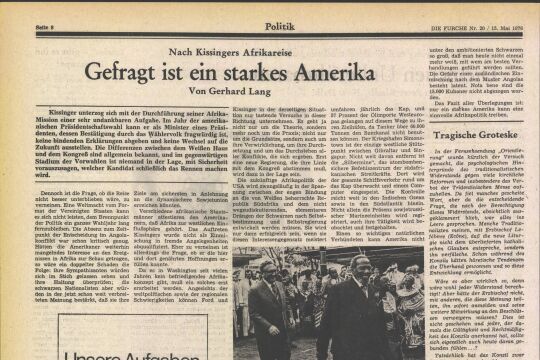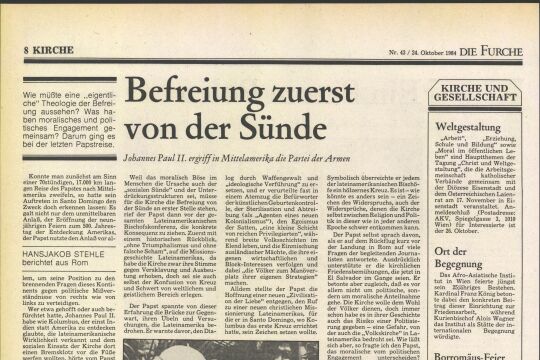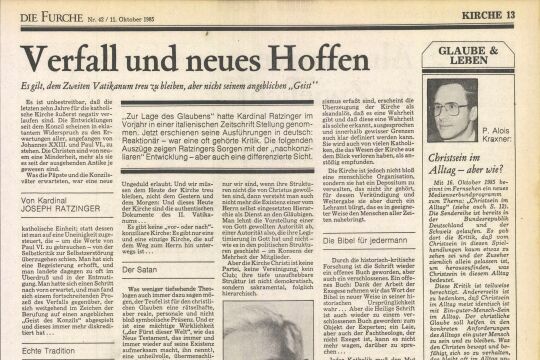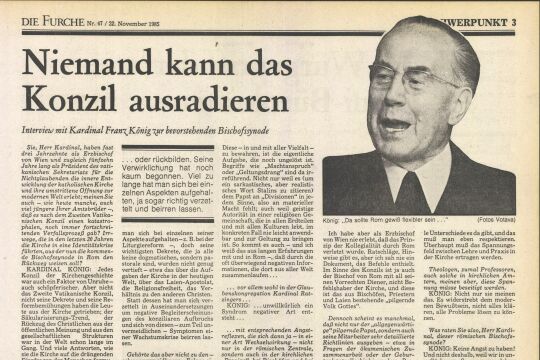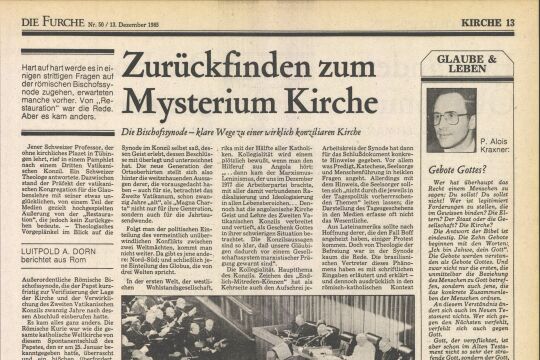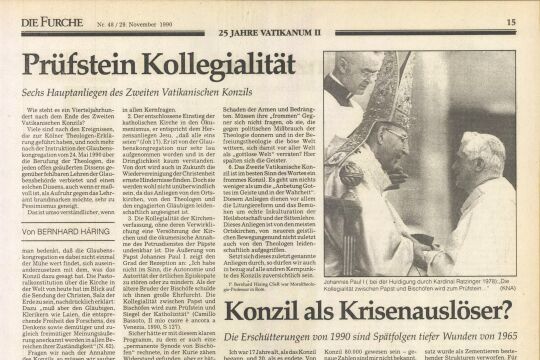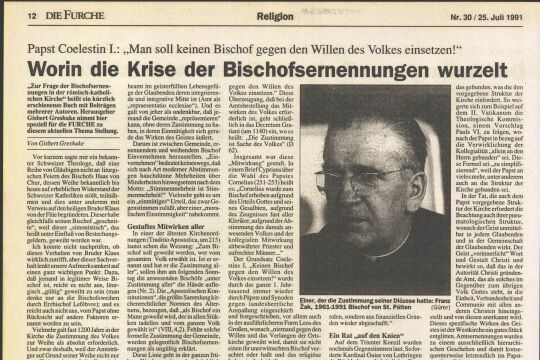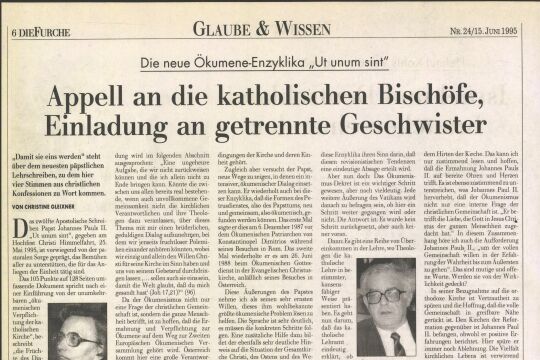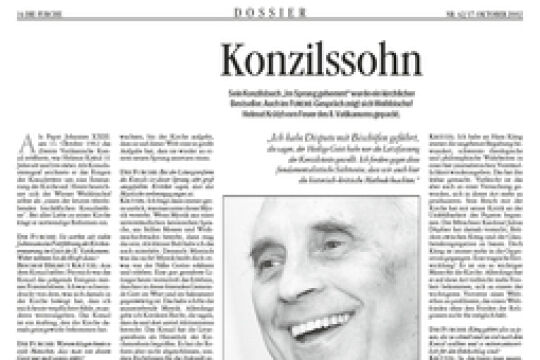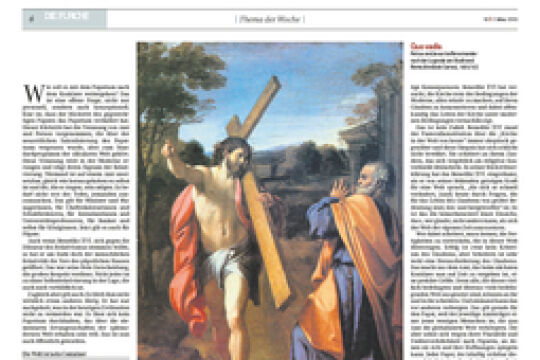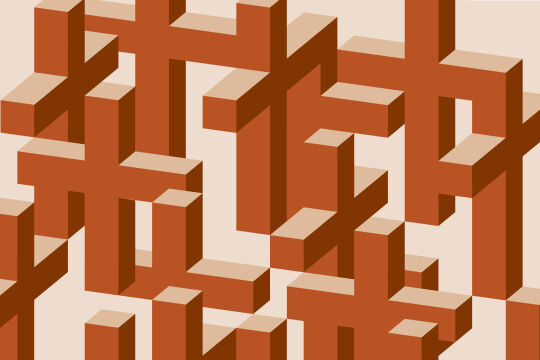"Summorum Pontificum": Versöhnung - mit wem?
Was sagt uns das "Motu proprio" über die Zulassung der vorkonziliaren Liturgie?
Was sagt uns das "Motu proprio" über die Zulassung der vorkonziliaren Liturgie?
Nein, die Volksaltäre werden nicht aus den Kirchen verschwinden, die überwiegende Mehrzahl der Priester wird auch künftig der Gemeinde zugewandt den Gottesdienst in der Landessprache zelebrieren. Wer das jüngste "Motu proprio" des Papstes über die Zulassung der vorkonziliaren Liturgie unvoreingenommen liest, wird darin keinen Anstoß zur liturgischen Konterrevolution entdecken können. Wenn Benedikt XVI. im Begleitschreiben zum eigentlichen Dokument festhält, die "Befürchtung", "hier werde die Autorität des II. Vatikanischen Konzils angetastet und eine seiner wesentlichen Entscheidungen - die liturgische Reform - in Frage gestellt", sei "unbegründet", so kann man dem zustimmen.
Jedenfalls dem Buchstaben des Textes nach. Dem Geist nach muss man Summorum Pontificum (so der Titel des "Motu proprio") wohl als weitere Markierung auf dem schon von Johannes Paul II. begonnen Weg einer Heimholung der Traditionalisten sehen. Es geht um jene Kreise, die mit der Liturgiereform auch alle anderen reformerischen Potenziale des Konzils ablehnen; denen der ohnedies mit großer historischer Verspätung gekommene und vielfach abgefederte Versuch einer Annäherung kirchlicher Lehre und Praxis an die moderne Welt ("Aggiornamento" - "Verheutigung") viel zu weit gegangen ist, ja, die darin eine Preisgabe der Identität ihrer Kirche gesehen haben und bis heute sehen.
Mit diesen Kreisen, so hatte es stets den Anschein, tut sich Rom - ungeachtet aller Bekenntnisse zu Geist und Buchstaben des Konzils - deutlich leichter, als mit jenen, welche die reformorientierten Ansätze des Konzils weiterdenken wollen und nach zeitgemäßen Formen von Seelsorge und Verkündigung suchen. Papst Benedikt nennt in seinem Begleitschreiben als "positiven Grund" für sein "Motu proprio" die "innere Versöhnung in der Kirche". Dagegen ist nichts einzuwenden: Wer die Paulusbriefe liest, weiß, dass es schon in den frühesten Gemeinden Spaltungen und Fraktionsbildungen gegeben hat - und dass diese überwunden werden wollen. Das Prinzip der Einheit (nicht Uniformität) ist Wesensmerkmal der Kirche Christi.
Wo aber bleibt die Versöhnung (oder der Versuch dazu) mit den innerkirchlichen Reformbewegungen, mit dissidenten Theologen (zugegeben: der Papst hat Hans Küng empfangen), mit aufmüpfigen Ordensleuten, mit wiederverheirateten Geschiedenen, "Priestern ohne Amt"? Hier ist von Sorge um die Einheit viel weniger zu spüren, fällt die Grenzziehung deutlich schärfer aus. Es sagt viel aus, "mit wem der Papst … Konflikte beenden möchte und mit wem er sie riskiert", schrieb die Süddeutsche Zeitung zurecht. Kardinal Karl Lehmann, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, soll den Papst vor einer Rehabilitierung des tridentinischen (vorkonziliaren) Ritus gewarnt haben, weil neue Spannungen zu befürchten seien und "die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils ins Zwielicht" geraten würden, berichtet die Frankfurter Allgemeine. Nicht dem Buchstaben, aber dem Geist nach - ist hinzuzufügen.
Warum aber ist das so? Warum streckt man den Traditionalisten die Hand entgegen, während man für die Reformer kaum ein offenes Ohr hat? Vielleicht weil man in Rom im Innersten doch überzeugt ist, dass diese irren, jene aber letztlich näher am Glutkern des Glaubens sind? Es ist schon richtig: die Marginalisierung kirchlichen Lebens, die Verflüchtigung religiös-spiritueller Substanz im christlichen Sinn hat sich seit dem Konzil rasant entwickelt. Die Frage ist freilich: wegen oder trotz des Konzils?
Benedikt XVI. stellt in Summorum Pontificum den reformierten und den traditionellen Ritus als "zwei Anwendungsformen des einen Römischen Ritus" dar. Sub specie aeternitatis, wenn man Kirchengeschichte nur unter dem Gesichtspunkt der Kontinuität, quasi als "Heilsgeschichte" sieht, ist das plausibel. Aber man kommt doch nicht daran vorbei, dass hier zwei einander diametral entgegengesetzte Bilder von Liturgie auf dem Prüfstand stehen: Geht es um ein Opfer, das der Priester stellvertretend vollzieht - oder um eine Gemeinschaftsfeier im Vertrauen auf das Versprechen, dass ER "mitten unter uns" ist?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!