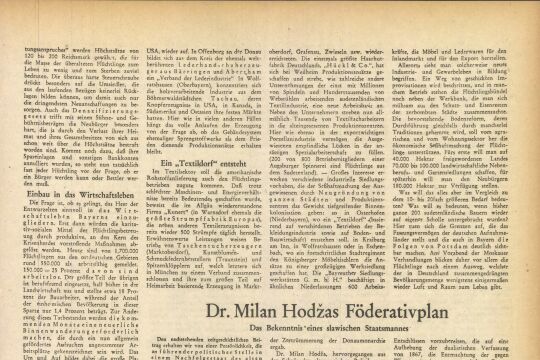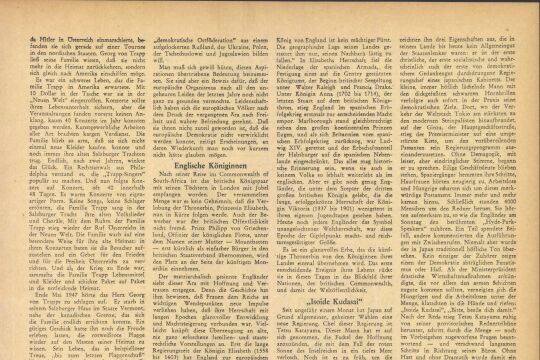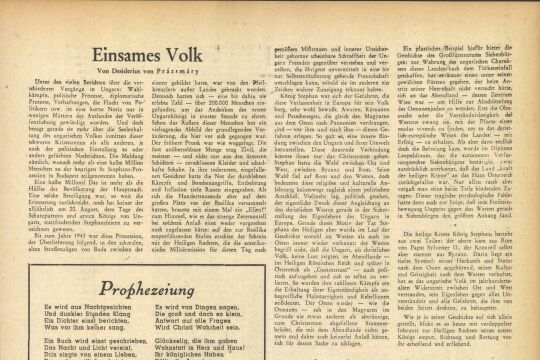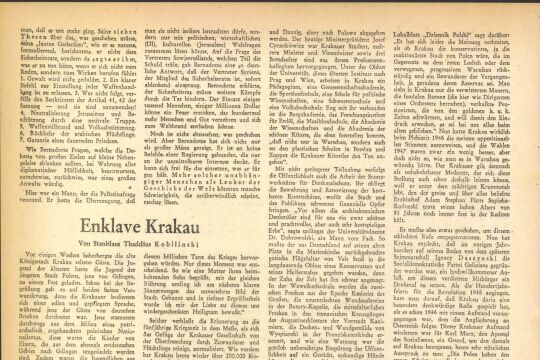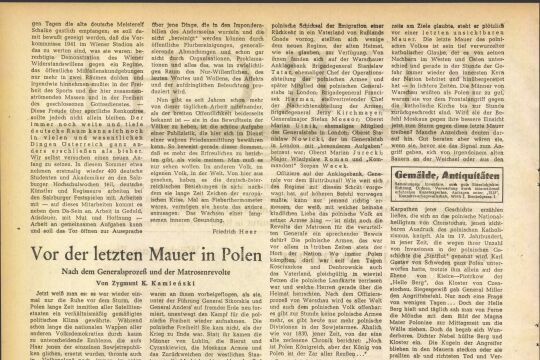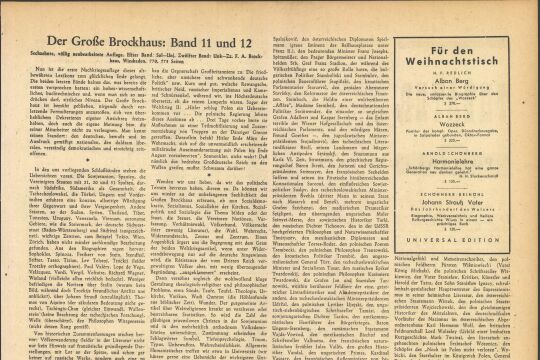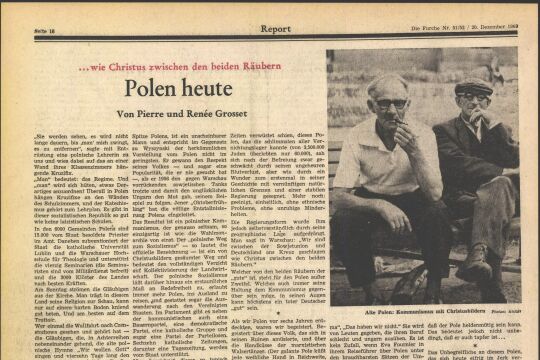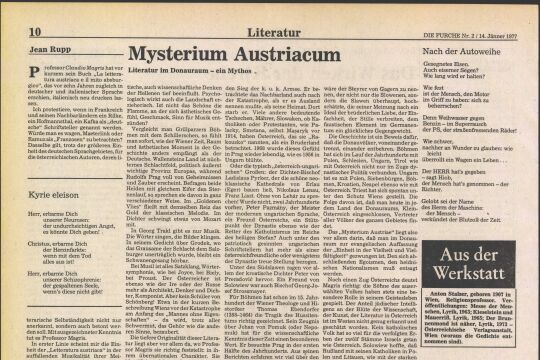Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Liebenswerte Landräuber
Das Österreichbild der Polen, durch mangelnde Kontakte nach dem Krieg jahrelang dürftig, gelangte nun dank der großen Reiseerleichterungen der letzten Jahre zu deutlicher Ausprägung. Wien gilt als erstes und nächstes Ziel im Westen. Das Leben dort ist nach Ansicht der Polen angenehm, geordnet, leicht und teuer, die Menschen sind gemütlich; sie fahren Ski und verdienen am Fremdenverkehr.
Die ferne Vergangenheit nimmt der Durchschnittsbürger kaum zur Kenntnis. Wer von der Monarchie weiß, der staunt über die lange Existenzdauer eines Vielvölkerstaates, dessen Heterogenität unnatürlich wirkt. Davon ausgehend, interessiert den Gebildeten das Verhältnis Wiens zu seinen polnischen Untertanen.
Allgemein erscheinen die Habsburger als „zaborcy" (Landräuber), da sie an zwei Teilungen Polens mitwirkten (Maria Theresia weinte, aber sie nahm), dann während des Vormärz und bis zum Schluß der Bachära die künstlich geschaffene Provinz Galizien größtenteils von fremden Beamten deutsch verwalten ließen.
Nach Königgrätz kam die Wende: Die Behörden amtierten polnisch, Polen saßen in jedem zisleithani-schen Kabinett, an den Universitäten
„Allgemein erscheinen die Habsburger als ,zaborcy' (Landräuber), da sie an zwei Teilungen Polens mitwirkten ..."
Krakau und Lemberg wurde pol-niscbgelehrt, es entstand ein Vertrauensverhältnis zwischen den Polen und Franz Joseph; die Verfassung von 1867 und die Toleranz der obersten Behörden gewährten freie nationale Entfaltung. Allerdings hätten die Österreicher Galizien wirtschaftlich ausgebeutet beziehungsweise niedergehalten, seien mitunter hinterlistig, durchtrieben, ja wortbrüchig gewesen.
Das Stichwort vom „austriackie gadanie", dem österreichischen Gerede, bezieht sich auf liebenswürdige Beschwichtigungshöfräte, die vieles versprechen, aber wenig halten. Die franzisko-josephinische Liberalität -so denken manche - habe den Patriotismus eingeschläfert, die Nation ihres Widerstandsgeistes beraubt und sei daher gefährlicher gewesen als die Knute des Zarenregimes oder die kalte Arroganz und Feindseligkeit der Preußen.
Insgesamt überwiegen bei weitem freundlichere Stimmen, die wohl zu schätzen wissen, um wieviel besser Wien ihre Vorfahren behandelte, als dies Petersburg oder Berlin taten. Für die Besatzungszeit des Zweiten Weltkrieges wird zwischen Österreichern und Reichsdeutschen unterschieden, erstere hätten sich den Polen gegenüber viel besser benommen, sogar vielen Verfolgten geholfen.
Wie sehen nun Historiker und Publizisten die versunkene Donaumonarchie? Vor 1918 beschrieben galizi-sche Polen, wie Balzer, d'Abancourt, Nowicki und Feldman, von mannigfachen Theoretikern der Politik abgesehen, Österreich als ihren Staat, obzwar sie die Zerstückelung des polnischen Reiches als ungesetzlich und vorübergehend betrachteten. Ein wiedererrichtetes Polen könnte ja unter Habsburgs Zepter durchaus gedeihen.
Während der Zwischenkriegszeit sprach und schrieb man wenig von der Monarchie. Im neuen Staat schämten sich die Galizier, zuvor loyale Untertanen des Wiener Hofes gewesen zu sein. Sie durften zwar Verwaltung und Finanzen der Republik aufbauen, doch konnte der Mohr nach getaner Schuldigkeit bald gehen. Die k. k. Beamtenmentalität be-hagte den an Kampf gegen Fremdherrschaft gewöhnten Warschauern, Wilnaern und Posenern nicht. Erst Gomulkas Tauwetter brachte nach 1956 neue Chancen für eine sachliche Beurteüung der jüngeren Vergangenheit.
Noch 1951, mitten im Stalinismus, hatte Kazimierz Wyka die galizischen Konservativen, Träger des austro-polnischen Kompromisses, als Verräter im eigenen Volk und Erfüllungsgehilfen der rücksichtslosen Klassenherrschaft des Adels bezeichnet. Seit zwanzig Jahren betreiben nun vor allem Krakauer Gelehrte umfassende Studien über Österreich im allgemeinen (der Ersten Republik schenkte man freilich kaum Beachtung) und Galizien im besonderen.
Von der alten Garde lieferten Henryk Batowski und Henryk Wereszyk-ki, aus der mittleren Generation Jözef Buszko, Andrzej Pilch und Stanisfaw Grodziski, unter den Jüngeren Jerzy Zdrada und Jan Kozik, von Fachleuten wie Waclaw Felczak und Irena Homola ganz zu schweigen, neue Erkenntnisse. Auch die jüngsten Akademikerbefassen sich gerne mit Aus-triacis.
Batowski arbeitete über den Zerfall der Doppelmonarchie und den Anschluß des Jahres 1938, Wereszycki schrieb als glänzende Synthese seine „Historia Austrii" und eine Abhandlung über die Nationalitätenfrage, die den Vergleich mit Hugo Hantsch, Fran Zwitter und Robert Kann nicht zu scheuen braucht. Buszko, ein profunder Kenner der Arbeiterbewegung, untersuchte das Werden der galizischen Sozialdemokratie und ihren Platz innerhalb der gesamtösterreichischen Partei. Der Rechtshistoriker Grodziski - vor ihm tat dies schon Konstanty Grzybowski - befaßt sich eingehend mit den Institutionen des alten Galizien. Außerdem schrieb er auch die erste Franz-Joseph-Biographie im heutigen Osteuropa, ein kritisch ausgewogenes, die Person des Kaisers durchaus lobendes Buch.
Der Militärgeschichtier Marian Zgörniak erforscht die k. u. k. Armee. Die Memoirenwerke mehrerer Aus-tropolen wurden zu großen Bucherfolgen. Die von Wienern und Krakauern gemeinsam herausgegebenen „Studia Austro-Polonica" bezeugen die konstruktive Zusammenarbeit.
Die polnischen Forscher sind keine blinden Habsburg-Anbeter. Bei all den haarscharfen, zumeist berechtigten Hinweisen auf die schweren Schönheitsfehler des komplizierten k. u. k. Staatengebildes verstehen sie ausgezeichnet die Probleme. Sie blicken ohne Nostalgie, manchmal ironisch, aber ohne Ressentiment zurück. Ein greiser Professor meinte dem Verfasser gegenüber einmal: „Ich habe tatsächlich vieles erlebt, schon 1914 ging ich als Halbwüchsiger zu Pilsudskis Legionen, um für Polens Freiheit zu kämpfen. Was seit damals alles passiert ist, wissen Sie ja. Zeitlebens fühlte ich mich als Patriot. Aber nach reiflicher Überlegung komme ich zum Schluß: echte Rechtstaatlichkeit herrschte nur unter dem Kaiser."
Jugendschwärmerei eines alten Mannes? Wohl kaum, auch von anderer Seite hörte ich das gleiche. Die mitteleuropäische Völkergemeinschaft gibt es jedenfalls noch. Trotz des tiefgreifenden Wandels der Gesellschaftsstrukturen lebt sie fort, und das nur wenig unter der Oberfläche machtpolitischer Trennungslinien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!