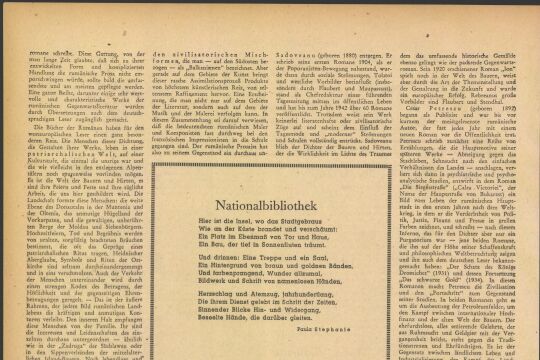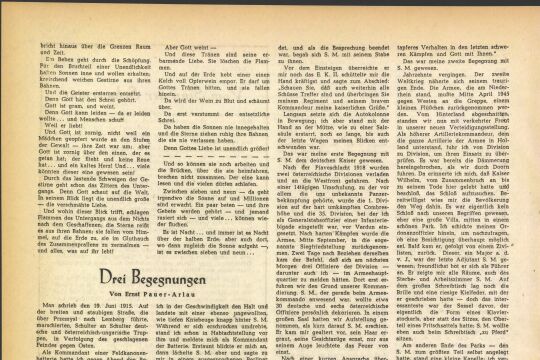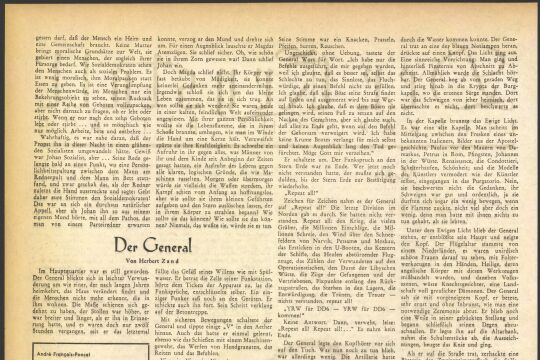Auf dem Schwedenplatz lag eir totes Pferd. Erschossen oder von einer Granate getroffen. Es konnte noch nicht lang dort gelegen sein, als ich hinkam, denn der Kadaver war noch ziemlich intakt. Er blieb es nicht lange, denn gleich menschlichen Piranhas stürzten sich Hungrige mit Messern auf das Pferd und begannen Pleischstücke aus dem Körper zu schneiden. Ich hatte auch Hunger, aber kein Messer, und ich hätte auch nicht gewußt, was ich mit einem Stück rohem Fleisch anfangen sollte. Ich sah fasziniert zu, wie innerhalb weniger Minuten die Rippen des Pferdes zum Vorschein kamen, die Messer sich immer tiefer in den Leib wühlten und Hände Fleischstücke in Taschen schoben. Die in den Himmel zeigenden Beine des Pferdes schwankten unter dem Gezerre hin und her. Das tote Pferd wuchs in meiner Erinnerung und die Menschen, die daran herumschnitten, wurden im Lauf der Jahre immer mehr zu einer Schar schwarzer Raben. Das Bild in meinem Gedächtnis wurde zu einem Kubin-Plagiat, bevor ich den ersten Kubin zu Gesicht bekam.
Der Versuch, das historische Material und die eigenen Erinnerungen auf einen Nenner zu bringen, ist so aussichtslos wie ein Versuch, auf gegeneinander verschwenkte Ebenen projizierte Bilder zur Dek-kung zu bringen. Ich habe keine Ahnung, wo die Russen waren, als das tote Pferd auf dem Schwedenplatz zerlegt wurde. Noch in Ungarn? Oder schon in den Vorstädten? Irgendwann begannen die Geschütze auf den Wiener Flaktürmen zu feuern — es war ein schwer erträglicher Lärm, für die Trommelfelle schlimmer als die Bomben.
Ich weiß auch nicht, wo die Russe) Wapeisü;nöoh in jläogarjfe^flder, schaaaarottflTäaeoi alsr.s |fti3$jft,jejaBm dieser Tage von der Rotenturm-straße zur Kaibrücke hinunterging. Ich ging etwas verträumt und sah darum viel zu spät, daß vielleicht fünfzig Meter vor mir Feldgendarmerie die Ausweise kontrollierte. Meine Papiere waren die eines Burschen, der die eine Woche zurückliegende Musterungsaufforderung ignoriert hatte. Es waren die Papiere eines Deserteurs. Es war zu spät, einen Haken zu schlagen. Ich ging, so langsam ich konnte, ohne aufzufallen, auf die Sperre zu — mit fieberhaft arbeitendem Gehirn. Wenige Meter vor den kontrollierenden Feldgendarmen angelangt, hörte ich ein Kommando: „Aufsitzen!“ Die stichprobenweise Ausweiskontrolle war beendet. Ich ging so gleichmütig wie möglich an den Männern, die man wegen ihrer an Ketten vor der Brust baumelnden Metallschilder Kettenhunde nannte, vorbei und hatte Mühe, nicht allzu sichtbar mit den Knien zu schlottern.
Ich glaube nicht, daß ich den Mut zum Widerstandskämpfer gehabt hätte. Der österreichische Widerstand hatte bekanntlich in letzter Stunde seine große Stunde. Erst im Februar und März 1945 fanden in Wien die verschiedenen Widerstandsgruppen, vor allem die in verschiedenen Zellen unabhängig voneinander operierenden zivilen Regimegegner und die Überlebenden des 20. Juli, in der Wehrmacht, Kontakt. Mein Kontakt mit dem Widerstand beschränkte sich auf ein im zehnten Bezirk aufgelesenes Flug-Watt mjt1!der1^ti^fre^“,,^as mfcch, ek-ktrj^erte^Es enthielt, die Aufforderung, die „Naziverbrecher'' (so hieß das damals, so heißt das längst nicht mehr) in keiner Weise zu unterstützen, was ich ohnehin nicht vorhatte.
Wien hat auch längst das Wissen davon verdrängt, wieviel es den Widerstandskämpfern in der Wehrmacht und ihren zivilen Helfern verdankt. Major Carl Szokoll war wie durch ein Wunder noch am Leben — oder besser, durch seine ganz besondere Genauigkeit in Sicherheitsfragen. Er hatte zu den Verschwörern des 20. Juli gehört und kam davon, weil er sein letztes Telephongespräch mit Berlin nicht direkt geführt, sondern von Wien aus irgendeine mit der Verteilung von Stiefeln beschäftigte Feldzeugstelle in Berlin angerufen und sich von dort aus zu Stauffenberg hatte weiterverbinden lassen. Alle Anrufer, die diesen damals von auswärts direkt erreicht hatten, wurden nachträglich festgestellt und verhaftet. Szokoll entging der Gestapo.
Um Wien unnötige Zerstörungen zu ersparen, riskierte er in der allerletzten Kriegsphase die direkte Kontaktaufnahme mit dem „Feind“. Bis Mitte März hatten die Widerstandskämpfer gehofft, die deutsche Heeresgruppe Süd, deren letzte Offensive Anfang März südlich des Plattensees begonnen und sich sofort festgefahren, hatte, werde so lange halten, daß die Entscheidung im Norden der Ostfront fiel und Österreich der Krieg erspart blieb. Aber am 16. März trat die sowjetische 3. Ukrainische Front unter Tolbu-chin zwischen Plattensee und Donau, etwa gleichzeitig die 2. Ukrainische Front unter Malinow-ski beiderseits der Donau, zum Angriff an. Spitzen ihrer 46. Armee überquerten am 28. März die Raab und überschritten die österreichische Grenze. Am 1. April rollten die sowjetischen Panzer durch die Bucklige Welt und eroberten Aspang und- Kirchberg am Wechsel. Am 2. April trat im heutigen Ministeriengebäude, dem damaligen Wehrkreiskommando, eine Konferenz der Verschwörer zusammen. Ein mutiger Mann, der damalige Oberfeldwebel und spätere Gendarmerieoberst Ferdinand Käs, erklärte sich bereit, sich als Parlamentär zu den Russen durchzuschlagen. Szokoll stattete ihn mit Papieren aus, die es ihm ermöglichten, jede deutsche Streife zu passieren. Wie es ihm gelang, auf die sowjetische Seite hinüberzukommen und die Sowjets davon zu überzeugen, daß er legitimiert war, im Namen der Widerständler zu verhandeln, war seine Angelegenheit.
Die Mission von Ferdinand Käs führte zu schwerwiegenden Umdis-positionen der Sowjets, die Wien nicht dort, wo sie von den SS-Verbänden des Generals Sepp Dietrich erwartet wurden, sondern, nach einer Umgehungsaktion durch den südlichen Wienerwald, von Westen her besetzten. Wien blieb damit das Budapester Sehicksal weitreichender Zerstörungen erspart, ein großer Teil der Infrastrukturen der Bundeshauptstadt, vor allem die Hoeh-quellwasserleitung und wichtige Versorgungsbetriebe, blieben erhalten.
Wien wäre mit größter Wahrscheinlichkeit noch sehr viel glimpflicher davongekommen, wären die Widerstandskämpfer nicht in letzter Minute durch einen fanatischen NS-Führungsoffizier verraten worden. Einer dieser fanatischen nationalsozialistischen Wachhunde in der Wehrmacht erfuhr durch ein abgehörtes Teiephongespräch von dem Plan, das Sendegebäude in der Argentinierstraße zu besetzen, und preßte einem der Widerstandskämpfer das Stichwort „Radetzky“ ab. Mit diesem Stichwort wurde das verbarrikadierte Wehrkreiskommando besetzt.
Am 8. April standen die Russen in der Peter-Jordan-Straße und nördlich des Franz-Joseph-Bahnhofes, am 8. April erreichten sie den Westbahnhof und Baumgarten. Am selben 8. April wurden in Floridsdorf drei verhaftete Wehrmachtsoffiziere, die der Widerstandsbewegung angehörten, hingerichtet. Ein zufällig anwesender Volkssturmmann berichtete später über • ihre letzten Augenblicke. Man hatte ihnen Tafeln umgehängt: „Ich habe mit den Bolschewiken paktiert.“ Major Biedermann starb als erster — schweigend. Hauptmann Huth rief etwas, was wie „Es lebe Österreich!“ klang, und wurde dafür vor der Hinrichtung mit Tritten gegen den Hals und einem Dolchstich ins Gesicht mißhandelt. Der letzte, Oberleutnant Rudolf Raschke, wurde schnell und ohne Zwischenfall gehängt.
Sie sind für Wien gestorben. Gestorben, um dieser Stadt unnötige Zerstörungen, unnötiges Leid, unnötige Menschenopfer zu ersparen. Es gibt in Wien eine Biedermanngasse. Man kann nur hoffen, daß sie Major Biedermann zum Gedenken so heißt. Hauptmann Huth und Oberleutnant Raschke starben bestimmt nicht leichter oder lieber — keine Straße, keine Gasse, kein Platz trägt ihren Namen.
Aber dieser Staat, der seine Patrioten leider nicht ehren konnte, weil es über entsprechende Orden zwar ein Gesetz, aber keine Ausführungsbestimmung gibt, und den sein „eigener Beitrag zur Befreiung“ nur genau so lange interessierte, wie man ihn in den Staatsvertragsverhandlungen verwerten konnte, interessiert sich ohnehin sehr wenig für dieses Blatt seiner Geschichte.
Den zweiten und den zwanzigsten Bezirk hielt die SS noch tagelang. Ich erinnere mich an das Haus an der Ecke Tandelmarktgasse und Große Sperlgasse. Im Erdgeschoß war eine Zweigstelle der Städtischen Büchereien untergebracht Am frühen Nachmittag des letzten Kampftages schlug eine Granate in den Dachstuhl dieses Hauses ein und setzte ihn in Brand. An einen Lösch-versttth dachte niemand. Womit auch,' fast ohne Wasser? Die Flammen erreichten das oberste Stockwerk. Wir bezogen Brandwachen auf den Dachböden der Nachbarhäuser, um herüberfliegende Funken rechtzeitig zu löschen. Man blieb soweit wie möglich hinter den Rauchfängen in Deckung vor den aus dem ersten Bezirk kommenden Granaten, da hatte man ganz gute Chancen, einen Einschlag heil zu überstehen. Die Bewohner des brennenden Hauses aber steckten einander mit ihrer Angst an. Sie wagten sich nicht auf die Straße — dort wurde ja geschossen. Leute aus der Nachbarschaft kamen immer wieder hinunter und redeten ihnen zu, den Keller endlich zu verlassen, in den Nachbarhäusern sei schon noch Platz. Sie schoben die Flucht auf. Vielleicht würde etwas später weniger geschossen? Die Flammen erreichten den zweiten Stock und den ersten, und ich erinnere mich (oder glaube ich nur, mich zu erinnern?), wie sie aus den Fenstern der Leihbibliothek herausschlugen — die Hausbewohner saßen noch immer im Keller. Sie hatten vor den Granaten mehr Angst als vor dem Feuer und vertrauten dem Gewölbe. Alles Zureden war zwecklos. Das Gewölbe brach über ihnen zusammen. Unter den Toten war eine Jüdin, die den ganzen Krieg als „U-Boot“ in einem Versteck überlebt hatte. Das wußte ich damals nicht, Jahre später lernte ich zufällig einen ihrer Angehörigen kennen.
Wenig später brach ein Höllenkonzert los, ein letztes Furioso des Krieges, ein letztes Artillerieduell, war es überhaupt noch ein Duell? Dann kamen die Russen. Man sah und hörte sie zuerst nicht. Über ein oder zwei Straßen rollten sie dahin, in langen Kolonnen, ohne sich in die Seitengassen zu verirren.
Ich weiß nicht, ob in jener Nacht die Russen noch im ersten Bezirk waren oder schon im zweiten, aber ich erinnere mich deutlich, wie ich auf unserem Dachboden stand und zum ersten Bezirk hinübersah. Ich sah es rund um den Stephansturm brennen und versuchte herauszufinden, ob auch die Kirche brannte. Ich sah deutlich, wie die Flammen emporschlugen und dachte: „Da brennt der Stephansdom!“ Ich empfand eine seltsame Leere dabei.
Am nächsten Morgen standen die Wiener auf der Taborstraße Spalier, endlose sowjetische Fahrzeugkolo-nen rollten die Taborstraße hinunter — ich erinnere mich an ein gewisses Staunen: Warum bringen sie uns eigentlich nicht um? Zuerst wurden die weißen Fahnen gehißt, und dann die roten. Die rotweißroten kamen erst viel später. Die roten Fahnen hatten einen dunklen Kreis in der Mitte, dort, v/o das weiße Feld mit dem Hakenkreuz gewesen war.
In der Castellezgasse flogen Tabakballen aus den Fenstern eines Lagerhauses. Trotz der Zettel mit der Aufschrift „Plünderer werden standrechtlich erschossen“ war in manchen Straßen längst kein Rollbalken mehr heil. Zuerst waren die Milch- und Lebensmittelläden aufgebrochen worden, dann kamen die Schuh- und Kleidergeschäfte dran und dann alle anderen. Umgeworfene Ladentische, zersplitterte Vitrinen, aufgesprengte Kassen, auf dem Boden verstreute und zertrampelte Waren. Ein Brei aus Mehl, Grieß, Zucker, Waschpulver und Marmelade.
Vor dem Bayrischen Hof lag ein Ausländer auf dem Rücken, auf seinem kleinen Rucksack. Eine ins Reich verschleppte fremde Arbeitskraft. Er hatte ein Loch in der Brust, das Loch so staubgrau wie der Mann. Er war direkt in eine Explosion gerannt.
Vor den Schuhgeschäften aber, wo die Menschen ganze Stöße von Schachteln von den Stellagen gerissen hatten, wo sich die Schachteln im Fall geöffnet hatten und alle Schuhe durcheinandergepurzelt waren, standen lange Reihen vereinzelter Schuhe. Man nahm einen aus dem Chaos im Geschäft und suchte in der Schuhreihe vor dem Geschäft den dazupassenden zu finden. Ich hatte leider kein Glück. Zwischen den Einheimischen — Sowjetsoldaten mit umgehängtem Sturmgewehr bei derselben Tätigkeit.
Auf den Straßen: Schutt, ausgebrannte Tanks, deformierte Autos, durchsiebte Straßenbahnwagen, ein Chaos herunterhängender Leitungen und herausgerissener, verbogener Schienen, Granattrichter und Tote.
Wien war befreit. Der Frieden war da. Der Wiederaufbau . konnte beginnen. Mancher Wiener hatte das Gefühl, einen solchen Frühling noch nie erlebt zu haben. Denn es war nicht nur der erste Frühling im Frieden, sondern es war auch ein besonders schöner Frühling mit besonders zarten Knospen und Blättern und einer besonders linden Luft. Ein Frühling der Chancen, ein Frühling des Neubeginns — natürlich war es ein Frühling wie jeder andere.