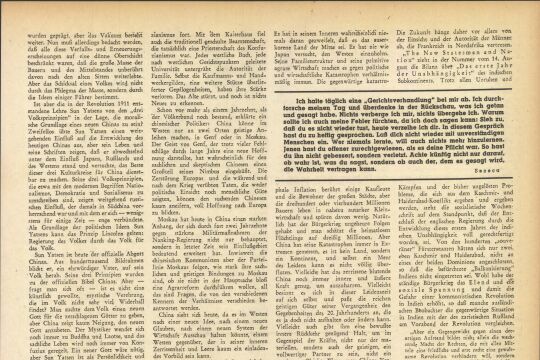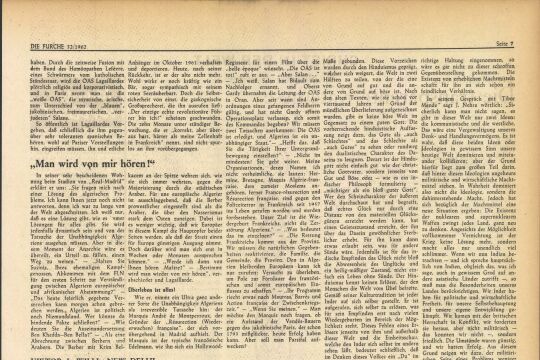Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mehr Taten, nicht Worte
Schockiert von der Armut, beeindruckt von der Kultur des Landes, so kehrte Papst Johannes Paul II. am 10. Februar von seiner Pastoralreise nach Indien zurück, die ihn - mehr als bisherige Reisen - mit fremdartiger Religiosität und nacktem Elend konfrontierte.
Schockiert von der Armut, beeindruckt von der Kultur des Landes, so kehrte Papst Johannes Paul II. am 10. Februar von seiner Pastoralreise nach Indien zurück, die ihn - mehr als bisherige Reisen - mit fremdartiger Religiosität und nacktem Elend konfrontierte.
8000 km ist der Papst in zehn Tagen durch Indien geflogen, in 13 Orten dieses 750-Millionen-Lan-des ist er mindestens der Hälfte der zwölf Millionen Katholiken begegnet, und viele Millionen Andersgläubige haben ihm ebenso wie die Katholiken nicht wie einem Volkstribunen zugejubelt, sondern ihn als einen Weisen aus dem Abendland freundlich und fromm empfangen, ihm auch geduldig zugehört, selbst dann, wenn sie ihn nicht verstanden.
Denn 130 verschiedene Sprachen werden in Indien gesprochen, und wenn der Papst sich auch in der einen oder anderen zuweilen mit ein paar Sätzen versuchte und sein Englisch möglichst einfach formulierte, so war
doch seine Predigt, seine Aussage als solche, so sehr wie noch auf keiner seiner Reisen auf einige fundamentale, ganz allgemein religiöse und menschliche Aussagen begrenzt. So daß eigentlich das, was sonst Johannes Paul II. als Pilger und Missionar und auch als kirchlichen Lehrmeister auftreten läßt, in Indien zu verblassen schien.
Schon am ersten Tag hatte der Erzbischof von Delhi, Angelo In-nöcent Fernandes, bei der Begrüßung des Papstes dafür das Stichwort geprägt: Die Kirche müsse sich als „ein Glaubensbekenntnis unter anderen Glaubensbekenntnissen“ verstehen, Irrtümer der Vergangenheit korrigieren und neue Beziehungen herstellen wie sie „der Religion als solcher“ entsprechen. Der Papst folgte dieser Linie (auch wenn er sie nicht als einen vermischenden „Synkretismus“ verstanden wissen wollte).
Das geschah vor allem aus Rücksicht auf die anderen vorherrschenden Religionen, zumal den Hinduismus—aus dessen Mitte bis zuletzt Kritik, aber auch Furcht vor dem Missionar aus Rom hörbar war — freilich von Tag zu Tag leiser. Denn der Papst war bis an den Rand der Selbstverleugnung darauf bedacht, keinen Bekehrungseifer zu entfalten. Im Unterschied zu all seinen bisherigen Besuchen in Missionsländern hat er in Indien keine öffentlichen Taufen vorgenommen und mit keinem Wort den christlichen
und den katholischen als den einzigen Heilsweg verkündet.
Auch nur einmal hat er jenes Reizthema der Geburtenkontrolle angesprochen, das sonst bei seinen Reisen die meisten Schlagzeilen macht (auch wenn es in Wirklichkeit immer nur in ganz wenigen der vielen tausend Sätze seiner Ansprachen vorkommt). In Indien ist es allerdings ein bedrückendes Problem. Die Bevölkerungsexplosion ist dort zwar schwächer als in den meisten Ländern der Dritten Welt, aber mit 1,2 Prozent und mit 223 meist verelendeten Menschen pro Quadratkilometer katastrophal genug.
In der Acht-Millionen-Stadt Bombay, wo sechs Millionen auf der Straße oder in Hütten neben Betonpalästen leben, sprach der Papst fast schüchtern über „verantwortliche Elternschaft“ und berief sich dabei nicht wie sonst auf die Enzyklika „Humanae Vi-tae“, sondern auf Mahatma Gandhi, den hinduistischen Nationalhelden. Nur ihn zitierte der Papst mit dem Ausspruch „es müsse ein kontrolliertes Bevölkerungswachstum geben“, aber, so Gandhi, „nicht durch unmoralische oder künstliche Mittel, sondern durch ein diszipliniertes und selbstkontrolliertes Leben, durch moralische Zurückhaltung“. Dies sei auch die tiefe Uberzeugung der Kirche, sagte der Papst und kein Wort mehr.
Doch als Gandhi, der 1948 ermordet wurde, jenen Ausspruch tat, gab es noch längst keine Pille zur Empfängnisverhütung; als Rufer zu Gewaltlosigkeit hatte Gandhi sich gegen gewalttätige Eingriffe gewendet, gegen Ab-
treibung und Zwangssterilisation als Mittel der Geburtenkontrolle. Indem der Papst sich jetzt auf ihn berief, reduzierte er gewollt oder ungewollt seine bisherige Argumentation in der umstrittenen Frage.
Uberhaupt sprach er hier nicht als ein Kirchenlehrer oder Prophet mit messianischer Botschaft, sondern eher wie ein weiser „Gu-ru“, der asiatische mit christlicher Religion so zu verschmelzen versucht, daß er sogar das Massenelend und die Kastendiskriminierung nicht mehr mit politischer oder kirchlicher Verantwortlichkeit zu verbinden schien. „Ich bin nicht gekommen, um gegen die Tradition der Inder und ihre sozialen Sünden zu polemisieren“, sagte er auf dem Rückflug nach Rom zu uns Journalisten. Beeindruckt habe ihn der kulturelle Reichtum des Landes, schockiert jedoch die materielle Armut.
„Dank Mutter Teresa von Kalkutta bin ich aber guten Gewissens nach Indien gereist“, fügte er hinzu. Einer der prominentesten Bürger von Kalkutta hatte ihn in dieser verelendetsten Stadt der Welt mit den Worten begrüßt: „Hassen oder lieben muß man Kalkutta — ein Papst hat aber da keine Wahl.“ Taten, nicht Worte seien da vom Christen gefordert, rief der Papst als Antwort, wobei man ihm anmerkte, daß er auch dann, wenn ihn tanzende Mädchen umringten und mit Blumengirlanden schmückten, seine Ohnmacht empfand. „Wer kann die Machtlosigkeit zahlloser Menschen angesichts von Unge-
rechtigkeit und Unterentwicklung übersehen“, rief er und beschwor die Welt, nichts zu tun, was Haß und Leid fortdauern läßt, „nichts für den Rüstungswettlauf, nichts zur Unterdrük-kung der Völker, nichts unter scheinheiligen Formen von Imperialismus und unmenschlichen Ideologien“.
Nicht nur das eigene Evangelium beschwor er gegen die Übel, sondern auch immer wieder die guten Geister Indiens, von Rabin-dranath Tagore bis Mahatma Gandhi. Doch nur einmal kam ihm auf der ganzen Reise das empfindlichste Stichwort indischer Wirklichkeit über die Lippen: die Kastendiskriminierung, die (obschon offiziell abgeschafft) Millionen Menschen nur ein Dahinvegetieren erlaubt.
Der Besuch bei Mutter Teresa von Kalkutta sollte dagegen ein Zeichen setzen, daß mehr als jede Predigt wiegt. Hand in Hand ging der Papst mit der kleinen zerbrechlichen Frau durch das Heim „Nirmal Hriday Aschram“, durch die Säle der Dahinsiechenden und Sterbenden. Seit 40 Jahren, lange bevor die Welt von ihr sprach, bietet ihnen Mutter Teresa eine letzte Zuflucht. „Das sind vier von 22.000, die hierher zum Sterben kommen“, sagte sie und führte den Papst zu den Toten dieses Tages.
25.000 Menschen sind seit 1952 hier soweit auch gesundgepflegt worden, daß sie in das Elend ihres Lebens zurückkehren konnten, ein Trost, wenn auch ein schwacher. Viele ungenannte und nicht nur fromme Nothelfer wirken heute (ohne Aussicht auf den Nobelpreis) in Kalkutta. Und der
Papst wollte sie alle in der Symbolgestalt Mutter Teresas als Zeugen für den „prophetischen Dienst an den Ärmsten der Armen“ ehren, und er redete und segnete nicht nur, verteilte nicht nur Andenken, sondern auch eigenhändig Schüsseln mit Essen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!