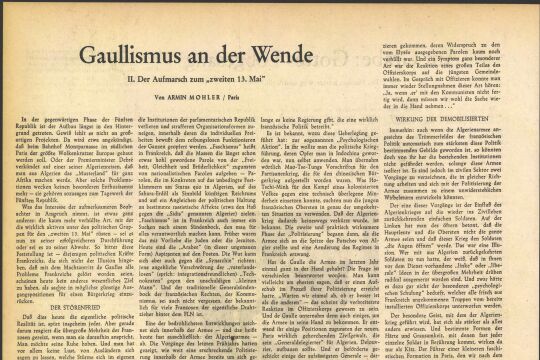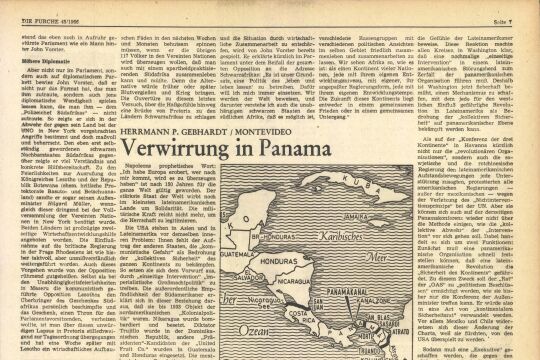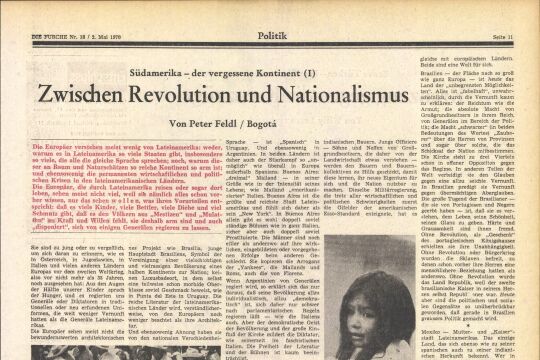Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Militärputsche sind out
In Guatemala wollten die Offiziere im Frühjahr noch einmal Muskel zeigen. Aber der „auto-golpe”, der Eigen-Putsch, von Präsident Serrano geriet zur Farce. Jetzt gibt es einen neuen, vom Parlament gewählten Zivilpräsidenten. Das ist neu auf dem Subkontinent, der noch vor eineinhalb Dekaden den Offizieren gehörte. Der Militärputsch hat ausgedient.
In Guatemala wollten die Offiziere im Frühjahr noch einmal Muskel zeigen. Aber der „auto-golpe”, der Eigen-Putsch, von Präsident Serrano geriet zur Farce. Jetzt gibt es einen neuen, vom Parlament gewählten Zivilpräsidenten. Das ist neu auf dem Subkontinent, der noch vor eineinhalb Dekaden den Offizieren gehörte. Der Militärputsch hat ausgedient.
Was Präsident Alberto Fujimori 1992 noch gelang - die Mobilisierung der Armee gegen die Institutionen des demokratischen Verfassungsstaates -, wurde ein Jahr später für Präsident Jorge Serrano zum Fiasko. Hatte das interamerikanische System schon auf den „auto-golpe” in Peru (das mit der gnaden- und kompromißlosen Terrororganisation „Sende-ro Luminoso” eine Sonderstellung einnimmt) empfindlich reagiert und das Versprechen von Neuwahlen erzwungen, so tolerierte es den „auto-golpe” in Guatemala nicht mehr. Pro-nunciamientos dieser Art sind heute in Lateinamerika, wo der Staatsstreich traditionell als Mittel der Politik galt, unerwünscht.
Heute paradieren die lateinamerikanischen Uniformträger als arme Schlucker, für die im Budget kein Geld übrigbleibt. Der neoliberale Umbau, den Subkontinent auf Geheiß der USA auf Demokratie und Zivilgesellschaft verpflichtend, magert die Offiziere finanziell ab und reduziert drastisch die Armeevolumina. Obendrein entzieht er den Uniformträgern das traditionelle Rollenverständnis. Denn seit Ende des Kalten Krieges gibt es keine „kommunistische Subversion” mehr, die es zu bekämpfen gälte. Und die neue Aufgabe, auf die Washington pocht, nämlich in der Drogenbekämpfung aufzutreten, gilt ihnen als „unehrenhafte und schmutzige Polizeiarbeit”.
Armee als Schiedsrichter
Sicher, es bleiben Ausnahmen, die die Regel - politische und finanzielle Auszehrung der Streitkräfte - bestätigen: in Guatemala agiert die Armee nach wie vor als repressive Kraft gegen Indianerbauern; in Paraguay können Offiziere noch immer politische Drohungen ausstoßen; in Chile hält General Pinochet seine geradezu preußisch disziplinierte Armee intakt (freilich, ohne den demokratischen Reifegrad der Zivilregierung beeinträchtigen zu können).
Warum gab es so lange das Übergewicht von Uniformträgern in Lateinamerika? Es sind historische Wurzeln: Lateinamerika erkämpfte seine Unabhängigkeit vor 170 Jahren auf militärischem Weg.
Deswegen blieben befehlsgewohnte, hierarchisch denkende Caudillos den jungen Republiken nicht erspart, zumal die beiden klassischen Parteilager, Liberale und Konservative, untereinander immer wiederBürgerkriege ausfochten. Deshalb griff die Armee, deren Aufgabe von Anfang an auch im Niederhalten der bäuerlichen Indianerbevölkerung bestand, in der Stunde der Wahrheit, wenn das Auseinanderbrechen des Staates, das Chaos des „Nihilismus” drohte, ein, sie putschte und übernahm immer wieder als „Schiedsrichter” selber die Macht.
Um 1950 avancierten die lateinamerikanischen Offiziere zu verläßlichen Bündnispartnern im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion. Einzig die smarte Kennedy-Regierung glaubte, die südlicheren Uniformträger unter politische Kontrolle zu bringen, indem sie - als neue Doktrin - nur verfassungsgemäßen Zivilregierungen ihre Unterstützung anbot. Aber bereits 1963 wurden Militärputsche, soferne grimmig antikommunistisch, erneut toleriert. Der Grund: Washington gab unter dem traumatischen Schock der Revolution Fidel Castros, bei der Kuba in Moskau militärische Unterstützung gesucht hatte, die neue Linie rasch wieder auf.
Mit den Verfassungsbrüchen in Brasilien und Argentinien begann nach 1964 überhaupt ein neues Kapitel. Richtungweisend für den Subkontinentübernahm am 1. April 1964 in Brasilia nicht nur irgendein Caudil-lo in Uniform die Macht, sondern die Armee korporativ. Brasiliens Offiziere zeigten damals als erste in Lateinamerika das zukünftige Janusgesicht der Armeen: Einerseits schroff antikommunistisch und gnadenlos gegen jede Art von „Subversion”, andererseits modernisierungsorientiert, entwicklungswillig und aktiv als Industriekapitäne. Auf der Basis einer kontinentalen •Sicherheitsdoktrin („seguridad nacional”), die einen starken, modernen, technikerprobten Staat wollte, engagierten sich die brasilianischen Offiziere - die Zivilpolitiker der Unfähigkeit zeihend - in der forcierten Entwicklung des riesigen Landes.
Allerdings gab es auch Offiziere, die den Kern dieser „konservativen Revolution” zu einem anspruchsvollen Linksnationalismus mutierten. Bestimmend wurde die Erfahrung Perus nach dem Oktober 1968, als Offiziere, die während der schonungslosen Guerillabekämpfung ihr Land erdnah erfahren hatten, die Macht ergriffen, um die Oligarchie zu zerschlagen, eine Agrarrevolution zu dekretieren, nordamerikanische Konzerne zu beschlagnahmen, Auslandskapital einzuschränken und die eigene Bevölkerung zu mobilisieren. Zwar versandete dieser „peruanische Nasserismus” viel zu rasch nach 1974, doch Ausläufer erreichten Ekuador und Panama.
Ohnmächtige Wortmeldungen
In den sechziger und siebziger Jahren wandelten sich die Offiziere von bloßen Uniformträgern zu Entwicklungspolitikern, Technokraten und Managern, die vor allem bei den Staatskonzernen und in den Planungs-Ministerien in Vorstandspositionen einrückten und damit auch wirtschaftliche Macht in die Hände bekamen. Gekoppelt mit eigenen (unkontrollierten) Verwaltungen, eigenen Rüstungsfirmen und eigenen Banken, ganz zu schweigen von eigenen Clubs, Einkaufshäusern, Kriegsakademien und Forschungseinrichtungen, entstand ein militärisch-industrieller
Komplex, der lateinamerikanische Politik bestimmte.
Freilich hatte diese Entwicklung ihren Preis: Lateinamerikas Offiziere, ihrer eigenen Hybris verfallend, zerstörten mit dem Abbau des bürgerlichen Verfassungsstaates auch alle Kontrollinstanzen. Arroganz, Korruption und Geldvernichtung waren die Folge. Obendrein funktionierten die Armeen wohl als interne Repressionsapparate, nicht aber als wirkungsvolle Kriegsmaschinen. Argentinien verlor 1982 unrühmlich gegen Großbritannien den Krieg um die Falk-land-Inseln. Nach zwei Dekaden Mi-litärherrschaft kündigte sich außerdem der wirtschaftliche Bankrott etwa in Peru, Argentinien, Brasilien und Mittelamerika an.
So blieb den Offizieren Anfang der achtziger Jahre nichts anderes übrig, als im Rahmen eines komplizierten „retorno” den Rückzug in die Kasernen anzutreten und das verdrießliche Geschäft der Tagespolitik wieder den Zivilisten zu überlassen.
Heute sehen die Dinge dramatisch aus. Der Kalte Krieg ist zu Ende. Lateinamerika gibt seinen Wirtschaftsnationalismus auf, macht auf Neoliberalismus, schlankt den Staat ab und reduziert aus Geldmangel seine Streitkräfte, deren Mitglieder kaum noch eine Aufgabe zu erfüllen haben. Wenn sich heute Offiziere zu Wort melden - wie in den letzten Monaten zweimal in Venezuela -, dann nicht, um die Macht zu übernehmen, sondern um ohnmächtig und frustriert gegen den neoliberalen Umbau zu wettern, der alle „heiligen Kühe” des lateinamerikanischen Nationalismus schlachtet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!