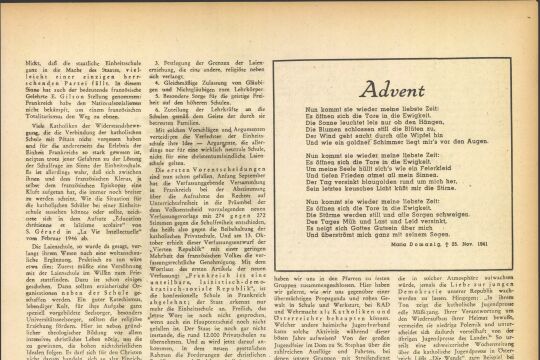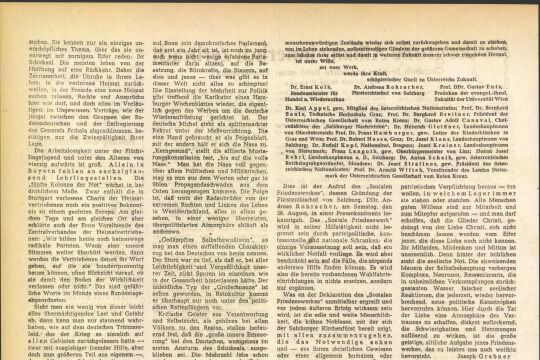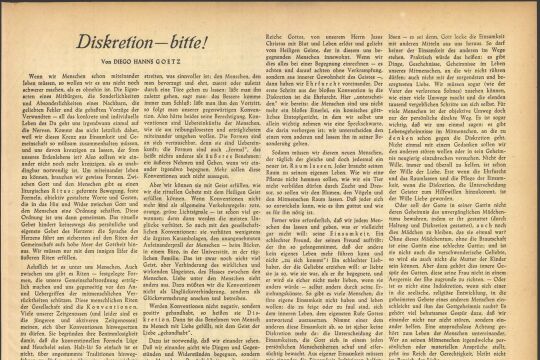Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mit Behinderten leben
Bei unserem letzten Besuch in Venedig trafen wir eine Gruppe von zwanzig italienischen Kindern mit ihrem Betreuer, einem jungen Priester aus Umbrien. Unter den sorgenfreien, erlebnishungrigen Touristen nahm er sich seltsam aus.
Er entstammt, wie wir bald erfuhren, einer wohlhabenden Adelsfamilie, lehnte aber alle Berufungen in ehrenvolle Ämter ab und opferte sie gern seinen Schutzbefohlenen. Eben diesen zwanzig Kindern. Keines von ihnen hat je sprechen und hören können, alle sind taubstumm.
Wir verlebten viele Stunden miteinander und unser anfängliches Bedauern schwand bald. Diese Kinder wurden geliebt und liebten aus vollem Herzen wieder. Sie sind keine Kranken, die auf Genesung hoffen können.
Solange sie beieinander und in der Gemeinschaft mit ihrem großen priesterlichen Freund bleiben, wird ihnen auch ihre Behinderung kaum zum Bewußtsein gebracht. Keiner hat dem anderen etwas voraus oder wird von diesem ins „aus“ verwiesen.
Wieder einmal wurde überdeutlich, daß die Maßstäbe Nichtbehinderter für Behinderte schwerer zu ertragen sind, als ihre eigentliche Behinderung. An der Reaktion der Menschen in Venedig war die ganze Skala dessen, was Nichtbehinderte beim Anblick Behinderter empfinden, ablesbar - vom Mitleid bis zum Entsetzen. Auf einen Nenner gebracht heißen die Empfindungen: Ihr stört unsere Kreise, gehört nicht zu uns, macht uns Mühe.
Wir ertragen den Anblick der Krankheit nicht und schicken unsere Kranken in die Krankenhäuser, beklagen aber lautstark deren mangelnde
Menschlichkeit. Wir ertragen nur schwer den Anblick Behinderter und sind dann hilfloser als die eigentlich Hilflosen.
Das Jahr der Behinderten, das jetzt anbricht, sollte nicht nur den A nlaß abgeben, größere und schönere Heime zu bauen, soziologische Studien in Auftrag zu geben. Esgéht vielmehr um ein Umdenken: Wir sollten unsere Einstellung zum Sinn und Stellenwert des Leidens überprüfen.
So wenig Krankheit und Behinderung sonst miteinander gemeinsam haben: Unsere sehr ähnliche Reaktion auf beide macht sie zu Schicksalsgefährten und vereint die verschiedenen.
Das Jahr 1981 soll in der ganzen Welt als „Jahr der Behinderten“ begangen werden. Es ist gewiß nicht in Ordnung, daß wir solcher Erinnerung überhaupt bedürfen. Wir wollen ebenso wenig krank, wie behindert sein, das ist menschlich und verständlich.
Wir wollen aber auch ebenso wenig in Krankheit und Behinderung Gottes Willen sehen. Das offenbart unser Glaubensdefizit. Es hindert uns nicht nur an tätiger, vernünftiger Nächstenliebe, sondern ist ein stillschweigender Aufstand gegen die Art, wie Gott liebt.
Viele Christen haben in den letzten Jahrzehnten für ihren Glauben entdeckt, was früheren Generationen verborgen oder tabu war und was sie daher sich selbst überließen. Wir lernten, daß es ein Recht des Widerstands gegen Staatsgewalt gibt. Wir erkannten die unheilvolle Verkoppelung von Mission und Kolonialismus. Wir überwanden die Almosengesinnung und gewannen statt ihrer soziale Verantwortung.
Gleichzeitig aber wurden wir leider zunehmend hilfloser im Umgang mit
Kranken und Behinderten. Gewiß, wir batten Krankenhäuser und Rehabilitationszentren, die an Perfektion kaum mehr zu übertreffen sind. Unsere Fähigkeit aber, Kranke und Behinderte als Weggenossen anzunehmen, verkümmerte immer mehr. Inmitten überbordender Sozialleistungen werden wir selbst geradezu asozial.
Man kann nicht an alles zugleich denken, sicherlich. Auch gelebter Glaube braucht immer wieder neue Schwerpunkte, aber er darf die alten darüber nicht vergessen. Es darf uns einfach nicht aus dem Blick kommen, daß seit Beginn der Christenheit den Mühseligen und Beladenen, den Trostbedürftigen und Verzweifelnden, dem geknickten Rohr und dem glimmenden Docht - seitenlang könnten wir fortfahren - die frohe Botschaft gilt.
Wir sind zwar fasziniert von den Erfolgen der Medizin, gleichzeitig aber immer weniger bereit, in gesundheitlichen Störungen anderes als Pannen zu sehen. Lebenslange Schäden gar, wie sie Behinderten meist eigen sind, können wir mit unserem ängstlich gewordenen Glauben nur noch mühsam zusammenbringen. Bevor wir womöglich selbst Kranke oder Behinderte werden, ist unsere Seele schon verkümmert.
Sie hatte einseitig auf die Hilfe durch Menschen gesetzt. Nun hat sie keine Kraft mehr, den zum Helfer zu rufen, der Zuversicht und Stärke in großen
Nöten ist und dessen Liebe am Werk bleibt, auch wenn wir durch angstvolle Stunden gehen.
Unser Beitrag zum Jahr der Behinderten kann also nicht in erster Linie im Vorweisen dessen bestehen, was Kirchen, diakonische Werke und zahllose Vereine zur Bewahrung der notwendigen Identität von Glaube und Liebe in die Tat umsetzen. Sie können sich ja sehen lassen, diese Menge Fluchtburgen für Kranke und Behinderte, welche die Christenheit ihren leidenden Gliedern errichtete! Sie waren und sind Zeugnisse tätigen Glaubens, dessen Glaubwürdigkeit darin besteht, daß er zur Liebe frei macht.
Sind wir aber, die Nichtbehinderten, wir, die Nicht- oder Nochnichtkran- ken, für uns selbst und vor allem für den
Umgang mit Behinderten dabei wirklich klüger geworden? Danach aber fragt das ärgerliche Thema dieses Jahres, danach fragen auch diese Worte.
Die meisten von uns müssen nicht mit der Behinderung, sondern mit Behinderten leben. Was wir aber hier versäumen, trotz aller Betriebsamkeit, die wir für Kranke und Behinderte aufbringen, bleiben wir nicht zuletzt auch uns selbst schuldig. Denn morgen schon kann es an uns sein. Morgen schon kann sich erweisen, daß alle sozialen Netze, die wir geknüpft haben, den Sturz in die Tiefe nicht aufhalten.
Dann spätestens, wenn Krankheit und Behinderung über unsere eigene Schwelle treten sollten, werden wir unausweichlich gefragt, wer der Herr im Hause unseres Lebens ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!