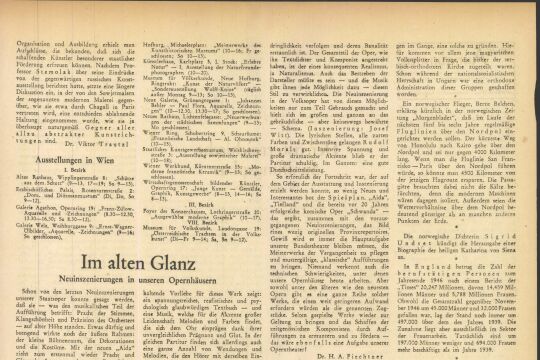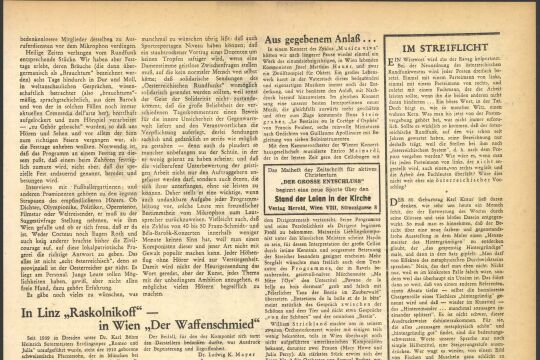Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mit Puccini und Priestley
Das Tiroler .Landestheater wendete sich in seinen Eröffnungspremieren an zwei verschiedene Schichten des Publikums. Während das Schauspiel mit einem diffizil inszenierten Problemstück begann, das die Verständnisbereitschaft und die Phantasie des Zuschauers forderte, brachte die Oper mit Pttccirus „Tosca“ ein für seine Wirkung wohlbekanntes Musikdrama, das Revolutionärs- und Künstlerromantik, Liebe und Folter, Kirche und Festung, Heldentum und Bosheit im eingängigen Realismus der Guckkastenbühne bunt und rührend darbietet. Anerkennung hat freilich Puccinis Musik immer wieder gefunden — er kennzeichnet, ja individualisiert sogar die Personen, mildert die groben Effekte des'Dramas bisweilen, gestaltet reizvoll die zunächst im Libretto nur effektvollen Kontraste.
Helmut Wlasak wog in seiner Inszenierung die Vor- und Nachteile dieses Musikdramas klug gegeneinander ab, er ließ keine falschen Emotionen aufkommen und versuchte das musikalische Geschehen dramatisch natürlich auszudrücken, auch wenn im ersten Akt die Effekte sehr ausgekostet wurden. Vor den großzügigen mit ihren Grau-Weiß-Tönen sehr schönen Bühnenbildern (Hansjörg Stock) sangen und agierten drei für diese Oper speziell engagierte Protagonisten. Marcella Reale erwies sich als stimmlich wie schauspielerisch ideale Besetzung der Tosca. Nwccio Saetta sang mit jugendlich markanter Stimme den Cavaradossi und fand viel verdienten Beifall. Bohus Hanak wußte mit seiner glänzenden Stimme und echtem schauspielerischem Talent die Rolle des Scarpia vom Piano bis zum Forte gleichermaßen zu beherrschen. Der sicheren Wirkung des Werkes gewiß, hatte Intendant Wlasak italienisch singen lassen, wie es zur Freude des Musikliebhabers in Innsbruck schon bei vielen Opern geschah, das erhöhte den musikalisehen Reiz — beeinträchtigt wurde er hingegen durch den zum Teil zu starken Orchesterklang, der etwa im Gebet den Gesang der Tosca überdeckte, wenn auch E. Seipenbusch insgesamt mit der bei ihm gewohnten Souveränität und dem ihm eigenen Werkverständnis dirigierte.
Priestleys „Schafft den Narren fort“, 1955 im Burgtheater erstaufgeführt, fand durch die Bearbeitung und Inszenierung von Oswald Fuchs eine eigenwillige und faszinierende Interpretation. Die allzu laute Warnung des Autors vor einer völlig technisierten, entpersönlichten, entseelten Welt, in der die Narrheit der einzige menschliche Ausweg ist, wurde hier auf der einen Seite stark ins Märchenhaft-Phantastische gewendet; anderseits die Konfrontation der humanen romantischen und der entseelten fortschrittsgläubigen Typen stärker akzentuiert. Der Gegensatz drückte sich in Kleidung, Bewegung und Sprache aus: auf der einen Seite stereotype Monotonie des Roboterhaften, auf der anderen Seite die Nuanciertheit warmherziger Stimmen. Der Regisseur läßt vor einer fast leeren Rundbühne spielen und schafft Stimmung und Atmosphäre durch Lichteffekte. Das Geschehen ist so weniger handgreiflich vordergründig, vom Publikum wird mehr gefordert. Es muß etwa die Erlösung von der alles beherrschenden Maschine durch Joey, den Narren, lediglich auf Grund des plötzlich einfallenden warmen Lichtes und der gelösten Bewegungen der vorher roboterhaft erstarrten Menschen begreifen. Doch wird wiederum das Verständnis erleichtert durch das Durchschaubarmachen des Märchenschemas: Verzauberung der Welt und Erlösung durch den guten, standhaften Menschen, sei er auch ein Narr. Die sorgfältige und einfallsreiche Regie und die offensichtliche Spielfreudigkeit des Ensembles führten zu einer abgerundeten Gesamtleistung. Die gewollte Uniformität der Robotermenschen macht es fast unmöglich, Einzelinterpretationen aus dieser Gruppe hervorzuheben, doch gerade in dieser Einheitlichkeit lag für den Zuschauer die Faszination. Hervorragend wußte Franz Kainrath als „Lobo“ seine Suche nach menschlicher Wärme und sein Ringen um die Erinnerung deutlich zu machen. Die Rückentwicklung zum Menschen, das Tasten nach dem eigenen Ich fanden in Gerhard A. Matten (Harlekin), eine packende Gestaltung. David Bibring (Joey) ließ die ganze Skala menschlicher Empfindungen aufleuchten, warmherzig und weise in seinem Kampf um die Rettung der anderen. Barbara Schalkhammer (Columbine) spielte die liebende, zweifelnde und gefährdete Frau mit Charme und Grazie.
Beide Premieren brachten gutes Theater, beide den Aufruf zur Menschlichkeit, doch in der Oper war dieser Aspekt nur Vorwand für einen musikalischen Genuß; im Sprechtheater dagegen wurde das etwas flache Stück durch die Interpretationsleistung bei aller ästhetischen Schönheit zu einem echten Appell.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!