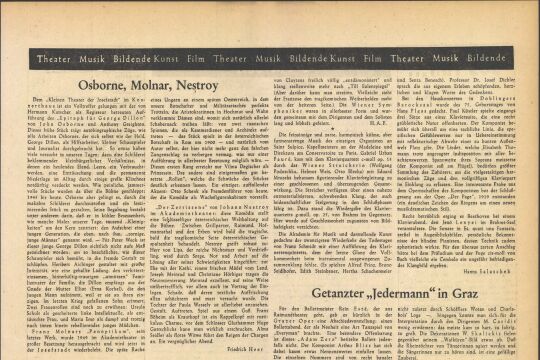Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mit Stein und Milstein
Horst Stein, der trotz seiner Hamburger Tätigkeit glücklicherweise durch einen ausgedehnten Gastvertrag der Wiener Staatsoper und auch den Wiener Konzerten erhalten bleibt, konnte im letzten Orchesterkonzert der diesjährigen Wiener Festwochen, veranstaltet vom Konzerhaus mit den Wiener Symphonikern und der Singakademie, von seinen bedeutenden Dirigentenqualitäten erneut überzeugen. Das ausschließlich Mozart gewidmete Programm der Matinee begann mit der G-Dur-Symphonie, KV 318, die viele Merkmale der Mannheimer Schule mit ihren Zieraten und Crescendi der Bläserepisoden in sich trägt, dagegen auf thematische Kombinationen verzichtet. Dann spielte Philippe Entremont das Klavierkonzert C-Dur (KV 467), ein hervorragender Pianist, den man gern und oft zu Gast sähe. — In Umwandlung der heiteren Introduktion des Konzertes fol-te nach der Pause das Requ'em. Sehr gut schnitt hier die genau studierte, sauber intonierende Singakademie ab, der man ein machtvolles „Kyrie“ und „Dies irae“, aber auch die innig vorgebrachte Bitte im „Confutatis“ und „Lacrimosa“ verdankte; in bester Verfassung spielten trotz der zahlreichen Festwochendienste die Wiener Symphoniker. In dem qualitativ unterschiedlichen Solistenensemble fiel am vorteilhaftesten der füllige Alt Ingrid Mayrs auf, auch der silbrig-helle, nur manchmal etwas unruhige Sopran Sono Cha-zarians behauptete sich gut; ein schöner, dunkel timbrierter Baß, leider mit wenig Tiefe, ist Jaroslav Stajnc zu eigen, weniger konnte der Tenor Friedrich Melzers auf Grund eines kehligen Beiklanges befriedigen.
*
Das letzte im Zeichen Bartöks stehende Konzert der Wiener Symphoniker brachte „Vier Orchesterstücke'“, op. 12, des Komponisten, die, in dessen frühe Schaffenszeit fallend, eine tonale, fast romantizistische Handschrift zeigen, sofern für diese die damals bereits essentielle Beschäftigung Bartöks mit dem ungarischen Volkslied und die noch reichlich fließende Melodik ein Ferment bilden. Besonders maßgeblich für den Erfolg der Stücke sind das lyrisch gehaltene Preludio und ein bizarr instrumentiertes, walzerartiges Scherzo. Nach Mozarts „Kleiner g-Moll-Symphonie“ (KV 183), einem der wenigen Instrumentalwerke des Meisters mit düster-ernstem Charakter, trat dann das große Ereignis des Abends ein, das Wiedersehen mit einem lange vermißten Künstler, mit Nathan Milstein, der Beethovens Violinkonzert (mit eigenen Kadenzen) spielte. Nicht das von manchen anderen großen Geigern zum Haupttrumpf ausersehene Rondo steht in Milsteins Interpretation im Mittelpunkt, sondern die ins Geistige transponierte Virtuosität des ersten Satzes und das Mysterium des Lar-ghettos. Hier zeigte sich die fast schon legendär gewordene Meisterschaft Milsteins, der als Musiker und als Instrumentalist gleich hoch einzuschätzen ist. Und der Jul>el des enthusiasmierten Publikums des großen Konzerthaussaales schien kein Ende zu nehmen. Das Konzert stand unter der Leitung Horst Steins. Ist dieser ausgezeichnete Dirigent am Konzertpodium nicht noch besser als am Opernpult? Eine schwer zu entscheidende Frage!
■ *
Nicht alle Festwochenkonzerte wiesen ein so hohes künstlerisches
Niveau auf wie der Soloabend Nathan Milsteins im großen Konzerthaussaal. Daß ein Geiger von so bedeutendem, internationalem Ruf alles Technische in einem nicht mehr zu überbietenden Ausmaß beherrscht, braucht bei Milstein keiner weiteren Erwähnung. Aber was man bei solchen Instrumental virtuosen viel seltener antrifft, ist die in der hohen Musikalität des Künstlers wurzelnde Stiltreue, mit der er jedes einzelne Stück vorträgt. Geminicnis A-Dur-Sonate war im zweiten Satz recht geeignet für das Einspielen der Akkordik in der folgenden Partita I in h-Moll von Bach, in der Milstein gedächtnismäßig und in technischer Hinsicht eine grandiose Leistung bot. In Schumanns a-Moll-Sonate, Opus 105, wechselte er in die Romantik hinüber, um mit Beethovens „Kreutzersonate“ den glanzvollen Abend zu beschließen. Hier war der junge, hochtalentierte Georges Pluder-macher ein würdiger, dem großen Geiger kaum nachstehender Klavierpartner. — Unter den vielen Vorzügen, besser gesagt Einmaligkeiten, die Milstein vor großen Geigerkollegen voraus hat, ist sein zauberhaftes, ätherisches Piano zu erwähnen, die hauptsächlich „auf kleinen Ton“ gestellte Schumann-Sonate profitierte am meisten davon. Der Beifallssturm am Schluß des offiziellen Programms nahm solche Dimensionen an, daß nach vier Zugaben auch das starke Fußgetrampel das Ausgehen der Lichter nicht verhindern konnte.
15 Pianisten waren während der diesjährigen Festwochen zu hören, Liederabend gab's nur einen, in welchem Martti Travela, der grimme Hagen und Hunding der Oper, seinen mächtigen Baß zu lyrischen Emotionen umzustellen versuchte. Für die zumeist elegischen Gesänge seines Landsmannes Kilpinen bringt der Künstler große stilistische Reife und gefühlstiefen Ausdruck mit, welche den musikalischen Inhalt und dessen Interpretation vollwertig auspendeln. Mit gleichem Gelingen setzte er sich für eine Opem-arie Glinkas ein, die in ihrer Struktur und ihrem russischen Nationalempfinden bereits auf Balakireiu und Borodin vorstößt. Ein Kabinettstück war der Vortrag von Mussorgskys „Flohlied“. Und daß Travela ein so zartes Wort-Ton-Gebilde wie Wolfs „Anakreons Grab“ mit vollster Einfühlung und inniger Verhaltenheit sang, im „Königlichen Gebet“ dagegen den Herrn der Welt mit pompösen Tönen sprechen ließ, zeigt auch gleichzeitig die technische Sicherheit des Künstlers. Ganz in seinem Element war der Sänger bei Mussorgskys „Liedern und Tänzen des Todes“, da konnte er die spukhafte Werbung des Knochenrnannes und die Parade der gefallenen Krieger in da Gebiet bühnenmäßiger Drapierung herüberziehen und den Pomp seines mächtigen, auch den großen Konzerthaussaal füllenden Organs zur Schau stellen. Irwin Gage, wie schon in früheren Konzerten des Bassisten ein vortrefflicher, miterlebender Klavierpartner, zeigte in den zwischen- und Nachspielen aber auch erfreuliche, künstlerische Eigenständigkeit. Man hörte einen einem guten Festwochenniveau gerecht werdenden Abend.
*
Das vor zehn Jahren gegründete Warschauer Philharmonische Kam-
merorchester spielte (im Mozartsaal) ohne Dirigenten. Karol Teutsch leitete das Spiel vom Pult des Konzertmeisters. Man weiß, was das bedeutet: die doppelte Anzahl Proben bei nur halbem Effekt (daher hat man in der UdSSR schon in den zwanziger Jahren dieses Experiment aufgegeben). Bei dem dreisätzigen „Divertimento“ von Felix Janiewicz, einem Vielschreiber aus dem 19. Jahrhundert, ging's einigermaßen glatt (die Bearbeitung, ohne besondere Kennzeichen, stammt von dem Zeitgenossen Andrzej Panufnik). Bei Mozarts wesentlich diffizilerem Klavierkonzert Es-Dur (KV 449) wäre ein Diri-gen vonnöten gewesen. Aber hier entschädigte der junge englische Pianist Michael Roll durch Poesie, Anschlagskultur, genaue Phrasie-rung und „singendem Ton“. Da auch seine Technik nichts zu wünschen übrig ließ, kann von einem durchaus positiven Eindruck gesprochen werden, obwohl das Klavier ungünstig placiert und der Pianist mehr an den Klang des Steinway als an den des Bösendorfer gewöhnt schien. (Den zweiten Teil des Programms, den der Rezensent nicht mehr hören konnte, bildeten ein Klavierkonzert und eine Symphonie von Joseph Haydn).
• Das Lehrerkollegium der Wiener Hochschule für Musik wurde vor kurzem um drei wertvolle Mitglieder bereichert: Die in Wien ansässigen Komponisten Francis Burt, Roman Haubenstock-Ramati sowie Friedrich Cerha werden künftig an diesem Institut Theorie und Komposition unterrichten. Die Berufenen sowie die Hochschule sind gleichermaßen zu beglückwünschen.
Dr. Andreas Liess, Inhaber der Lehrkanzel für Musikgeschichte an der Wiener Musikhochschule, von Professoren und Studenten gleichermaßen hochgeschätzt, feiert dieser Tage seinen 70. Geburtstag. Liess, der einem schlesischen Pastorenhaus entstammt, kam 1925 zum Studium der Musikwissenschaft nach Wien, wo er seine zweite Heimat fand.
Schwerpunkte seiner musikhistorischen Arbeiten bilden die Wiener Barockmusik, die Wiener Oper um 1800, Debussy, Carl Orff und die Moderne überhaupt. Dazu tritt die allgemeine Grundlagenforschung des Faches, welche Liess mit seinen eigenständigen Theorien weit von der engeren Musikwissenschaft wegführt; diese Entwicklung vom Musikwissenschaftler zum Geschichtstheoretiker und Kulturphilosophen dokumentiert sich vor allem in der Konzeption eines polydimensional-dynamischen Geschichtsbildes, welches in das Kerngebiet des „Verstehens“ hineinreicht und bis an die Grenze des Zweifels an Aussagekraft und Erkenntnismethode des diskursiven logischen Denkens führt.
Der Blick, große Zusammenhänge zu erkennen, ist Liess in hervorragender Weise eigen; ein Beispiel hiefür ist die Gefällelehre von der „Theo- und Kosmo-zentrik zur Anthropozentrik“, in welches System er den Entwurf seiner Musikgeschichte einbaute („Die Musik des Abendlandes im geistigen Gefälle der Epochen“, Wien 1970). Als Lehrer stellt o. Prof Liess die abendländische Musik nie isoliert dar, sondern im Rahmen der „Weltmusik“ und als Ausdruck der Geistesgeschichte. R. O.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!