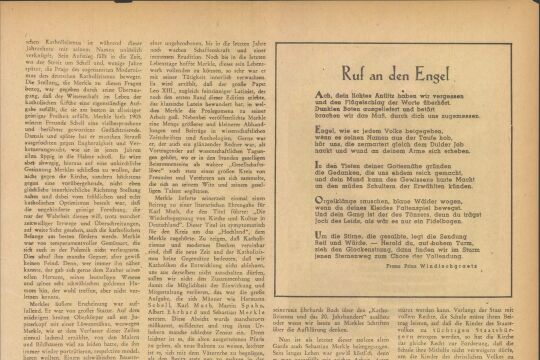Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Modell für das Jahr 2000
Unser heutiges Organisationsmodell des Gesundheitswesens ist das Ergebnis der Sozialkämpfe der politischen Systeme im 19. Jahrhundert. Der Liberalismus sah die Sorge für das Gesundbleiben der Menschen beim Gewissen des einzelnen Arztes gut aufgehoben. Aus dieser Entwicklung kommt in unsere Zeit herauf die Forderung nach der „Freiheit des Arztes“, die heute, im Zeitalter der vielfältigen Einbindung des Arztes in verschiedene Systeme und Abläufe, schwer in concreto zu definieren ist.
Christlich-Soziale und Sozialdemokratie hatten, wenn auch aus verschiedenen Motiven, vor allem Gesundheit für die armen Menschen zu ihrer Forderung gemacht. Damit wurden Spitäler und Krankenvorsorge zu öffentlichen Einrichtungen, auch wenn die Trägerschaft dieser Institutionen nicht staatlich sein mußte. Aus diesen drei Wurzeln wurde in unserer Zeit die Forderung der „Gesundheit für alle“, ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungskraft des einzelnen Patienten oder eine ernsthafte Kosten-Nutzen-Analyse für die Gemeinschaft. Diese Forderungen „Gesundheit für alle ohne individuelle Beschränkung des Einsatzes von Ressourcen“ sind gesellschaftlich so vollständig akzeptiert, daß sie auch für die vorhersehbare Zukunft gelten müssen. Allerdings gibt es zwei wesentliche Hindernisse bei der Durchführung dieser Systemvoraussetzungen: zum einen die Entwicklung der Medizin zu einer äußerst arbeitsteiligen und team-orien-tierten Tätigkeit und zum anderen die Knappheit öffentlicher
Mittel. Meiner Meinung nach müssen alle Reformansätze die Systemvoraussetzungen berücksichtigen und der Überwindung dieser beiden Hindernisse dienlich sein.
Es bedarf eigentlich keiner eingehenden Begründung, um darzustellen, daß es keine Institution gibt, die alle Leistungen des Gesundheitswesens unter eigener Verantwortung erbringen könnte, und schon gar keinen einzelnen Menschen, der alle Disziplinen auf dem Stande der heutigen Möglichkeiten und in Entsprechung zu den Ansprüchen unserer heutigen Menschen erbringen könnte.
Auch die Forderung nach dem Wiedererstarken des Haus- oder Familienarztes gehört wohl eher in den Bereich sozialromantischer Rückblicke als zukunftsorientierter Planungsvorstellungen.
Organisation muß an die Stelle des integrativen Mediziners treten. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, daß in zwei Bundesländern unterschiedlichster Ausprägung, im Westen in Vorarlberg und im Osten in Wien, Sozialsprengelorganisationen begonnen wurden. Hier soll nicht nur der niedergelassene Praktiker mit der lokalen Ambulanz, dem Spital und den Sozialhelfern, mobilen Schwestern und den Heimhilfe- und Krankenpflegediensten zusammenarbeiten, sondern hier soll auch für den kranken und gesundenden Mitbürger der Eindruck einer einheitlichen Leistung deutlich dargestellt werden.
Das Konzept läßt sich relativ leicht formulieren und wird sicherlich alle ehrlichen Anhänger einer breiten Volksmedizin und Sozialvorsorge für sich gewinnen können. Die ungeheuren Schwierigkeiten bei der Durchsetzung eines solchen Systems liegen nicht einmal in den eigentlichen organisatorischen Dingen, wie Terminabstimmung, Wechsel des Einsatzes und Austausch von Informationen, sondern primär in der Finanzierung durch heutige Institutionen.
Die Summe der aneinandergereihten Leistungen ist zweifellos nicht aus öffentlichen Mitteln (von der gesetzlichen Krankenversicherung, der Gemeinde, dem Land, Hilfsvereinen und so weiter) zu bezahlen. Es kann auch nicht ohne weiteres von der Forderung nach Gesundheit für alle auf die Forderung von Rundum-Sozialbetreuung für alle geschlossen werden. Hier werden der einzelne und seine Familie faktisch einen Beitrag leisten müssen. Die Verantwortung des Patienten für seine Gesundheit ist in einem System, das sehr deutlich und drastisch Gesundheit für alle verwirklicht hat, etwas in den Hintergrund geraten. Auch muß darauf hingewiesen werden, daß eine organisatorische Verzahnung aller Gesund-heits- und Sozialdienste in einem Sprengel von Seiten der Anbieter von Gesundheitsleistungen fordert, daß sie Vorstellungen wie „Mein Patient - mein Einzugsgebiet für das Spital“ „Meine medizinische Spezialabteilung“ kaum erlaubt. Andererseits müssen auch der Patient und seine Familie auf gewisse Wahlfreiheiten verzichten, die heutige schein-ökonomischeKassensystemeund Anspruchssysteme sichern. Ein solches System erfordert auch von allen Beteiligten, daß sie sich der Gefahr der Bürokratisierung bewußt sind und diese zu vermeiden wissen. Ein Sozialsprengel soll zweifellos nicht eine Riesenveranstaltung für Körper und Seele werden.
In einer Zeit, in der das Materielle vordergründig oder hintergründig fast alles bestimmt, werden natürlich Lösungsansätze für einen Systemwandel zuerst als finanzielle Lösungsvorschläge gesehen. Es ist zwar nicht erforderlich, daß man neue Organisationsformen mit Überlegungen über die Finanzierung beginnt, es ist aber in unseren westlichen Industriegesellschaften weitgehend üblich.
Daher werden die ersten Ideen Poolung von finanziellen Ressourcen betreffen. So begann man auch mit einer Zusammenarbeit der sozialen Krankenversicherung mit den Spitälern, die dann später durch Mitarbeit der privaten Krankenversicherer an Spitalfragen ergänzt wurde. Konkreter war dann schon die Forderung nach Poolung von Großgeräten in einzelnen Spitälern und die Strukturierung der Spitäler in
Schwerpunkt- und sonstige Krankenhäuser.
Letztlich wurde auch der Patient einbezogen, indem man darauf hinwies, daß er sich während einer Spitalspflege doch einer gewissen Eigenersparnis erfreut, die dem Spitalssystem in Form eines Verpflegskostenbeitrages zugeführt werden soll. Die selbe Idee der Selbstbeteiligung ist etwa bei Pflegeheimen und Altersheimen einigermaßen unstrittig, bei der Behandlung in Spitälern wurde sie jedoch fast augenblicklich zu einem Politikum, mit der dafür typischen Schwarz-Weiß-Malerei von „unsozialer Maßnahme“ bis zu „Beitrag des Nachfragers zum Gesundheitsmarkt“.
Die größte Herausforderung an einen Systemwechsel wird zweifellos die Einbindung der Medizinberufe und der regionalen Träger von Spitälern in dieses System werden. Ohne deren Mitwirkung wird kein Systemwechsel gelingen und es hieße, eine Überforderung der Politik und der Regierungsmacht in die Welt zu setzen, wenn man meint, daß gegen den Widerstand großer Gruppen im Bereich der Gesund-heits- und Sozialberufe Politik gemacht werden könnte. Es ist zu hoffen, daß aufgrund der dramatischen Kostenentwicklungen genügend Bewußtsein für die Notwendigkeit neuer Organisationsformen vorhanden ist.
Der Autor Ist Mitglied des Vorstands der Wiener Städtischen Wechselseitigen Versicherung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!