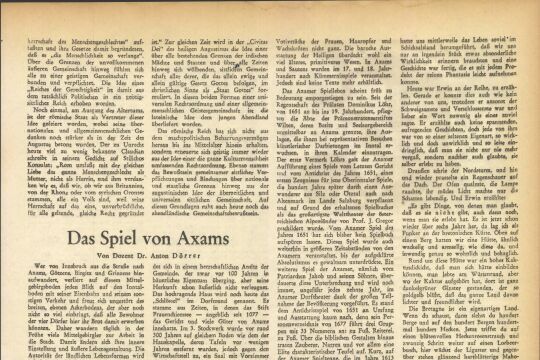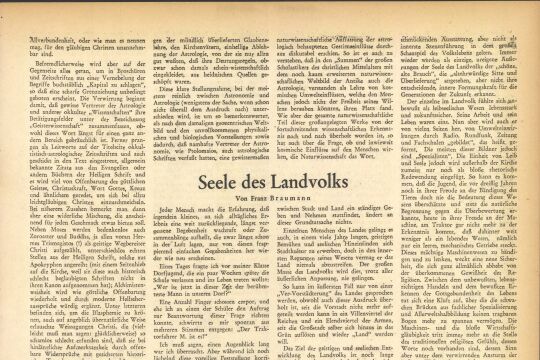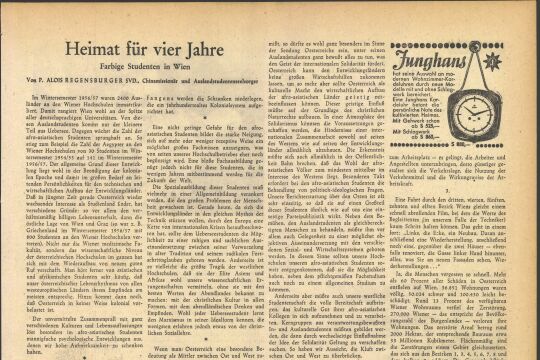Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Modernes im alten Wohnen Hellas
Die alten Griechen kommen uns wieder einmal ruckartig näher. Wieder stellen wir fest, daß „typische Ideen des zwanzigsten Jahrhunderts“ vor zweieinhalb Jahrtausenden mit äußerster Radikalität vorweggenommen wurden.
Lang schien es so, als sei in der klassischen Archäologie kaum mehr mit grundlegend Neuem zu rechnen. Nun purzelt unser Bild vom Leben in der klassischen Po-Iis, der griechischen Stadtgesellschaft.
Neue Erkenntnisse über den griechischen Städtebau fügen nicht neue Steinchen ins alte Mosaik, sondern verändern das ganze Bild. Sie werden zu neuen Forschungen führen, doch schon jetzt „reichen die wirtschaftlichen, politischen, konstitutionellen und anthropologischen Konsequenzen ... sehr weit“, so Christian Meier, Professor für alte Geschichte in München.
Zehn Jahre haben Wolfram Hoepf ner, Leiter des Architekturreferates am Deutschen Archäologischen Institut, und Ernst-Ludwig Schwandner an einem Forschungsprojekt gearbeitet, Ergebnisse früherer Ausgrabungen überprüft und neu interpretiert, bei im Gang befindlichen Grabungen eigene Vermessungen durchgeführt und an etlichen Stellen selbst gegraben.
Vieles von dem, was dabei zum Vorschein kam, bestätigt Aussagen antiker Autoren. Die Ergebnisse liegen in einem dicken Band vor: „Wohnen in der klassischen Polis“.
In der Epoche, in der die Stadtstaaten rasant eine Fülle demokratischer Organisationsmodelle erprobten, standen diese neuen Strukturen in einem viel engeren
Zusammenhang mit täglichem Leben, Architektur und Städtebau, als man bisher wußte.
Als eifrige Kolonisatoren und Städtegründer erwarben die Griechen Know-how sowie demokratisches Gemeinschafts- und Gleichheitsgefühl, die zur Voraussetzung für politische Innovationen wurden.
Bei Stadtgründungen in Asien und Italien entwickelte Methoden wurden auch im Mutterland angewendet - etwa, wenn sich Dörfer zusammentaten, um eine Stadt zu bauen und den Sprung auf eine höhere Ebene politischer Strukturierung zu vollziehen.
Architektur und Städtebau drückten mehrere Generationen lang das Lebensgefühl einer Gesellschaft der Gleichen aus, in der zwar keineswegs alle gleich viel hatten, aber Reiche wie Arme in Häusern wohnten, die auf gleich großen Grundstücken errichtet waren und deren Grundrisse einander glichen wie ein Ei dem anderen — oder wie die Gemeindewohnungen im selben Block.
Auf die Wechselwirkungen zwischen städtebaulichen und politischen Prozessen dürften sich in Zukunft in erheblichem Maß Forschungsinteresse und Forscherfleiß richten.
Den großen Qualitätssprung markiert der offenbar recht plötzlich erfolgte Ubergang von der Streifen- zur Rasterstadt~-«n<& vom Einheitsgrundstück mit individueller Verbauung zum Typenhaus. Er nimmt viel voraus, den ganzen Bogen von den Reihenhaus-Städten der britischen Arbeiterschaft bis zur Stadt der Atriumhäuser, wie sie der Österreicher Roland Rainer nach dem Zweiten-Weltkrieg vorschlug und etwa in Linz-Puchenau verwirklichte.
Auch die Planer der in der Zwischenkriegszeit in Wien errichteten Reihenhaus-Siedlungen (etwa in Donaustadt oder auf der „Lockerwiese“ in Lainz, heute Faistauergasse) dürfen sich einer unvermuteten „Nobilitierung“ durchs klassische Vorbild erfreuen. Allerdings wäre undenkbar gewesen, daß etwa ein Hippoda-mos von Müet Gärtchen hätte offen an Gärtchen grenzen lassen. Strikte Abschirmung der Privatbereiche gehörte zu den Grundsätzen hellenischer Stadtplanung.
Die Idee der auf Gleichheit ihrer Bürger beruhenden Stadt wurde nie zuvor so konsequent verwirklicht wie beim Wiederaufbau von Milet. Vermutlich erwarb Hippo-damos dabei Erfahrung und Bekanntheit, die ihn schon zwei, drei Jahre später für ein so prominentes Projekt wie die Planung der neuen Stadt Piräus qualifizierten. Einer der „Konkurrenzvorteile“ der griechischen Kultur war ja wohl ihre Effizienz beim Erkennen und Fördern von Begabungen, bei der Nutzung ihrer perso-- nellen Ressourcen.
Hippodamos wurde vermutlich nach der Eroberung und Zerstorung des alten Milet, der wichtigen Stadt südlich von Ephesos an der türkischen Westküste durch die Perser (494 vor Christus), mit den anderen Uberlebenden verschleppt und kehrte erst 15 Jahre später nach dem Sieg der Griechen bei Salamis heim.
Die ausgebrannten Ruinen wurden eingeebnet. Sicher waren die alten Eigentumsverhältnisse aufgehoben, so daß die Baugründe neu abgesteckt werden konnten. Das Maß, von dem nun ausgegangen wurde, bildeten nicht mehr Streifen, die durch Addition von je zwei Parzellen beliebig verlängert werden konnten, sondern aus jeweils sechs Hausgrundstük-ken bestehende „Insulae“ (Blök-ke), wobei Grundstücke wie Insulae von nun an im-Sinne der jungen Pythagoräischen Philosophie ganzzahlige Seitenverhältnisse aufzuweisen hatten.
Damit war die Rasterstadt geboren. In Milet wurden wahrscheinlich Nord- und Südteil der neuen Stadt über gleichen, aus Rücksicht auf die Position der alten Heiligtümer um drei Grad verschwenkten Rastern geplant. Spätere Veränderungen machen die Rekonstruktion der Rasterstädte oft schwierig. Im unteritalienischen Thurioi, wo Hippoda-mos zumindest mitgeplant haben muß, liegen die Fundamente unter dem heutigen Grundwasserspiegel, das Straßennetz des darüber errichteten römischen Co-piae könnte auf der griechischen Anlage beruhen.
Uber die Hausgrundrisse von Milet ist (noch) so gut wie nichts bekannt. Piräus aber bedeutete, spätestens, den Startschuß für die neue Stadt. In Piräus, der Stadt der athenischen Seeleute, war nicht nur jedes Grundstück genau gleich groß: 242 Quadratmeter (259 in Milet, 294 in Olynth, 226 in Kassope, 212 in Abdera, 207 in Priene). In Piräus hatten auch alle das gleiche Haus.
Jede Insula bestand aus einer -nördlichen und- -einer- südlichen Zeile von je vier länglichen Parzellen. Bei den südlichen waren
Bebauung und Grundrisse ideal: Im nördlichen Drittel der zweigeschossige Wohn- und Schlafteil, davor der Hof und der niedrige Arbeitsschuppen, über dessen Dach die Wintersonne flach ins Schlafzimmer scheinen konnte, als Abschluß zur Straße Einfahrt und ein kleiner Laden.
Die Nordgrundstücke mußten dem optimalen Sonneneinfall zuliebe ebenfalls vom Süden her erschlossen werden. Dies bedingte verwinkelte Zufahrten. Auch das Prinzip der aneinander angrenzenden „Andrones“, in denen die Männer, möglichst weit weg von den schlafenden Familien, diese mit ihren lauten „Symposien“ nicrft störten, konnte hier nicht ganz durchgehalten werden. Hier wurde auch früher und mehr verändert und umgebaut.
Raster, Grundrisse, Proportionen der Parzellen und Insulae und Zahl der Parzellen in einer Insula wechselten von Stadt zu Stadt und wiederholten sich nie.
Jede Stadt wurde als unverwechselbare Individualität geplant.
Den geistigen Hintergrund bildete jedoch stets der Grundsatz der kaum erreichbaren, aber angestrebten „Gleichverteiltheit“. Interessanterweise haben in dieser von Sizilien bis zum Schwarzen Meer reichenden Welt der griechischen Stadtstaaten auch oligarchisch regierte Städte offenbar dem „demokratischen“, pythagoräisch-hippodamischen Prinzip der Stadtplanung gehuldigt.
Rasterstädte, Typenhäuser, Gleichheitsideal und Demokratie blieben etwa drei Generationen lang attraktiv. Dann ging es gemeinsam bergab.
HAUS UND STADT IM KLASSISCHEN GRIECHENLAND (Wohnen in der klassischen Polis, Band 1) Von Wolfram Hoepfner und Ernst-Ludwig Schwandner unter Mitarbeit von Sotiris Dakaris, Grigoris Konstanti-nopoulos, Konstantina Gravani, Werner Jo Brunner, Ursula Juch-Neubauer und Atha-nassios Tsingas mit Beiträgen von Joachim Boessneck, Konstantina Gravani und Mando Oikonomidou. 296 Seiten, 268 Fotos, Pläne und Rekonstruktionen. Deutscher Kunstverlag. München 1986. Pb., ÖS 1.544,40.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!