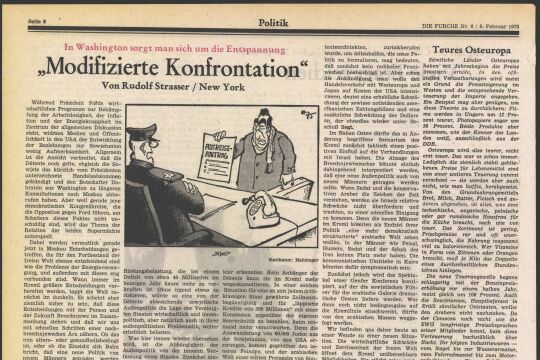Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mord als Symptom
Die Ermordung des amerikanischen Botschafters und seines Handelsattaches im Libanon war zweifellos eine Herausforderung der westlichen Supermacht. Wieder einmal sollte der Welt gezeigt werden, wie schwach und hilflos die amerikanische Demokratie, besonders in einem Wahljahr, tatsächlich ist. Man wird wohl nicht weit fehlgehen, wenn man hinter dieser Tat, die man fürs erste einer linksradikalen Splittergruppe in die Schuhe schob, Methode wittert. Methode, die dem sowjetischen Konzept für die Untergrabung amerikanischen Einflusses, wo immer möglich, zugrunde liegt.
Eine Friedens- oder Ordnungsmacht im Nahen Osten, die nicht einmal ihre Repräsentanten schützen kann, die nach dem erhaltenen Bak-kenstreich auch noch die andere Wange hinhalten muß —? Denn Präsident Ford erklärte nach dem Mord resigniert: „Wir werden uns in unseren Bemühungen um den Frieden durch diesen Mord nicht beeinträchtigen lassen.“ Der demokratische Kandidat Carter stimmte ihm bei,und Fords Herausforderer von der Rechten, Reagan, äußerte sich nicht.
Die Situation ist jener während des Bürgerkriegs in Angola nicht unähnlich. Dort wurden der US-Regierung die Hände durch Kongreßbeschluß gebunden. Sie mußte ohnmächtig zusehen, wie kubanische Soldaten im Solde der Sowjetunion den Linksradikalen die Macht zuspielten. Jetzt, im Libanon, wurde erst gar nicht mehr versucht, die in diesem Räume so wichtige Optik zu wahren. Einst sandte man die Marine aus, heute läßt man sich durch einen Mord am eigenen Botschafter „in den Friedensbemühungen nicht stören“. Selten ist der Verlust von Macht so deutlich ausgedrückt worden.
Daß sich derartige Zwischenfälle und derartige Gesichtsverluste wiederholen werden, kann mit aller Sicherheit erwartet werden. Es sind dies Tests, mit denen die Sowjetunion überprüft, wie weit die westliche Großmacht provoziert werden kann, wie groß das Vakuum bereits ist, in das man vorstoßen will. Es mag nicht unerwähnt bleiben, daß dieser Mord eine Woche vor den italienischen Wahlen stattfand, eine Woche also, bevor ein Volk zur Entscheidung aufgerufen wurde, das nie prinzipiell, sondern fast immer noch opportunistisch entschieden hat.
Es soll hier nicht einem sinnlosen Racheakt, einer blinden militärischen Intervention oder Ähnlichem das Wort geredet werden. Man würde sonst jenem Kind gleich, dem man die Augen verbunden hat und das nun blind nach den Peinigern hascht, die ihm Schläge versetzt haben. Soll man die PLO belangen, die Libyer, die Iraker oder gar den Kreml, der doch sogar sein Bedauern über den Zwischenfall geäußert hat? Hier soll nur analysiert werden, wie weit es bereits gekommen ist, was sich die amerikanische Großmacht heute schon alles gefallen lassen muß.
Und da wird wieder einmal klar, daß es nicht der Mangel an Waffen oder an Rüstung ist, der zu diesem Machtverlust geführt hat. Es ist vielmehr der Mangel an Bereitschaft der Bevölkerung, sich zu engagieren, der die Politiker zögern und zaudern läßt.
Wen wundert es, wenn Außenminister Kissinger desillusioniert ist über das Echo seiner Warnung an die NATO und die Italiener? Nicht einmal die Führer der Italoamerika-ner wollten sich im italienischen Wahlkampf engagieren. „1976 sei nicht 1946“ hieß es in Kommentaren der italoamerikanischen Presse, man möge in Italien zusehen, wie man allein aus dem Chaos herauskomme. Als handle es sich nicht um die eigenen Großeltern, Eltern, Geschwister und Vettern!
Es ist anderseits das Mißtrauen gegenüber Washington, das der demokratische Kandidat Carter so meisterhaft für seine politischen Ziele eingespannt hat, das die andere Komponente dieser Schwäche darstellt. Das Unvermögen, mit dem Verbrechen in den Straßen fertig zu werden, wirtschaftliche Probleme zu lösen oder mit der Rassenintegration weiterzukommen — jedes einzelne dieser Fiaskos und viele andere tragen dazu bei, daß man an der Regierungszentrale verzweifelt und sie der Impotenz bezichtigt. Die Gerichte, wegen der zunehmenden Verbrechen, den Kongreß, der zwar zu sparen verspricht, dessen einzelne Mitglieder ihre Wiederwahl jedoch nur mit kostspieligen Versprechungen betreiben, oder das Weiße Haus, das einen torkelnden Slalomlauf zwischen den Hindernissen, die ein feindlicher Kongreß aufgestellt hat, versucht. Das Wahlvolk ist zutiefst desillusioniert, die Schwäche scheint endemisch zu sein. Positiv ist dabei nur die Sehnsucht nach einer Erneuerung, die schon heute Vorschußlorbeeren einem Carter spendet, dessen Programm noch niemand kennt.
Positiv zu bemerken ist auch die Haltung des alten Gewerkschaftspräsidenten Meany, der es vorzieht, aus der ILO (Internationale Arbeits-Organisation) auszutreten, bevor auch er dort Erniedrigungen ausgesetzt wäre.
Nichts ist schwieriger, als ein Abgleiten zu stoppen. Wenn es aber überhaupt gelingt, so muß der Beginn beim Grundsätzlichen gemacht werden. Demokratie baut mit kleinen Bausteinen. Wenn der Grund solid ist, wird wieder Vertrauen einziehen. Wenn das, was man verteidigen soll, wert ist, verteidigt zu werden, wird die Außenpolitik wieder glaubhaft werden — man wird sich Niederlagen, wie den Mord von Beirut und seine Folgen, ersparen können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!