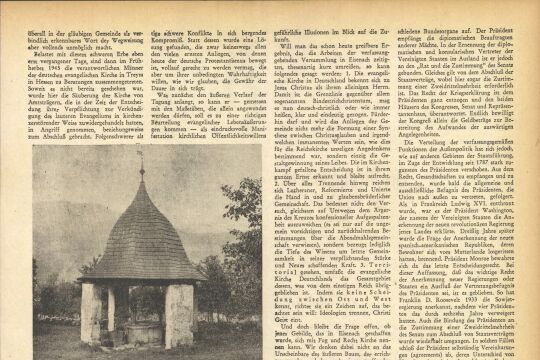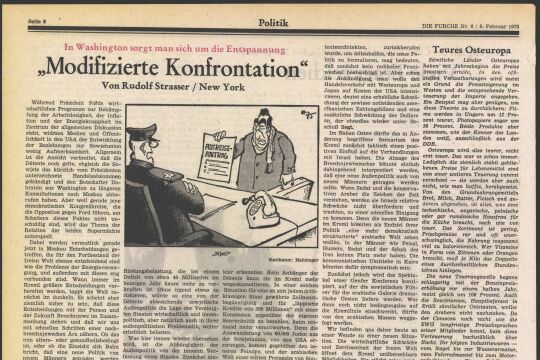Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Multipolare oder unipolare Welt?
Der Ost-West Gegensatz war bis zum Ende der totalitären Regime Osteuropas gezeichnet vom weltweiten Kampf zwischen den todfeindlichen Ideologien Kommunismus und liberale Demokratie. Die noch nie dagewesene Zerstörungskraft der Nuklearwaffen verlieh den beiden Kontrahenten den tödlichen Stich von Taranteln, die, in einer Flasche gefangen, sich jederzeit gegenseitig umbringen konnten - so eine populäre Metapher in der Fachliteratur. Eine der Taranteln scheint nun zugrunde zu gehen; allerdings besitzt sie noch immer tödliche Atomwaffen, deren Existenz in der Debatte um das „Ende" des Kalten Krieges nicht außer acht gelassen werden darf.
Der Ost-West Gegensatz war bis zum Ende der totalitären Regime Osteuropas gezeichnet vom weltweiten Kampf zwischen den todfeindlichen Ideologien Kommunismus und liberale Demokratie. Die noch nie dagewesene Zerstörungskraft der Nuklearwaffen verlieh den beiden Kontrahenten den tödlichen Stich von Taranteln, die, in einer Flasche gefangen, sich jederzeit gegenseitig umbringen konnten - so eine populäre Metapher in der Fachliteratur. Eine der Taranteln scheint nun zugrunde zu gehen; allerdings besitzt sie noch immer tödliche Atomwaffen, deren Existenz in der Debatte um das „Ende" des Kalten Krieges nicht außer acht gelassen werden darf.
George Bushs politische Erziehung war die eines typischen Nachkriegs-Kalten-Kriegers, wie er in seinen Reaktionen auf Saddam Husseins Einmarsch in Kuweit zeigte. Das berühmte „München-Syndrom", daß nämlich Diktatoren nicht beschwichtigt werden dürfen, wie das die Westmächte mit Hitler im Jahre 1938 machten, diente amerikanischen Präsidenten seit dem Koreakrieg als die Hauptlehre aus den dreißiger Jahren, die bei der Eindämmung potentieller kommunistischer Aggression nie vergessen werden durfte.
Wenn auch seine Denkmuster noch nicht von den Formeln des Kalten Krieges frei sind, so zeigte George Bush in seinen Reaktionen auf die revolutionären Ereignisse von 1989 bis 1991 erstaunliches außenpolitisches Fingerspitzengefühl. Sorgfältige Zurückhaltung charakterisiert die Außenpolitik seiner noch andauernden ersten Amtsperiode: ungleich seinem Vorgänger Ronald Reagan mit dessen (schein)heiligen Litaneien über amerikanische Auserwähltheit, nimmt Bush den Mund selten allzu voll; er reagiert auf Ereignisse mit moderaten öffentlichen Statements, er bevorzugt es, über private Kommunikationskanäle seine vertrauten westlichen Verbündeten in seine Ent-scheidungsprozesse miteinzubeziehen. Dabei gehen ihm der unauffällige und loyale Nationale Sicherheitsberater Brent Scowcroft sowie der emsige Außenminister James Baker zur Hand, ohne sich gegenseitig zu zerfleischen, wie das unter Bushs Vorgängern zwischen State Departement und National Security Council regelmäßig der Fall war.
Als unermüdlicher Apostel für interne Reformen in der Sowjetunion setzte Bush wahrscheinlich zu lange und zu exklusiv auf Gorbatschow, wie die jüngsten Ereignisse in Moskau anzudeuten scheinen. Bush weiß jedoch, daß ohne Gorbatschow die Revolutionsepoche 1989/91 nicht so glatt abgelaufen wäre, wenn überhaupt in friedlicher Form. Ohne Gorbatschow gäbe es heute wohl kaum eine Debatte um das „Ende" des Kalten Krieges und die daraus resultierenden zukünftigen internationalen Strukturen, hätte Bush auch wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, an einer „neuen Weltordnung" zu basteln.
Präsident Bush hat die revolutionären Ereignisse in Osteuropa dadurch ermöglicht, daß er auf den Kollaps des Kommunismus in Osteuropa mit erstaunlicher Zurückhaltung reagierte. Er unterließ es, den „Sieg" im Kalten Krieg lautstark zu feiern, wie es der rechte Flügel in seiner Partei so gerne gesehen hätte. Er hat um den Fall der Berliner Mauer „keinen Freudentanz" aufgeführt, wie das Jeane Kirkpatrick in der einflußreichen Zeitschrift „Foreign Affairs" ausgedrückt hat.
Als neulich die KPdSU verboten wurde, hat der moderate Bush das mit ebensowenig Emotionen entgegengenommen, wie die Nachricht vom Coup der alten Garde. Bush scheint eine Kunstform aus der öffentlichen Pose des Understatements in Zeiten welthistorischer Umwälzungen zu machen.
Die Welt hat sich im modernen Medienzeitalter schnell an den im Urlaub in Kenne-bunkport demonstrativ Golf spielenden und angelnden amerikanischen Präsidenten gewöhnt, dem es mit seiner (gespielten?) Nonchalance immer wieder gelingt, dramatische Weltlagen zu entschärfen, während sein gut eingespielter Sicherheitsapparat die Lage voll unter Kontrolle hat.
Aura der Unschlagbarkeit
Nach außen hin konnte sich kein Präsident seit den republikanischen Vorgängern Dwight D. Eisenhower und Richard Nixon in soviel Erfolg in der Außenpolitik sonnen, wie George Bush: erfolgreiche Invasion in Panama, revolutionäre und trotzdem friedliche Veränderungen in Osteuropa, ein vereintes Deutschland in der NATO, gevifte multilaterale Diplomatie, die zur Golfkoalition und zum siegreichen Blitzkrieg führte, erfolgloser Coup und Ende des Sowjetreiches
- all das scheint Bush in der kommenden Präsidentenwahl 1992 die Aura der Unschlagbarkeit zu verleihen.
Bushs Popularität ist so überwältigend, daß sich die potentiell schlagkräftigsten Kandidaten in der Demokratischen Partei in den Startlöchern verkriechen. Bisher hat nur der kaum bekannte ehemalige Senator Paul Tsongas sich als Kandidat zu erklären getraut
- er ist ein griechischstämmiger Demokrat aus Massachusetts - „hardly a winning combina-tion", wie politische Beobachter witzeln.
Verfolgt man aber die harten inneramerikanischen Debatten, die unter der Oberfläche der Tagespolitik schwelen, so ist die Sache komplizierter und Bushs politische Stellung weit umstrittener als man das in Europa wahrhaben möchte. Die Debatte um die längerfristige Ausrichtung der zukünftigen amerikanischen Außenpolitik ist bereits entbrannt und wird sich im nächstjährigen Wahlkampf wohl weiter erhitzen.
Imperiale Überspannung
Die Diskussion über das zukünftige internationale System - multipolar.oder unipolar? -und den Platz der USA darin könnte sich zu einer jener „großen Debatten" entwickeln, wie sie in diesem Jahrhundert nach den beiden Weltkriegen entbrannt sind: in den zwanziger Jahren zog man sich bekanntlich in die Isolation zurück, 1945 bis 1947 machte man widerwillig den Schritt zur globalen Führungsmacht.
Das informelle amerikanische Weltreich nach dem Zweiten Weltkrieg war charakterisiert von Hunderten von Militärbasen und Installationen sowie von Hunderttausenden von amerikanischen GIs, die um die ganze Welt gegen jeden potentiellen Vorstoß kommunistischer Aggression Wache standen. Die Zukunft dieser weltweiten Präsenz steht nun am Ende des Kalten Krieges zur Debatte, einer Präsenz, die von manchen Kritikern als „imperiale Überspannung" (imperial over-stretch) angesehen wird, die Amerika finanziell nicht mehr verkraften kann.
Während sich die USA in der imperialen Abendsonne recken, „fällt die Nation auseinander", wie der angesehene Kolumnist Leslie Gelb das in der „New York Times" ausgedrückt hat. Die Vereinigten Staaten konnten sich seit 1945 nie von außen so sicher fühlen und im Innern so bedroht. Diese innenpolitischen Probleme und Spannungen stellen die wirkliche Herausforderung für den nächsten Präsidenten dar.
Der Autor unterrichtet amerikanische Geschichte und internationale Beziehungen an der Universität von New Orleans. Ein zweiter Beitrag über die Zukunft der US-Außenpolitik in der Sicht amerikanischer Kommentatoren folgt nächste Woche.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!