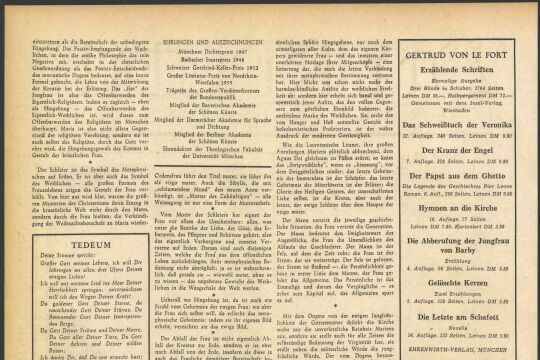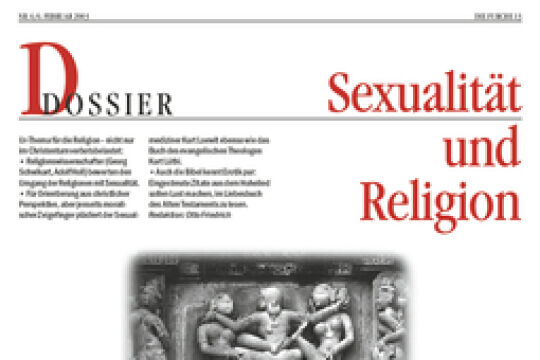Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mutters Bande währen lang
Die meisten Männer beteuern heute, sich in ihrer Ehe, in der Familie partnerschaftlich zu verhalten. Aber bedeutet das, daß sie die Rechte, die sie für sich in Anspruch nehmen, auch der Partnerin zugestehen? Sind sie wirklich bereit, ihre Partnerinnen — bei aller Andersartigkeit — als gleichwertig zu behandeln?
Eine wesentliche Begründung für die Ungleichwertigkeit von Frauen und Männern haben christliche Theologen - geprägt von den philosophischen und sozialen Denkvorstellungen ihrer Zeit - geliefert. Entgegen den Aussagen der biblischen Schöpfungsgeschichte (Gen 1,27 und 2,22) haben zunächst Augustinus (354—430) und später Thomas von Aquin (1225-1274) den Frauen Minderwertigkeit gegenüber den Männern zugeschrieben, was ihre physischen Kräfte und ihre Vernunft betrifft. Dieser anthropologischen Unterordnung bei gleichzeitigem Festhalten an der Gleichwertigkeit der Seelen von Mann und Frau vor Gott kommt eine Schlüsselrolle in der Ambivalenz christlicher Aussagen über die Frauen zu. Diese haben aber jahrhundertelang in unserem Kulturkreis das Menschenbild geprägt.
Überkommene Rollenbilder von „Mann-Sein“ und „Frau-Sein“ abzulegen, erfordert von Männern und Frauen die Bereitschaft, in einem lebenslangen Prozeß ihre eigene männlich oder weiblich geprägte Identität zu entwickeln. Von der vordergründigen Selbstverwirklichung, die viele Männer zu berufsbesessenen Arbeitsfanatikern oder manche Frauen zu aus Prinzip männerlosen Müttern werden läßt, unterscheidet sie sich grundsätzlich durch ihre Bezogenheit auf den/die andersgeschlechtliche(n) Partner(in).
In letzter Zeit sind einige Veröffentlichungen der Problematik männlicher Identitätsfindung nachgegangen, manche der vorgelegten Klärungsversuche scheinen gute Gründe für sich zu haben.
Einer von ihnen geht davon aus, daß in der frühen Mutter-Kind-Beziehung auch der Sohn eine Art weibliche Ur-Identität erlange, von der er sich später mit Hilfe der Identifikation mit dem Vater abzugrenzen habe. Bei der Wiederannäherung an die Frau im Erwachsenwerden würden bei einer nur brüchig ausgebüdeten männlichen Identität Ängste vor einer Identitätsauflösung hochkommen. Bis zu einem gewissen Grad bestimmten diese Ängste jede Beziehung zu Frauen. Aus einer solchen Verletzbarkeit seien auch die Tendenzen zur Abwertung oder zur Abhängighaltung der Frauen zu erklären.
Umgekehrt müßte sich der Mann durch Selbstdisziplin und Kontrolle seiner Gefühle vor der Ansteckung durch das „Weibliche“ schützen, eines „Weiblichen“, das auch im Mann angelegt sei. Wenn Männer dieses „Weibliche“ in sich zu akzeptieren und zu integrieren vermögen, das „Fremde“ als Anteil in sich selbst sähen, dann würden auch gleichberechtigte Beziehungen zu Frauen besser gelingen können (daß umgekehrt natürlich es auch für die Frauen gilt, das „Männliche“ in sich zu akzeptieren, um im Bewußtsein der Gleichwertigkeit angstfreier mit den Männern umzugehen, sei hier nur erwähnt).
Vielfältige und differenziert verlaufende Machtausübung von Männern über Frauen könnte abgebaut werden, wenn eine Reduzierung dieser Ängste gelänge (Bernd Nietzschke in „Was ist mit den Männern los?“, Biederstein-Verlag, München 1985).
Ebenfalls aus der frühen Mutter-Sohn-Bindung deutet Volker Elis Pilgrim in seinen „Muttersöhnen“ (Claassen-Verlag, Düsseldorf 1986) die Grundzüge einer verhängnisvollen Entwicklung. Die in der männlich dominierten Gesellschaft in ihrer Entfaltung eingeschränkte Mutter konzentriere ihre durch die Partnerbeziehung frustrierten Gefühle auf den Sohn, der sie an seinen Taten und Verdiensten, an seiner Macht teilhaben lasse. Ein abwesender, gesichts- und liebloser Vater trage wenig zur Ausbildung der männlichen Geschlechtsidentität bei, die Spannung zwischen dieser ungenügenden Vater- und der zu engen Mutterbeziehung erzeuge eine Art Zerstörungsfanatismus. Anhand der Biographien berühmter Männer, besonders hebt Pilgrim Hitler, Stalin und Napoleon hervor, wird eine eher überzeichnete Beweiskette geführt.
Wieder von der Mutter-Sohn-Bindung geht ein dritter Interpretationsversuch aus, der in den Männern eine von der Mutter grundgelegte „Sucht nach der Frau“ ortet (Wilfried Wieck in „Männer lassen heben“, Kreuz-Verlag, Stuttgart 1987). Die Mutter und später die Partnerin stütze quasi als „Therapeutin“ den Mann durch ihre Anwesenheit, ihre Kraft, ihr Gemeinschaftsgefühl, ihre Fähigkeit zur Kommunikation. Männer lehnten daher eigenständige Entwicklungen ihrer Partnerinnen aus dem Gefühl der Eifersucht ab, die Erfahrung, ohne Frau nicht lebensfähig zu sein, würde durch Gewalttätigkeit kompensiert.
Selbstbewußte Frauen sollten nicht mehr weiterhin als „Droge“ zur Verfügung stehen und auf diese Weise den Männern ihre eigenen Entwicklungen ersparen, meint Wieck.
Die folgende kleine Geschichte aus einem anatolischen Dorf gibt etwas von dem Geist wieder, nach dem sich auch in unseren Breiten Männer zurücksehnen mögen — aber seine Zeit ist endgültig vorbei. Der Sohn des Vorstehers hat einen Diebstahl begangen. Sein Vater zögert mit der fälligen Bestrafung, denn die leibliche Mutter des Sohnes ist verstorben, und das Verhältnis zu seiner Stiefmutter ist nicht das beste - die Mutter aber müsse den Sohn trösten, nachdem er vom Vater zu Recht verprügelt worden sei. Da das in diesem Fall nicht möglich sei, hat der Bestohlene über die Bestrafung zu entscheiden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!