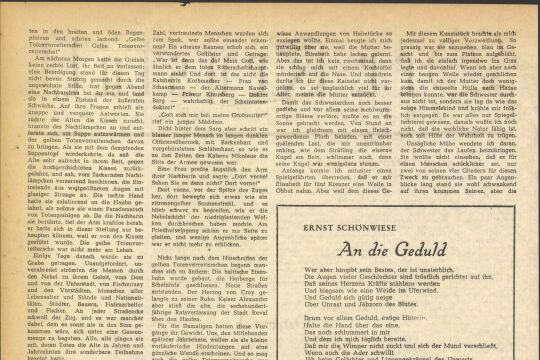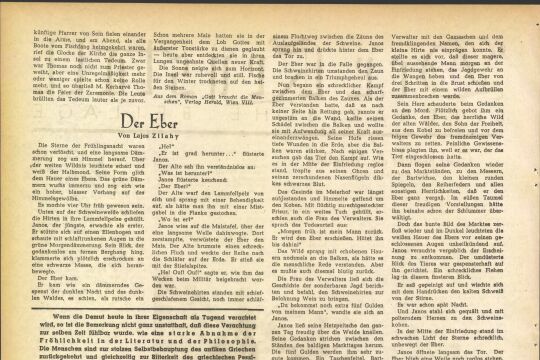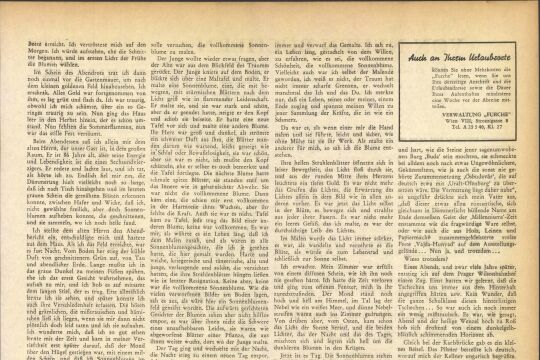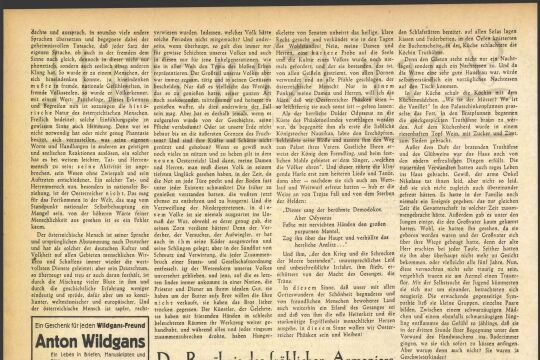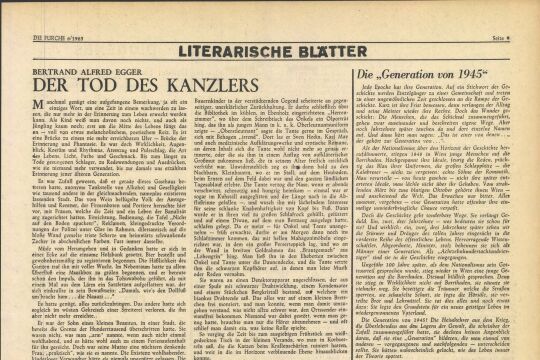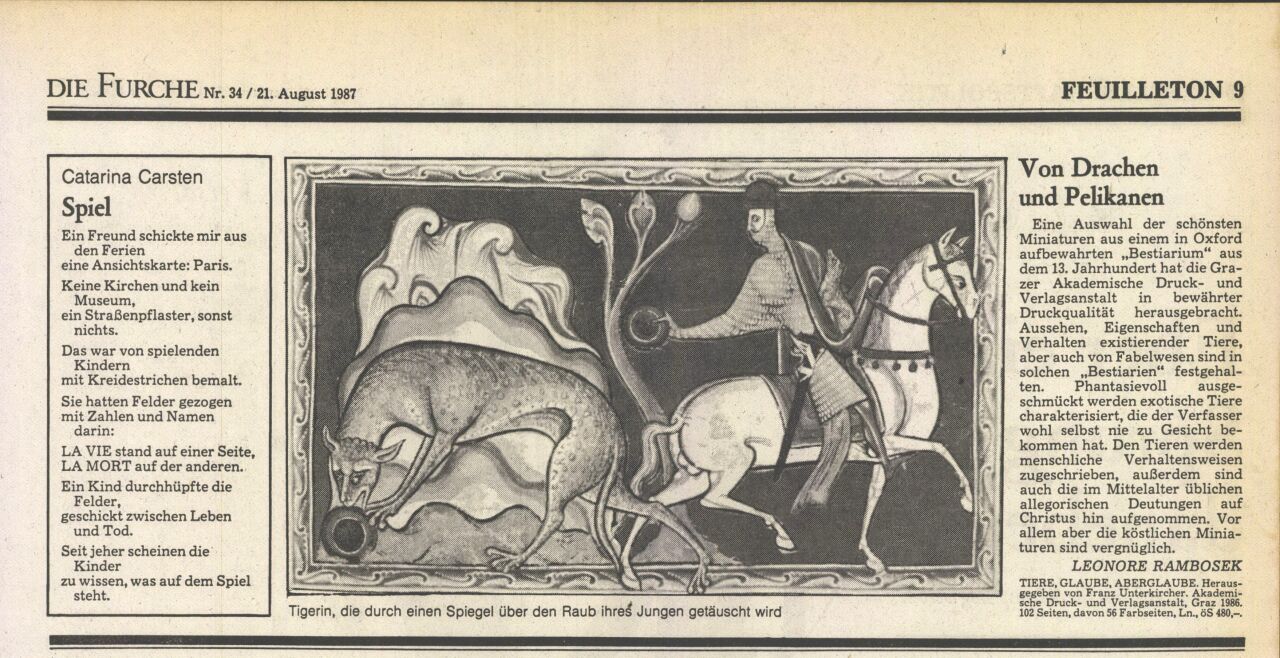
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nachruf für Frau Vistopil
Der Inbegriff der Verschwendungssucht und des Leichtsinns ist für mich, als ich ein Kind war, eine gewisse Frau Vistopil gewesen, von der es hieß, sie habe ihr Haus verfressen. Heute allerdings will mir scheinen, als hätten wir damals viel zu hart über sie geurteilt, und ihr in unserer kleinen Stadt so berühmter Ausspruch „Heit is heit” stimmt mich nachdenklich und ein wenig elegisch nach so langer Zeit.
Frau Vistopil war eine füllige, großgewachsene Person in mittleren Jahren, mit knallroten Wangen und wäßrigblauen Augen. Sie handelte mit Obst und Gemüse und hatte sich im Laufe der Zeit auf diese Weise ein nicht unbeträchtliches Vermögen erwirtschaftet. Nach dem Tode ihres Mannes jedoch trat jener junge Laffe in ihr Leben, hübsches Gesicht, aber nichts dahinter, eine jener Tragödien begann sich abzuzeichnen, die in kleinen Städten so ungeheures Aufsehen erregen, beim Kaffee beklatscht und ausgeschmückt werden, bis sie schließlich so sehr zum festen Bestandteil der Konversation gehören, daß man sie eigentlich in den Heimatkundeunterricht der Schulen einbeziehen sollte.
Jener junge Mann also nahm eines schönen Tages den Platz an der Seite der Frau Vistopil ein, der ihm nach dem Urteil der öffentlichen Meinung nicht zukam, eben weil er zu jung, zu hübsch, zu untüchtig und zu lebenslustig war, er begann, ihr Geld mit vollen Händen auszugeben, ging keiner geregelten Arbeit nach, kleidete sich nach dem jeweils letzten Diktat großstädtischer Mode und erhielt eines Tages von seiner Gönnerin sogar - und dies brachte die Stimmung in der Bevölkerung gegen ihn zum Sieden - ein Auto geschenkt, brauste damit von dan-nen und ward nimmermehr gesehen.
Frau Vistopils Schmerz war groß. Sie hätte sich dem Trunk ergeben können, niemand hätte sich darüber gewundert, und manch eine andere hätte dies an ihrer Stelle getan. Wein hatten wir genug in Mähren. Sie tat es nicht. Da aber der Mensch in Phasen besonderer seelischer Erschütterung irgend etwas haben muß, an das er sich halten kann, und da sie einem guten Schnitzel oder einem saftigen Gänsebraten nie abgeneigt gewesen war, begann sie sich mit jenen Genüssen zu trösten, die ihr das Leben noch zu bieten hatte. Kurz gesagt, den Rest ihres arg zusammengeschmolzenen Vermögens legte Frau Vistopil in Delikatessen an. Man erzählte sich, daß in ihrer Küche, wann immer man sie besuchte, Schüsseln voll der herrlichsten Schnitzel herumstanden, die sie wie Kuchen anbot, vom besten Fleisch und stets frisch gebacken; es war ihre Art, den Schmerz zu besiegen, der ihr widerfahren war.
Nein, wir haben sie nicht verstanden. Wir redeten und klatschten über sie in kleinbürgerlichem Unverstand. Sie aber, durch ihre übertriebene Eßlust noch weiter an den Rand des völligen Ruins getrieben, als sie es schon gewesen war, sah schließlich keinen anderen Ausweg, als an den Verkauf ihres Hauses zu denken und zu ihrer Schwester zu ziehen, die in einem benachbarten Dorf einen kleinen Bauernhof besaß.
Jenes Haus der Frau Vistopil, klein und ebenerdig, mit roten Ziegeln gedeckt, lag unserer Wohnung schräg gegenüber, zwischen dem einstöckigen Gebäude, in welchem mein Vetter Otto die Geige zu kratzen pflegte, und einem winzigen Geschäft, welches zwei Schwestern namens Redlich führten. Es war kein besonderes Haus, nein, gewiß nicht, aber der Platz, auf dem es stand, war günstig gelegen, man konnte es abtragen lassen und an seiner Stelle ein neues Haus errichten, nicht gleich, aber eines Tages, ein Wohnhaus mit Garten und Garage und allem, was dazugehörte, mit bunten Glaskugeln, die über kunstvoll geschnittenen Rosen-bäumchen schwebten, mit Beeten voller Tulpen, Herrgottsherzchen und Reseden, man konnte ein richtiges, eigenes, wundervolles Haus bauen, eines Tages vielleicht, und bis dahin konnte man wenigstens von einem solchen Hause träumen.
Ich sehe sie noch in unserem Wohnzimmer thronen, Frau Vistopil, in feierliches Schwarz gehüllt, die feisten Wangen noch röter als gewöhnlich, ein aufgeregtes Glitzern in den wasserblauen Augen. Sie knüllte ein mit Spitze besetztes Batisttaschentuch in den Händen und schenkte mir ein zerstreutes Lächeln, das dann, als ihr Blick mich wieder losließ, in ihrem Gesicht stehenblieb und ihm einen Ausdruck seltsamer Verlorenheit gab.
Frau Vistopil war damals gekommen, meinen Eltern ihr Haus anzubieten. Mein Vater kaufte das Haus. Er ließ einen entfernten Neffen von weither kommen, aus Mauer bei Wien, er brachte den Geruch der Großstadt mit und begann zu zeichnen. Er zeichnete mehrere Tage lang, zog dünne und dünnste Linien über weißes Papier, mit Bleistift und mit Tusche, bis endlich ein hübsches, einstök-kiges Gebäude zu erkennen war, das große Fenster hatte und sogar, wie ich mich zu erinnern glaube, einen Balkon, meine Mutter war entzückt, und mein Vater lächelte still in sich hinein, und abends saßen sie beisammen und schmiedeten Pläne, die sich nicht erfüllen sollten.
Denn wir haben dieses Haus natürlich nie gebaut. Wenn es auch weitergewachsen ist, in unseren Erinnerungen und Träumen, zu einer Größe und Pracht, die es in Wahrheit niemals auch nur annähernd erreicht hätte. Frau Vistopil aber, deren Philosophie wir damals so gar nicht verstanden haben, muß, so denke ich heute, eine recht kluge Person gewesen sein. Was waren ihr Gut und Geld, sie gab alles hin für ein paar glückliche Jahre. Sie verschleuderte dafür sogar ihr Haus an uns, die Braven, die Tüchtigen, die Sparsamen. Uns aber ist davon letzten Endes auch nichts geblieben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!